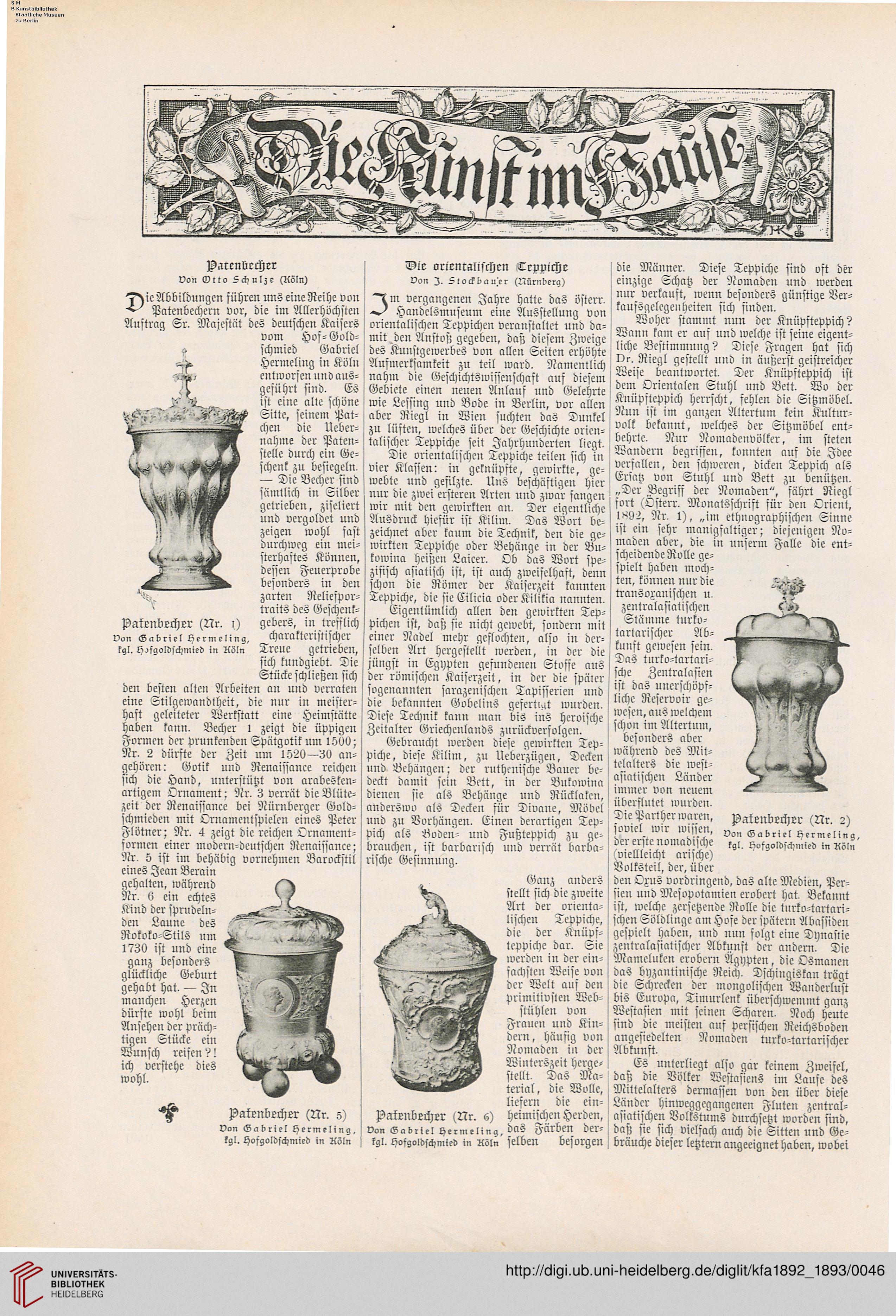Mitcnbccher
von Vtto Schulze (Röln)
paienbrchrr (Nr. 0
^7>ie Abbildungen führen uns eine Reihe von
Patenbechern vor, die im Allerhöchsten
Auftrag Sr. Majestät des deutschen Kaisers
vom Hof-Gold-
schmied Gabriel
Hermeling in Köln
entworfen und aus-
gesührt sind. Es
ist eine alle schöne
Sitte, seinem Pat-
chen die Ueber-
nahme der Paten-
stelle durch ein Ge-
schenk zu besiegeln.
— Die Becher sind
sämtlich in Silber
getrieben, ziseliert
und vergoldet und
zeigen wohl fast
durchweg ein mei-
sterhaftes Können,
dessen Feuerprobe
besonders in den
zarten Reliefpor-
traits des Gejchenk-
gebers, in trefflich
charakteristischer
Treue getrieben,
sich kundgiebt. Die
Stücke schließen sich
den besten alten Arbeiten an und verraten
eine Stilgewandtheil, die nur in meister-
haft geleiteter Werkstatt eine Heimstätte
haben kann. Becher l zeigt die üppigen
Formen der prunkenden Spätgotik um 1500;
Nr. 2 dürste der Zeit um 1520—30 an-
gehören: Gotik und Renaissance reichen
sich die Hand, unterstützt von arabesken-
artigem Ornament; Nr. 3 verrät die Blüte-
zeit der Renaissance bei Nürnberger Gold-
schmieden mit Ornamentspielen eines Peter
Flötner; Nr. 4 zeigt die reichen Ornament-
sormen einer modern-deutschen Renaissance;
dir. 5 ist im behäbig vornehmen Barockstil
eines Jean Berain
gehalten, während
Nr. 6 ein echtes
Kind der sprudeln-
den Laune des
Rokoko-Stils um
1730 ist und eine
ganz besonders
glückliche Geburt
gehabt hat. — In
manchen Herzen
dürste wohl beim
Ansehen der präch-
tigen Stücke ein
Wunsch reifen?!
ich verstehe dies
wohl.
Pakenbrchrr (Nr. 5)
von Gabriel Hermeling
kgl. Hofgoldschmied in Aöln
Die orientalischen Teppiche
m vergangenen Jahre hatte das öftere.
Handelsmuseum eine Ausstellung von
orientalischen Teppichen veranstaltet und da-
mit den Anstoß gegeben, daß diesem Zweige
des Knnstgewerbes von allen Seiten erhöhte
Aufmerksamkeit zu teil ward. Namentlich
nahm die Geschichtswissenschaft auf diesem
Gebiete einen neuen Anlauf und Gelehrte
wie Lcssing und Bode in Berlin, vor allen
aber Riegl in Wien suchten das Dunkel
zu lüsten, welches über der Geschichte orien-
talischer Teppiche seit Jahrhunderten liegt.
Die orientalischen Teppiche teilen sich in
vier Klassen: in geknüpfte, gewirkte, ge-
webte und gefilzte. Uns beschäftigen hier
nur die zwei elfteren Arten und zwar fangen
wir mit den gewirkten an. Der eigentliche
Ausdruck hiefür ist Kilim. Das Wort be-
zeichnet aber kaum die Technik, den die ge-
wirkten Teppiche oder Behänge in der Bu-
kowina heißen Laicer. Ob das Wort spe-
zifisch asiatisch ist, ist auch zweifelhaft, denn
schon die Römer der Kaiserzeit kannten
Teppiche, die sie Cilicia oder Kilikia nannten.
Eigentümlich allen den gewirkten Tep-
pichen ist, daß sie nicht gewebt, sondern mit
einer Nadel mehr geflochten, also in der-
selben Art hcrgestellt werden, in der die
jüngst in Egypten gefundenen Stoffe aus
der römischen Kaiserzeit, in der die später
sogenannten sarazenischen Tapisserien und
die bekannten Gobelins gefertigt wurden.
Diese Technik kann man bis ins heroische
Zeitalter Griechenlands zurückverfolgen.
Gebraucht werden diese gewirkten Tep-
piche, diese Kilim, zu Ueberzügen, Decken
und Behängen; der ruthcnische Bauer be-
deckt damit sein Bett, in der Bukowina
dienen sie als Behänge und Rücklaken,
anderswo als Decken für Divane, Möbel
und zu Vorhängen. Einen derartigen Tep-
pich als Boden- und Fußteppich zu ge-
brauchen, ist barbarisch und verrät barba-
rische Gesinnung.
Ganz anders
stellt sich die zweite
Art der orienta-
lischen Teppiche,
die der Knüpf-
teppiche dar. Sie
werden in der ein-
fachsten Weise von
der Welt aus den
primitivsten Web-
stühlen von
Frauen und Kin-
dern, häufig von
Nomaden in der
Winterszeit herge-
stellt. Das Ma-
terial, die Wolle,
liefern die ein-
Pasrnbechrr (Nr. s) heimischen Herden,
von Gabriel Hermeling, das Färben der-
kgi. Hofgoidschmied in Köln selben besorgen
die Männer. Diese Teppiche sind oft der
einzige Schatz der Nomaden und werden
nur verkauft, wenn besonders günstige Ver-
kaufsgelegenheiten sich finden.
Woher stammt nun der Knüpfteppich?
Wann kam er auf und welche ist seine eigent-
liche Bestimmung? Diese Fragen hat sich
Dr. Riegl gestellt und in äußerst geistreicher
Weise beantwortet. Der Knüpfteppich ist
dem Orientalen Stuhl und Bett. Wo der
Knüpfteppich herrscht, fehlen die Sitzmöbel.
Nun ist im ganzen Altertum kein Kultur-
volk bekannt, welches der Sitzmöbel ent-
behrte. Nur Nomadenvölker, im steten
Wandern begriffen, konnten auf die Idee
verfallen, den schweren, dicken Teppich als
Ersatz von Stuhl und Bett zu benützen.
„Der Begriff der Nomaden", fährt Riegl
fort (Österr. Monatsschrift für den Orient,
IB92, Nr. 1), „im ethnographischen Sinne
ist ein sehr manigfaltiger; diejenigen No-
maden aber, die in unserm Falle die ent-
scheidende Rolle ge-
spielt haben moch-
ten, können nur die
transoxanischen u.
zentralasiatischen
Stämme turko-
tartarischer Ab-
kunft gewesen sein.
Das turko-tartari-
! sche Zentralasien
ist das unerschöpf-
liche Reservoir ge-
wesen, aus welchem
schon im Altertum,
> besonders aber
während des Mit-
^ telalters die west-
^ asiatischen Länder
immer von neuem
! überflutet wurden.
Die Parther waren,
soviel wir wissen,
der erste nomadische
(viellleicht arische)
Bolksteil, der, über
den Oxus vordringend, das alte Medien, Per-
sien und Mesopotamien erobert hat. Bekannt
ist, welche zersetzende Rolle die tnrko-tartari-
schen Söldlinge am Hofe der spätem Abassiden
gespielt haben, und nun folgt eine Dynastie
zentralasiatischer Abkunft der andern. Die
Mameluken erobern Ägypten, die Osmanen
das byzantinische Reich. Dschingiskan trägt
die Schrecken der mongolischen Wanderlust
bis Europa, Timurlenk überschwemmt ganz
Westasien mit seinen Scharen. Noch heute
sind die meisten auf persischen Reichsboden
angesiedelten Nomaden turko-tartarischer
Abkunft.
Es unterliegt also gar keinem Zweifel,
^ daß die Völker Westasiens im Laufe des
Mittelalters dermassen von den über diese
Länder hinweggegangenen Fluten zentral-
asiatischen Volkstums durchsetzt worden sind,
daß sie sich vielfach auch die Sitten und Ge-
j bräuche dieser letztem angeeignet haben, wobei
von Vtto Schulze (Röln)
paienbrchrr (Nr. 0
^7>ie Abbildungen führen uns eine Reihe von
Patenbechern vor, die im Allerhöchsten
Auftrag Sr. Majestät des deutschen Kaisers
vom Hof-Gold-
schmied Gabriel
Hermeling in Köln
entworfen und aus-
gesührt sind. Es
ist eine alle schöne
Sitte, seinem Pat-
chen die Ueber-
nahme der Paten-
stelle durch ein Ge-
schenk zu besiegeln.
— Die Becher sind
sämtlich in Silber
getrieben, ziseliert
und vergoldet und
zeigen wohl fast
durchweg ein mei-
sterhaftes Können,
dessen Feuerprobe
besonders in den
zarten Reliefpor-
traits des Gejchenk-
gebers, in trefflich
charakteristischer
Treue getrieben,
sich kundgiebt. Die
Stücke schließen sich
den besten alten Arbeiten an und verraten
eine Stilgewandtheil, die nur in meister-
haft geleiteter Werkstatt eine Heimstätte
haben kann. Becher l zeigt die üppigen
Formen der prunkenden Spätgotik um 1500;
Nr. 2 dürste der Zeit um 1520—30 an-
gehören: Gotik und Renaissance reichen
sich die Hand, unterstützt von arabesken-
artigem Ornament; Nr. 3 verrät die Blüte-
zeit der Renaissance bei Nürnberger Gold-
schmieden mit Ornamentspielen eines Peter
Flötner; Nr. 4 zeigt die reichen Ornament-
sormen einer modern-deutschen Renaissance;
dir. 5 ist im behäbig vornehmen Barockstil
eines Jean Berain
gehalten, während
Nr. 6 ein echtes
Kind der sprudeln-
den Laune des
Rokoko-Stils um
1730 ist und eine
ganz besonders
glückliche Geburt
gehabt hat. — In
manchen Herzen
dürste wohl beim
Ansehen der präch-
tigen Stücke ein
Wunsch reifen?!
ich verstehe dies
wohl.
Pakenbrchrr (Nr. 5)
von Gabriel Hermeling
kgl. Hofgoldschmied in Aöln
Die orientalischen Teppiche
m vergangenen Jahre hatte das öftere.
Handelsmuseum eine Ausstellung von
orientalischen Teppichen veranstaltet und da-
mit den Anstoß gegeben, daß diesem Zweige
des Knnstgewerbes von allen Seiten erhöhte
Aufmerksamkeit zu teil ward. Namentlich
nahm die Geschichtswissenschaft auf diesem
Gebiete einen neuen Anlauf und Gelehrte
wie Lcssing und Bode in Berlin, vor allen
aber Riegl in Wien suchten das Dunkel
zu lüsten, welches über der Geschichte orien-
talischer Teppiche seit Jahrhunderten liegt.
Die orientalischen Teppiche teilen sich in
vier Klassen: in geknüpfte, gewirkte, ge-
webte und gefilzte. Uns beschäftigen hier
nur die zwei elfteren Arten und zwar fangen
wir mit den gewirkten an. Der eigentliche
Ausdruck hiefür ist Kilim. Das Wort be-
zeichnet aber kaum die Technik, den die ge-
wirkten Teppiche oder Behänge in der Bu-
kowina heißen Laicer. Ob das Wort spe-
zifisch asiatisch ist, ist auch zweifelhaft, denn
schon die Römer der Kaiserzeit kannten
Teppiche, die sie Cilicia oder Kilikia nannten.
Eigentümlich allen den gewirkten Tep-
pichen ist, daß sie nicht gewebt, sondern mit
einer Nadel mehr geflochten, also in der-
selben Art hcrgestellt werden, in der die
jüngst in Egypten gefundenen Stoffe aus
der römischen Kaiserzeit, in der die später
sogenannten sarazenischen Tapisserien und
die bekannten Gobelins gefertigt wurden.
Diese Technik kann man bis ins heroische
Zeitalter Griechenlands zurückverfolgen.
Gebraucht werden diese gewirkten Tep-
piche, diese Kilim, zu Ueberzügen, Decken
und Behängen; der ruthcnische Bauer be-
deckt damit sein Bett, in der Bukowina
dienen sie als Behänge und Rücklaken,
anderswo als Decken für Divane, Möbel
und zu Vorhängen. Einen derartigen Tep-
pich als Boden- und Fußteppich zu ge-
brauchen, ist barbarisch und verrät barba-
rische Gesinnung.
Ganz anders
stellt sich die zweite
Art der orienta-
lischen Teppiche,
die der Knüpf-
teppiche dar. Sie
werden in der ein-
fachsten Weise von
der Welt aus den
primitivsten Web-
stühlen von
Frauen und Kin-
dern, häufig von
Nomaden in der
Winterszeit herge-
stellt. Das Ma-
terial, die Wolle,
liefern die ein-
Pasrnbechrr (Nr. s) heimischen Herden,
von Gabriel Hermeling, das Färben der-
kgi. Hofgoidschmied in Köln selben besorgen
die Männer. Diese Teppiche sind oft der
einzige Schatz der Nomaden und werden
nur verkauft, wenn besonders günstige Ver-
kaufsgelegenheiten sich finden.
Woher stammt nun der Knüpfteppich?
Wann kam er auf und welche ist seine eigent-
liche Bestimmung? Diese Fragen hat sich
Dr. Riegl gestellt und in äußerst geistreicher
Weise beantwortet. Der Knüpfteppich ist
dem Orientalen Stuhl und Bett. Wo der
Knüpfteppich herrscht, fehlen die Sitzmöbel.
Nun ist im ganzen Altertum kein Kultur-
volk bekannt, welches der Sitzmöbel ent-
behrte. Nur Nomadenvölker, im steten
Wandern begriffen, konnten auf die Idee
verfallen, den schweren, dicken Teppich als
Ersatz von Stuhl und Bett zu benützen.
„Der Begriff der Nomaden", fährt Riegl
fort (Österr. Monatsschrift für den Orient,
IB92, Nr. 1), „im ethnographischen Sinne
ist ein sehr manigfaltiger; diejenigen No-
maden aber, die in unserm Falle die ent-
scheidende Rolle ge-
spielt haben moch-
ten, können nur die
transoxanischen u.
zentralasiatischen
Stämme turko-
tartarischer Ab-
kunft gewesen sein.
Das turko-tartari-
! sche Zentralasien
ist das unerschöpf-
liche Reservoir ge-
wesen, aus welchem
schon im Altertum,
> besonders aber
während des Mit-
^ telalters die west-
^ asiatischen Länder
immer von neuem
! überflutet wurden.
Die Parther waren,
soviel wir wissen,
der erste nomadische
(viellleicht arische)
Bolksteil, der, über
den Oxus vordringend, das alte Medien, Per-
sien und Mesopotamien erobert hat. Bekannt
ist, welche zersetzende Rolle die tnrko-tartari-
schen Söldlinge am Hofe der spätem Abassiden
gespielt haben, und nun folgt eine Dynastie
zentralasiatischer Abkunft der andern. Die
Mameluken erobern Ägypten, die Osmanen
das byzantinische Reich. Dschingiskan trägt
die Schrecken der mongolischen Wanderlust
bis Europa, Timurlenk überschwemmt ganz
Westasien mit seinen Scharen. Noch heute
sind die meisten auf persischen Reichsboden
angesiedelten Nomaden turko-tartarischer
Abkunft.
Es unterliegt also gar keinem Zweifel,
^ daß die Völker Westasiens im Laufe des
Mittelalters dermassen von den über diese
Länder hinweggegangenen Fluten zentral-
asiatischen Volkstums durchsetzt worden sind,
daß sie sich vielfach auch die Sitten und Ge-
j bräuche dieser letztem angeeignet haben, wobei