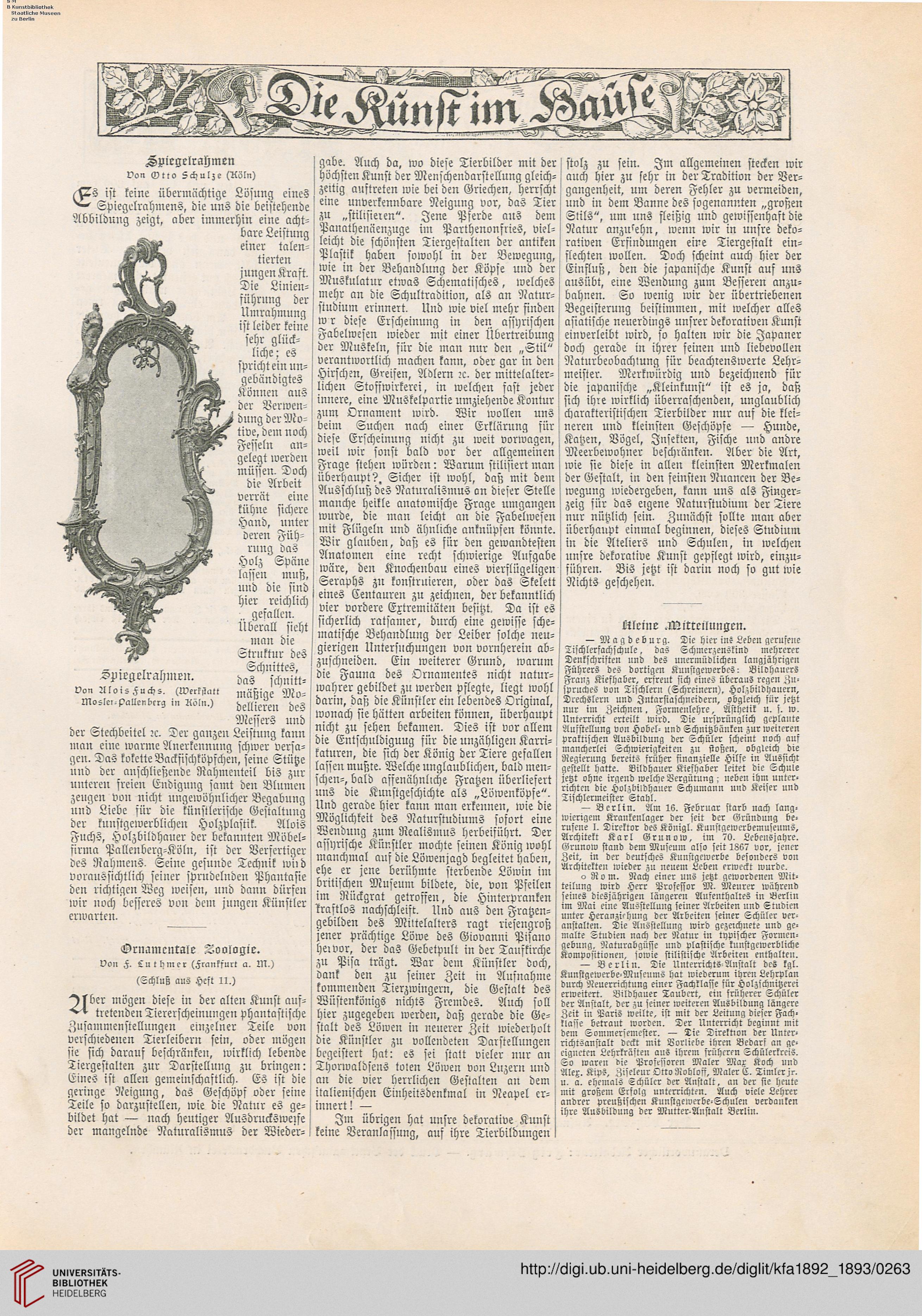Sxicgrlrstzmen
von Otto Schulze (Köln)
ist keine übermächtige Lösung eines
^ Spiegelrahmens, die uns die beistehende
Abbildung zeigt, aber immerhin eine acht-
bare Leistung
einer talen-
tierten
jungen Kraft.
Die Linien-
führung der
Umrahmung
ist leider keine
sehr glück-
liche; es
spricht ein un-
gebändigtes
Können aus
der Verwen-
dung der Mo-
tive, dem noch
Fesseln an-
gelegt werden
müssen. Doch
die Arbeit
verrät eine
kühne sichere
Hand, unter
deren Füh-
rung das
Holz Späne
lassen muß,
und die sind
hier reichlich
gefallen.
Überall sieht
man die
Struktur des
Schnittes,
das schnitt-
mäßige Mo-
dellieren des
Messers und
der Stechbeitel :c. Der ganzen Leistung kann
man eine warme Anerkennung schwer versa-
gen. Das kokette Backfischköpfche», seine Stütze
und der anschließende Rahmcnteil bis zur
unteren freien Endigung samt den Blumen
zeugen von nicht ungewöhnlicher Begabung
und Liebe für die künstlerische Gestaltung
der kunstgelverblichen Holzplastik. Alois
Fuchs, Holzbildhauer der bekannten Möbel-
firma Pallenberg-Köln, ist der Verfertiger
des Rahmens. Seine gesunde Technik wii d
voraussichtlich seiner sprudelnden Phantasie
den richtigen Weg weisen, und dann dürfen
wir noch besseres von dem jungen Künstler
erwarten.
Apiegelruhmeii.
von Alois Fuchs. (Werkstatt
Mosler-ssallenbcrg in Aöln.)
Gruamenlsle Zoologie.
von F. Lut km er (Frankfurt a. 1U.)
(Schluß aus Heft 11.)
lber mögen diese in der alten Kunst auf-
^ tretenden Tiererscheinungen phantastische
Zusammenstellungen einzelner Teile von
verschiedenen Tierleibern sein, oder mögen
sie sich darauf beschränken, wirklich lebende
Tiergestalten zur Darstellung zu bringen:
Eines ist allen gemeinschastlich. Es ist die
geringe Neigung, das Geschöpf oder seine
Teile so darzustellen, wie die Natur es ge-
bildet hat — nach heutiger Ausdrucksweife
der mangelnde Naturalismus der Wieder-
gabe. Auch da, wo diese Tierbilder mit der
höchsten Kunst der Menschendarstellung gleich-
zeitig austreten wie bei den Griechen, herrscht
eine unverkennbare Neigung vor, das Tier
zu „stilisieren". Jene Pferde aus dem
Panathenäenzuge im Parthenonfries, viel-
leicht die schönsten Tiergestalten der antiken
Plastik haben sowohl in der Bewegung,
wie in der Behandlung der Köpfe und der
Muskulatur etwas Schematisches, welches
mehr an die Schultradition, als an Natur-
studium erinnert. Und wie viel mehr finden
w r diese Erscheinung in den assyrischen
Fabelwesen wieder mit einer Übertreibung
der Muskeln, für die man nur den „Stil"
verantwortlich machen kann, oder gar in den
Hirschen, Greifen, Adlern re. der mittelalter-
lichen Stoffwirkerci, in welchen fast jeder
innere, eine Muskelpartie umziehende Kontur
zum Ornament wird. Wir wollen uns
beim Suchen nach einer Erklärung für
diese Erscheinung nicht zu weit vorwagen,
weil wir sonst bald vor der allgemeinen
Frage stehen würden: Warum stilisiert man
überhaupt?. Sicher ist wohl, daß mit dem
Ausschluß des Naturalismus an dieser Stelle
manche heikle anatomische Frage umgangen
wurde, die man leicht an die Fabelwesen
mit Flügeln und ähnliche anknüpfen könnte.
Wir glauben, daß es für den gewandtesten
Anatomen eine recht schwierige Aufgabe
wäre, den Knochenbau eines Vierflügeligen
Seraphs zu konstruieren, oder das Skelett
eines Centauren zu zeichnen, der bekanntlich
vier vordere Extremitäten besitzt. Da ist es
sicherlich ratsamer, durch eine gewisse sche-
matische Behandlung der Leiber solche neu-
gierigen Untersuchungen von vornherein ab-
zuschneiden. Ein weiterer Grund, warum
die Fauna des Ornamentes nicht natur-
wahrer gebildet zu werden Pflegte, liegt wohl
darin, daß die Künstler ein lebendes Original,
wonach sie hätten arbeiten können, überhaupt
nicht zu sehen bekamen. Dies ist vor allem
die Entschuldigung für die unzähligen Karri-
katuren, die sich der König der Tiere gefallen
lassen mußte. Welche unglaublichen, bald Men-
schen-, bald affenähnliche Fratzen überliefert
uns die Kunstgeschichte als „Löwenköpfe".
Und gerade hier kann man erkennen, wie die
Möglichkeit des Naturstudiums sofort eine
Wendung zum Realismus herbeiführt. Der
assyrische Künstler mochte seinen König wohl
manchmal auf die Löwenjagd begleitet haben,
ehe er jene berühmte sterbende Löwin im
britischen Museum bildete, die, von Pfeilen
im Rückgrat getroffen, die Hinterpranken
kraftlos nachschleift, lind aus den Fratzen-
gebilden des Mittelalters ragt riesengroß
jener prächtige Löwe des Giovanni Pisano
heivor, der das Gebetpult in der Taufkirche
zu Pisa trägt. War dem Künstler doch,
dank den zu seiner Zeit in Ausnahme
kommenden Tierzwingern, die Gestalt des
Wüstenkönigs nichts Fremdes. Auch soll
hier zugegeben werden, daß gerade die Ge-
stalt des Löwen in neuerer Zeit wiederholt
die Künstler zu vollendeten Darstellungen
begeistert hat: es sei statt vieler nur an
Thorwaldsens toten Löwen von Luzern und
an die vier herrlichen Gestalten an dem
italienischen Einheilsdenkmal in Neapel er-
innert! —
Im übrige» hat unsre dekorative Kunst
keine Veranlassung, auf ihre Tierbildungen
! stolz zu sein. Im allgemeinen stecken wir
auch hier zu sehr in der Tradition der Ver-
gangenheit, um deren Fehler zu vermeiden,
und in dem Banne des sogenannten „großen
Stils", um uns fleißig und gewissenhaft die
Natur anzillehn, wenn wir in unsre deko-
rativen Erfindungen eine Tiergestalt ein-
flechten wollen. Doch scheint auch hier der
Einfluß, den die japanische Kunst aus uns
ausübt, eine Wendung zum Besseren anzu-
bahnen. So wenig wir der übertriebenen
Begeisterung beistimmen, mit welcher alles
asiatische neuerdings unsrer dekorativen Kunst
einverleibt wird, so halten wir die Japaner
doch gerade in ihrer feinen und liebevollen
Naturbeobachtung für beachtenswerte Lehr-
meister. Merkwürdig und bezeichnend für
die japanische „Kleinkunst" ist es ja, daß
sich ihre wirklich überraschenden, unglaublich
charakteristischen Tierbilder nur auf die klei-
neren und kleinsten Geschöpfe — Hunde,
Katzen, Vögel, Insekten, Fische und andre
Meerbewohner beschränken. Aber die Art,
wie sie diese in allen kleinsten Merkmalen
der Gestalt, in den feinsten Nuancen der Be-
wegung miedergeben, kann uns als Finger-
zeig für das eigene Naturstudium der Tiere
nur nützlich sein. Zunächst sollte man aber
überhaupt einmal beginnen, dieses Studium
in die Ateliers und Schulen, in welchen
unsre dekorative Kunst gepflegt wird, einzu-
führen. Bis jetzt ist darin noch so gut wie
Nichts geschehen.
Kleine.Miirciluiigen.
— Magdeburg. Die hier ins Leben gerufene
Tischlerfachschule, das Schmerzenskind mehrerer
Denkschriften und des unermüdlichen langjährigen
Führers des dortigen Kunstgewerbes: Bildhauers
Franz Kiefhaber, erfreut sich eines überaus regen Zu-
spruches von Tischlern (Schreinern), Holzbildhauern,
Drechslern und Jntarsiaschneidern, obgleich für jetzt
nur im Zeichnen. Formenlehre, Ästhetik u. s. w.
Unterricht erteilt wird. Die ursvrünglich geplante
Aufstellung von Hobel- und Schnitzbänken zur weiteren
praktischen Ausbildung der Schüler scheint noch auf
mancherlei Schwierigkeiten zu stoßen, obgleich die
Regierung bereits früher finanzielle Hilfe in Aussicht
gestellt hatte. Bildhauer Kiefhaber leitet die Schule
jetzt ohne irgend welche Vergütung ; neben ihm unter-
richten die Holzbildhauer Schumann und Keifer und
Tischlermeister Stahl.
— Berlin. Am 16. Februar starb nach lang-
wierigem Krankenlager der seit der Gründung be-
rufene I. Direktor des Königl. Kunstgewerbemuseums,
Architekt Karl Grunow, im 70. Lebensjahre.
Grunow stand dem Museum also seit 1867 vor, jener
Zeit, in der deutsches Kunstgewerbe besonders von
Architekten wieder zu neuem Leben erweckt wurde.
o Rom. Nach einer uns jetzt gewordenen Mit-
teilung wird Herr Professor M. Meurer während
seines diesjährigen längeren Aufenthaltes in Berlin
im Mai eine Ausstellung seiner Arbeiten und Studien
unter Heranziehung der Arbeiten seiner Schüler ver-
anstalten. Die Ausstellung wird gezeichnete und ge-
malte Studien nach der Natur in typischer Formen-
gebung, Naturabgüsse und plastische kunstgewerbliche
Kompositionen, sowie stilistische Arbeiten enthalten.
— Berlin. Die Unterrichts-Anstalt des kgl.
Kunstgewerbe-Museums hat wiederum ihren Lehrplan
durch'Neuerrichtung einer Fachklasse für Holzschnitzerei
erweitert. Bildhauer Taubert, ein früherer Schüler
der Anstalt, der zu seiner weiteren Ausbildung längere
Zeit in Paris weilte, ist mit der Leitung dieser Fach-
klaye betraut worden. Ter Unterricht beginnt mit
dem Sommersemester. — Tie Direktton der Unter-
richtsanstalt deckt mit Vorliebe ihren Bedarf an ge-
eigneten Lehrkräften aus ihrem früheren Schülerkrcis.
So waren die Professoren Maler Max Koch und
Alex. Kips, Ziseleur Otto Nohloff, Maler C. Timlerjr.
u. a. ehemals Schüler der Anstalt, an der sie heute
mit großem Erfolg unterrichten. Auch viele Lehrer
andrer preußischen Kunstgewerbe-Schulen verdanken
ihre Ausbildung der Mutter-Anstalt Berlin.
von Otto Schulze (Köln)
ist keine übermächtige Lösung eines
^ Spiegelrahmens, die uns die beistehende
Abbildung zeigt, aber immerhin eine acht-
bare Leistung
einer talen-
tierten
jungen Kraft.
Die Linien-
führung der
Umrahmung
ist leider keine
sehr glück-
liche; es
spricht ein un-
gebändigtes
Können aus
der Verwen-
dung der Mo-
tive, dem noch
Fesseln an-
gelegt werden
müssen. Doch
die Arbeit
verrät eine
kühne sichere
Hand, unter
deren Füh-
rung das
Holz Späne
lassen muß,
und die sind
hier reichlich
gefallen.
Überall sieht
man die
Struktur des
Schnittes,
das schnitt-
mäßige Mo-
dellieren des
Messers und
der Stechbeitel :c. Der ganzen Leistung kann
man eine warme Anerkennung schwer versa-
gen. Das kokette Backfischköpfche», seine Stütze
und der anschließende Rahmcnteil bis zur
unteren freien Endigung samt den Blumen
zeugen von nicht ungewöhnlicher Begabung
und Liebe für die künstlerische Gestaltung
der kunstgelverblichen Holzplastik. Alois
Fuchs, Holzbildhauer der bekannten Möbel-
firma Pallenberg-Köln, ist der Verfertiger
des Rahmens. Seine gesunde Technik wii d
voraussichtlich seiner sprudelnden Phantasie
den richtigen Weg weisen, und dann dürfen
wir noch besseres von dem jungen Künstler
erwarten.
Apiegelruhmeii.
von Alois Fuchs. (Werkstatt
Mosler-ssallenbcrg in Aöln.)
Gruamenlsle Zoologie.
von F. Lut km er (Frankfurt a. 1U.)
(Schluß aus Heft 11.)
lber mögen diese in der alten Kunst auf-
^ tretenden Tiererscheinungen phantastische
Zusammenstellungen einzelner Teile von
verschiedenen Tierleibern sein, oder mögen
sie sich darauf beschränken, wirklich lebende
Tiergestalten zur Darstellung zu bringen:
Eines ist allen gemeinschastlich. Es ist die
geringe Neigung, das Geschöpf oder seine
Teile so darzustellen, wie die Natur es ge-
bildet hat — nach heutiger Ausdrucksweife
der mangelnde Naturalismus der Wieder-
gabe. Auch da, wo diese Tierbilder mit der
höchsten Kunst der Menschendarstellung gleich-
zeitig austreten wie bei den Griechen, herrscht
eine unverkennbare Neigung vor, das Tier
zu „stilisieren". Jene Pferde aus dem
Panathenäenzuge im Parthenonfries, viel-
leicht die schönsten Tiergestalten der antiken
Plastik haben sowohl in der Bewegung,
wie in der Behandlung der Köpfe und der
Muskulatur etwas Schematisches, welches
mehr an die Schultradition, als an Natur-
studium erinnert. Und wie viel mehr finden
w r diese Erscheinung in den assyrischen
Fabelwesen wieder mit einer Übertreibung
der Muskeln, für die man nur den „Stil"
verantwortlich machen kann, oder gar in den
Hirschen, Greifen, Adlern re. der mittelalter-
lichen Stoffwirkerci, in welchen fast jeder
innere, eine Muskelpartie umziehende Kontur
zum Ornament wird. Wir wollen uns
beim Suchen nach einer Erklärung für
diese Erscheinung nicht zu weit vorwagen,
weil wir sonst bald vor der allgemeinen
Frage stehen würden: Warum stilisiert man
überhaupt?. Sicher ist wohl, daß mit dem
Ausschluß des Naturalismus an dieser Stelle
manche heikle anatomische Frage umgangen
wurde, die man leicht an die Fabelwesen
mit Flügeln und ähnliche anknüpfen könnte.
Wir glauben, daß es für den gewandtesten
Anatomen eine recht schwierige Aufgabe
wäre, den Knochenbau eines Vierflügeligen
Seraphs zu konstruieren, oder das Skelett
eines Centauren zu zeichnen, der bekanntlich
vier vordere Extremitäten besitzt. Da ist es
sicherlich ratsamer, durch eine gewisse sche-
matische Behandlung der Leiber solche neu-
gierigen Untersuchungen von vornherein ab-
zuschneiden. Ein weiterer Grund, warum
die Fauna des Ornamentes nicht natur-
wahrer gebildet zu werden Pflegte, liegt wohl
darin, daß die Künstler ein lebendes Original,
wonach sie hätten arbeiten können, überhaupt
nicht zu sehen bekamen. Dies ist vor allem
die Entschuldigung für die unzähligen Karri-
katuren, die sich der König der Tiere gefallen
lassen mußte. Welche unglaublichen, bald Men-
schen-, bald affenähnliche Fratzen überliefert
uns die Kunstgeschichte als „Löwenköpfe".
Und gerade hier kann man erkennen, wie die
Möglichkeit des Naturstudiums sofort eine
Wendung zum Realismus herbeiführt. Der
assyrische Künstler mochte seinen König wohl
manchmal auf die Löwenjagd begleitet haben,
ehe er jene berühmte sterbende Löwin im
britischen Museum bildete, die, von Pfeilen
im Rückgrat getroffen, die Hinterpranken
kraftlos nachschleift, lind aus den Fratzen-
gebilden des Mittelalters ragt riesengroß
jener prächtige Löwe des Giovanni Pisano
heivor, der das Gebetpult in der Taufkirche
zu Pisa trägt. War dem Künstler doch,
dank den zu seiner Zeit in Ausnahme
kommenden Tierzwingern, die Gestalt des
Wüstenkönigs nichts Fremdes. Auch soll
hier zugegeben werden, daß gerade die Ge-
stalt des Löwen in neuerer Zeit wiederholt
die Künstler zu vollendeten Darstellungen
begeistert hat: es sei statt vieler nur an
Thorwaldsens toten Löwen von Luzern und
an die vier herrlichen Gestalten an dem
italienischen Einheilsdenkmal in Neapel er-
innert! —
Im übrige» hat unsre dekorative Kunst
keine Veranlassung, auf ihre Tierbildungen
! stolz zu sein. Im allgemeinen stecken wir
auch hier zu sehr in der Tradition der Ver-
gangenheit, um deren Fehler zu vermeiden,
und in dem Banne des sogenannten „großen
Stils", um uns fleißig und gewissenhaft die
Natur anzillehn, wenn wir in unsre deko-
rativen Erfindungen eine Tiergestalt ein-
flechten wollen. Doch scheint auch hier der
Einfluß, den die japanische Kunst aus uns
ausübt, eine Wendung zum Besseren anzu-
bahnen. So wenig wir der übertriebenen
Begeisterung beistimmen, mit welcher alles
asiatische neuerdings unsrer dekorativen Kunst
einverleibt wird, so halten wir die Japaner
doch gerade in ihrer feinen und liebevollen
Naturbeobachtung für beachtenswerte Lehr-
meister. Merkwürdig und bezeichnend für
die japanische „Kleinkunst" ist es ja, daß
sich ihre wirklich überraschenden, unglaublich
charakteristischen Tierbilder nur auf die klei-
neren und kleinsten Geschöpfe — Hunde,
Katzen, Vögel, Insekten, Fische und andre
Meerbewohner beschränken. Aber die Art,
wie sie diese in allen kleinsten Merkmalen
der Gestalt, in den feinsten Nuancen der Be-
wegung miedergeben, kann uns als Finger-
zeig für das eigene Naturstudium der Tiere
nur nützlich sein. Zunächst sollte man aber
überhaupt einmal beginnen, dieses Studium
in die Ateliers und Schulen, in welchen
unsre dekorative Kunst gepflegt wird, einzu-
führen. Bis jetzt ist darin noch so gut wie
Nichts geschehen.
Kleine.Miirciluiigen.
— Magdeburg. Die hier ins Leben gerufene
Tischlerfachschule, das Schmerzenskind mehrerer
Denkschriften und des unermüdlichen langjährigen
Führers des dortigen Kunstgewerbes: Bildhauers
Franz Kiefhaber, erfreut sich eines überaus regen Zu-
spruches von Tischlern (Schreinern), Holzbildhauern,
Drechslern und Jntarsiaschneidern, obgleich für jetzt
nur im Zeichnen. Formenlehre, Ästhetik u. s. w.
Unterricht erteilt wird. Die ursvrünglich geplante
Aufstellung von Hobel- und Schnitzbänken zur weiteren
praktischen Ausbildung der Schüler scheint noch auf
mancherlei Schwierigkeiten zu stoßen, obgleich die
Regierung bereits früher finanzielle Hilfe in Aussicht
gestellt hatte. Bildhauer Kiefhaber leitet die Schule
jetzt ohne irgend welche Vergütung ; neben ihm unter-
richten die Holzbildhauer Schumann und Keifer und
Tischlermeister Stahl.
— Berlin. Am 16. Februar starb nach lang-
wierigem Krankenlager der seit der Gründung be-
rufene I. Direktor des Königl. Kunstgewerbemuseums,
Architekt Karl Grunow, im 70. Lebensjahre.
Grunow stand dem Museum also seit 1867 vor, jener
Zeit, in der deutsches Kunstgewerbe besonders von
Architekten wieder zu neuem Leben erweckt wurde.
o Rom. Nach einer uns jetzt gewordenen Mit-
teilung wird Herr Professor M. Meurer während
seines diesjährigen längeren Aufenthaltes in Berlin
im Mai eine Ausstellung seiner Arbeiten und Studien
unter Heranziehung der Arbeiten seiner Schüler ver-
anstalten. Die Ausstellung wird gezeichnete und ge-
malte Studien nach der Natur in typischer Formen-
gebung, Naturabgüsse und plastische kunstgewerbliche
Kompositionen, sowie stilistische Arbeiten enthalten.
— Berlin. Die Unterrichts-Anstalt des kgl.
Kunstgewerbe-Museums hat wiederum ihren Lehrplan
durch'Neuerrichtung einer Fachklasse für Holzschnitzerei
erweitert. Bildhauer Taubert, ein früherer Schüler
der Anstalt, der zu seiner weiteren Ausbildung längere
Zeit in Paris weilte, ist mit der Leitung dieser Fach-
klaye betraut worden. Ter Unterricht beginnt mit
dem Sommersemester. — Tie Direktton der Unter-
richtsanstalt deckt mit Vorliebe ihren Bedarf an ge-
eigneten Lehrkräften aus ihrem früheren Schülerkrcis.
So waren die Professoren Maler Max Koch und
Alex. Kips, Ziseleur Otto Nohloff, Maler C. Timlerjr.
u. a. ehemals Schüler der Anstalt, an der sie heute
mit großem Erfolg unterrichten. Auch viele Lehrer
andrer preußischen Kunstgewerbe-Schulen verdanken
ihre Ausbildung der Mutter-Anstalt Berlin.