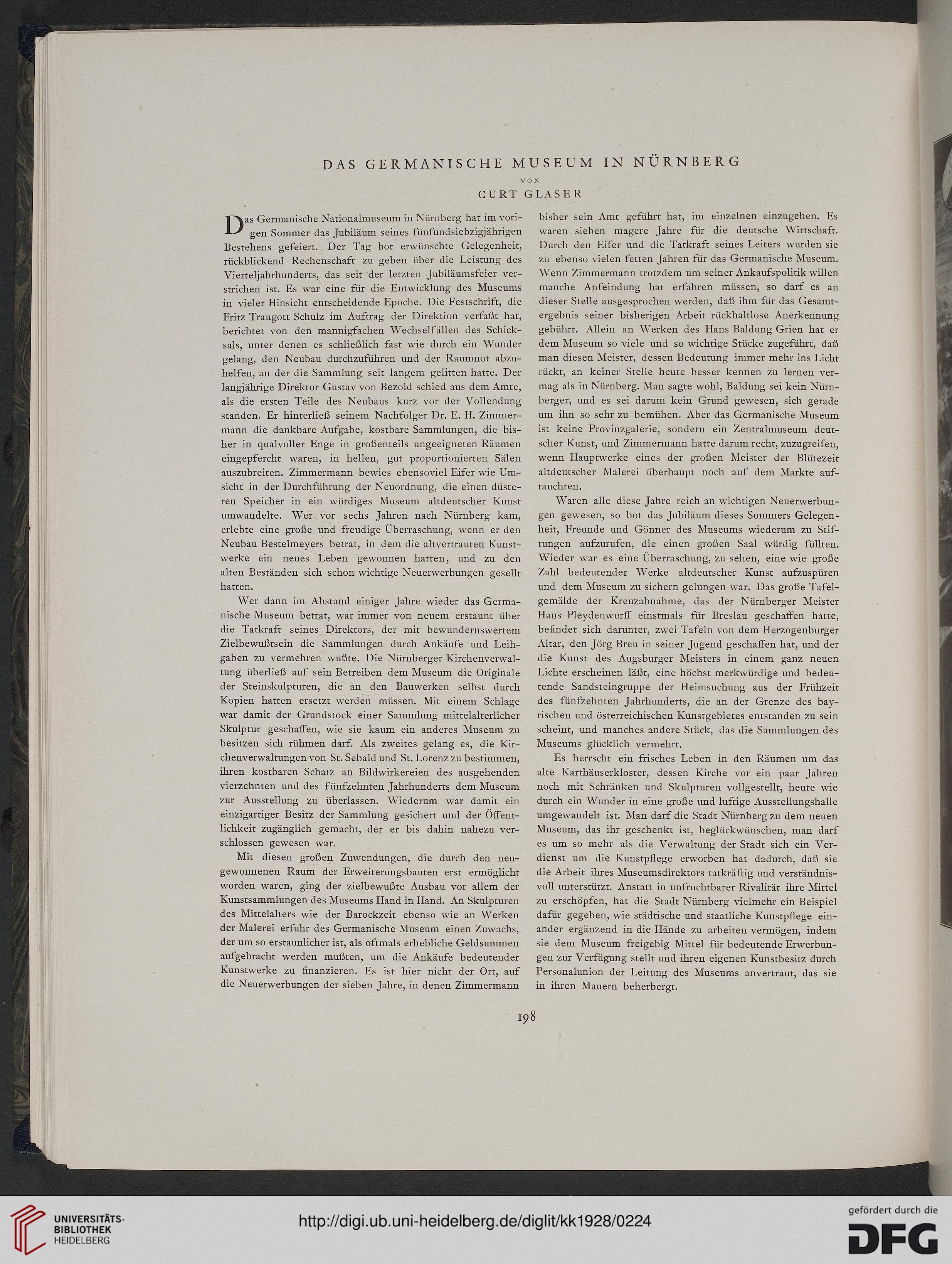DAS GERMANISCHE MUSEUM IN NÜRNBERG
VON
CURT GLASER
Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg hat im vori-
gen Sommer das Jubiläum seines fünfundsiebzigjährigen
Bestehens gefeiert. Der Tag bot erwünschte Gelegenheit,
rückblickend Rechenschaft zu geben über die Leistung des
Vierteljahrhunderts, das seit der letzten Jubiläumsfeier ver-
strichen ist. Es war eine für die Entwicklung des Museums
in vieler Hinsicht entscheidende Epoche. Die Festschrift, die
Fritz Traugott Schulz im Auftrag der Direktion verfaßt hat,
berichtet von den mannigfachen Wechselfällen des Schick-
sals, unter denen es schließlich fast wie durch ein Wunder
gelang, den Neubau durchzuführen und der Raumnot abzu-
helfen, an der die Sammlung seit langem gelitten hatte. Der
langjährige Direktor Gustav von Bezold schied aus dem Amte,
als die ersten Teile des Neubaus kurz vor der Vollendung
standen. Er hinterließ seinem Nachfolger Dr. E. H. Zimmer-
mann die dankbare Aufgabe, kostbare Sammlungen, die bis-
her in qualvoller Enge in großenteils ungeeigneten Räumen
eingepfercht waren, in hellen, gut proportionierten Sälen
auszubreiten. Zimmermann bewies ebensoviel Eifer wie Um-
sicht in der Durchführung der Neuordnung, die einen düste-
ren Speicher in ein würdiges Museum altdeutscher Kunst
umwandelte. Wer vor sechs Jahren nach Nürnberg kam,
erlebte eine große und freudige Überraschung, wenn er den
Neubau Bestelmeyers betrat, in dem die altvertrauten Kunst-
werke ein neues Leben gewonnen hatten, und zu den
alten Beständen sich schon wichtige Neuerwerbungen gesellt
hatten.
Wer dann im Abstand einiger Jahre wieder das Germa-
nische Museum betrat, war immer von neuem erstaunt über
die Tatkraft seines Direktors, der mit bewundernswertem
Zielbewußtsein die Sammlungen durch Ankäufe und Leih-
gaben zu vermehren wußte. Die Nürnberger Kirchenverwal-
tung überließ auf sein Betreiben dem Museum die Originale
der Steinskulpturen, die an den Bauwerken selbst durch
Kopien hatten ersetzt werden müssen. Mit einem Schlage
war damit der Grundstock einer Sammlung mittelalterlicher
Skulptur geschaffen, wie sie kaum ein anderes Museum zu
besitzen sich rühmen darf. Als zweites gelang es, die Kir-
chenverwaltungen von St. Sebald und St. Lorenz zu bestimmen,
ihren kostbaren Schatz an Bildwirkereien des ausgehenden
vierzehnten und des fünfzehnten Jahrhunderts dem Museum
zur Ausstellung zu überlassen. Wiederum war damit ein
einzigartiger Besitz der Sammlung gesichert und der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht, der er bis dahin nahezu ver-
schlossen gewesen war.
Mit diesen großen Zuwendungen, die durch den neu-
gewonnenen Raum der Erweiterungsbauten erst ermöglicht
worden waren, ging der zielbewußte Ausbau vor allem der
Kunstsammlungen des Museums Hand in Hand. An Skulpturen
des Mittelalters wie der Barockzeit ebenso wie an Werken
der Malerei erfuhr des Germanische Museum einen Zuwachs,
der um so erstaunlicher ist, als oftmals erhebliche Geldsummen
aufgebracht werden mußten, um die Ankäufe bedeutender
Kunstwerke zu finanzieren. Es ist hier nicht der Ort, auf
die Neuerwerbungen der sieben Jahre, in denen Zimmermann
bisher sein Amt geführt hat, im einzelnen einzugehen. Es
waren sieben magere Jahre für die deutsche Wirtschaft.
Durch den Eifer und die Tatkraft seines Leiters wurden sie
zu ebenso vielen fetten Jahren für das Germanische Museum.
Wenn Zimmermann trotzdem um seiner Ankaufspolitik willen
manche Anfeindung hat erfahren müssen, so darf es an
dieser Stelle ausgesprochen werden, daß ihm für das Gesamt-
ergebnis seiner bisherigen Arbeit rückhaltlose Anerkennung
gebührt. Allein an Werken des Hans Baidung Grien hat er
dem Museum so viele und so wichtige Stücke zugeführt, daß
man diesen Meister, dessen Bedeutung immer mehr ins Licht
rückt, an keiner Stelle heute besser kennen zu lernen ver-
mag als in Nürnberg. Man sagte wohl, Baidung sei kein Nürn-
berger, und es sei darum kein Grund gewesen, sich gerade
um ihn so sehr zu bemühen. Aber das Germanische Museum
ist keine Provinzgalerie, sondern ein Zentralmuseum deut-
scher Kunst, und Zimmermann hatte darum recht, zuzugreifen,
wenn Hauptwerke eines der großen Meister der Blütezeit
altdeutscher Malerei überhaupt noch auf dem Markte auf-
tauchten.
Waren alle diese Jahre reich an wichtigen Neuerwerbun-
gen gewesen, so bot das Jubiläum dieses Sommers Gelegen-
heit, Freunde und Gönner des Museums wiederum zu Stif-
tungen aufzurufen, die einen großen Saal würdig füllten.
Wieder war es eine Überraschung, zu sehen, eine wie große
Zahl bedeutender Werke altdeutscher Kunst aufzuspüren
und dem Museum zu sichern gelungen war. Das große Tafel-
gemälde der Kreuzabnahme, das der Nürnberger Meister
Hans Pleydenwurff einstmals für Breslau geschaffen hatte,
befindet sich darunter, Zwei Tafeln von dem Herzogenburger
Altar, den Jörg Breu in seiner Jugend geschaffen hat, und der
die Kunst des Augsburger Meisters in einem ganz neuen
Lichte erscheinen läßt, eine höchst merkwürdige und bedeu-
tende Sandsteingruppe der Heimsuchung aus der Frühzeit
des fünfzehnten Jahrhunderts, die an der Grenze des bay-
rischen und österreichischen Kunsrgebietes entstanden zu sein
scheint, und manches andere Stück, das die Sammlungen des
Museums glücklich vermehrt.
Es herrscht ein frisches Leben in den Räumen um das
alte Karthäuserkloster, dessen Kirche vor ein paar Jahren
noch mit Schränken und Skulpturen vollgestellt, heute wie
durch ein Wunder in eine große und luftige Ausstellungshalle
umgewandelt ist. Man darf die Stadt Nürnberg zu dem neuen
Museum, das ihr geschenkt ist, beglückwünschen, man darf
es um so mehr als die Verwaltung der Stadt sich ein Ver-
dienst um die Kunstpflege erworben hat dadurch, daß sie
die Arbeit ihres Museumsdirektors tatkräftig und verständnis-
voll unterstützt. Anstatt in unfruchtbarer Rivalität ihre Mittel
zu erschöpfen, hat die Stadt Nürnberg vielmehr ein Beispiel
dafür gegeben, wie städtische und staatliche Kunstpflege ein-
ander ergänzend in die Hände zu arbeiten vermögen, indem
sie dem Museum freigebig Mittel für bedeutende Erwerbun-
gen zur Verfügung stellt und ihren eigenen Kunstbesitz durch
Personalunion der Leitung des Museums anvertraut, das sie
in ihren Mauern beherbergt.
K>8
VON
CURT GLASER
Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg hat im vori-
gen Sommer das Jubiläum seines fünfundsiebzigjährigen
Bestehens gefeiert. Der Tag bot erwünschte Gelegenheit,
rückblickend Rechenschaft zu geben über die Leistung des
Vierteljahrhunderts, das seit der letzten Jubiläumsfeier ver-
strichen ist. Es war eine für die Entwicklung des Museums
in vieler Hinsicht entscheidende Epoche. Die Festschrift, die
Fritz Traugott Schulz im Auftrag der Direktion verfaßt hat,
berichtet von den mannigfachen Wechselfällen des Schick-
sals, unter denen es schließlich fast wie durch ein Wunder
gelang, den Neubau durchzuführen und der Raumnot abzu-
helfen, an der die Sammlung seit langem gelitten hatte. Der
langjährige Direktor Gustav von Bezold schied aus dem Amte,
als die ersten Teile des Neubaus kurz vor der Vollendung
standen. Er hinterließ seinem Nachfolger Dr. E. H. Zimmer-
mann die dankbare Aufgabe, kostbare Sammlungen, die bis-
her in qualvoller Enge in großenteils ungeeigneten Räumen
eingepfercht waren, in hellen, gut proportionierten Sälen
auszubreiten. Zimmermann bewies ebensoviel Eifer wie Um-
sicht in der Durchführung der Neuordnung, die einen düste-
ren Speicher in ein würdiges Museum altdeutscher Kunst
umwandelte. Wer vor sechs Jahren nach Nürnberg kam,
erlebte eine große und freudige Überraschung, wenn er den
Neubau Bestelmeyers betrat, in dem die altvertrauten Kunst-
werke ein neues Leben gewonnen hatten, und zu den
alten Beständen sich schon wichtige Neuerwerbungen gesellt
hatten.
Wer dann im Abstand einiger Jahre wieder das Germa-
nische Museum betrat, war immer von neuem erstaunt über
die Tatkraft seines Direktors, der mit bewundernswertem
Zielbewußtsein die Sammlungen durch Ankäufe und Leih-
gaben zu vermehren wußte. Die Nürnberger Kirchenverwal-
tung überließ auf sein Betreiben dem Museum die Originale
der Steinskulpturen, die an den Bauwerken selbst durch
Kopien hatten ersetzt werden müssen. Mit einem Schlage
war damit der Grundstock einer Sammlung mittelalterlicher
Skulptur geschaffen, wie sie kaum ein anderes Museum zu
besitzen sich rühmen darf. Als zweites gelang es, die Kir-
chenverwaltungen von St. Sebald und St. Lorenz zu bestimmen,
ihren kostbaren Schatz an Bildwirkereien des ausgehenden
vierzehnten und des fünfzehnten Jahrhunderts dem Museum
zur Ausstellung zu überlassen. Wiederum war damit ein
einzigartiger Besitz der Sammlung gesichert und der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht, der er bis dahin nahezu ver-
schlossen gewesen war.
Mit diesen großen Zuwendungen, die durch den neu-
gewonnenen Raum der Erweiterungsbauten erst ermöglicht
worden waren, ging der zielbewußte Ausbau vor allem der
Kunstsammlungen des Museums Hand in Hand. An Skulpturen
des Mittelalters wie der Barockzeit ebenso wie an Werken
der Malerei erfuhr des Germanische Museum einen Zuwachs,
der um so erstaunlicher ist, als oftmals erhebliche Geldsummen
aufgebracht werden mußten, um die Ankäufe bedeutender
Kunstwerke zu finanzieren. Es ist hier nicht der Ort, auf
die Neuerwerbungen der sieben Jahre, in denen Zimmermann
bisher sein Amt geführt hat, im einzelnen einzugehen. Es
waren sieben magere Jahre für die deutsche Wirtschaft.
Durch den Eifer und die Tatkraft seines Leiters wurden sie
zu ebenso vielen fetten Jahren für das Germanische Museum.
Wenn Zimmermann trotzdem um seiner Ankaufspolitik willen
manche Anfeindung hat erfahren müssen, so darf es an
dieser Stelle ausgesprochen werden, daß ihm für das Gesamt-
ergebnis seiner bisherigen Arbeit rückhaltlose Anerkennung
gebührt. Allein an Werken des Hans Baidung Grien hat er
dem Museum so viele und so wichtige Stücke zugeführt, daß
man diesen Meister, dessen Bedeutung immer mehr ins Licht
rückt, an keiner Stelle heute besser kennen zu lernen ver-
mag als in Nürnberg. Man sagte wohl, Baidung sei kein Nürn-
berger, und es sei darum kein Grund gewesen, sich gerade
um ihn so sehr zu bemühen. Aber das Germanische Museum
ist keine Provinzgalerie, sondern ein Zentralmuseum deut-
scher Kunst, und Zimmermann hatte darum recht, zuzugreifen,
wenn Hauptwerke eines der großen Meister der Blütezeit
altdeutscher Malerei überhaupt noch auf dem Markte auf-
tauchten.
Waren alle diese Jahre reich an wichtigen Neuerwerbun-
gen gewesen, so bot das Jubiläum dieses Sommers Gelegen-
heit, Freunde und Gönner des Museums wiederum zu Stif-
tungen aufzurufen, die einen großen Saal würdig füllten.
Wieder war es eine Überraschung, zu sehen, eine wie große
Zahl bedeutender Werke altdeutscher Kunst aufzuspüren
und dem Museum zu sichern gelungen war. Das große Tafel-
gemälde der Kreuzabnahme, das der Nürnberger Meister
Hans Pleydenwurff einstmals für Breslau geschaffen hatte,
befindet sich darunter, Zwei Tafeln von dem Herzogenburger
Altar, den Jörg Breu in seiner Jugend geschaffen hat, und der
die Kunst des Augsburger Meisters in einem ganz neuen
Lichte erscheinen läßt, eine höchst merkwürdige und bedeu-
tende Sandsteingruppe der Heimsuchung aus der Frühzeit
des fünfzehnten Jahrhunderts, die an der Grenze des bay-
rischen und österreichischen Kunsrgebietes entstanden zu sein
scheint, und manches andere Stück, das die Sammlungen des
Museums glücklich vermehrt.
Es herrscht ein frisches Leben in den Räumen um das
alte Karthäuserkloster, dessen Kirche vor ein paar Jahren
noch mit Schränken und Skulpturen vollgestellt, heute wie
durch ein Wunder in eine große und luftige Ausstellungshalle
umgewandelt ist. Man darf die Stadt Nürnberg zu dem neuen
Museum, das ihr geschenkt ist, beglückwünschen, man darf
es um so mehr als die Verwaltung der Stadt sich ein Ver-
dienst um die Kunstpflege erworben hat dadurch, daß sie
die Arbeit ihres Museumsdirektors tatkräftig und verständnis-
voll unterstützt. Anstatt in unfruchtbarer Rivalität ihre Mittel
zu erschöpfen, hat die Stadt Nürnberg vielmehr ein Beispiel
dafür gegeben, wie städtische und staatliche Kunstpflege ein-
ander ergänzend in die Hände zu arbeiten vermögen, indem
sie dem Museum freigebig Mittel für bedeutende Erwerbun-
gen zur Verfügung stellt und ihren eigenen Kunstbesitz durch
Personalunion der Leitung des Museums anvertraut, das sie
in ihren Mauern beherbergt.
K>8