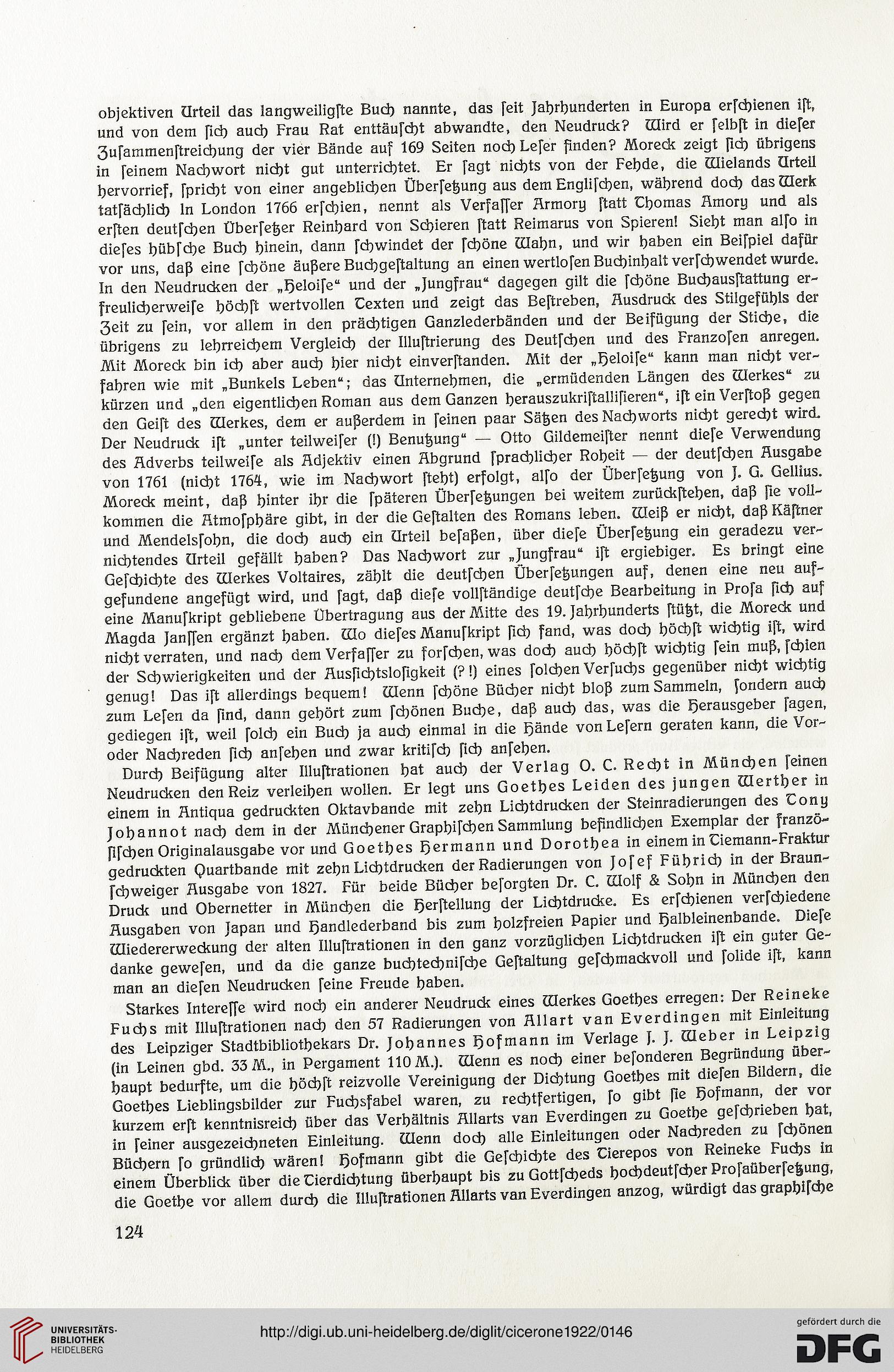objektiven Urteil das langweiligfte Buch nannte, das feit Jahrhunderten in Europa erfdjienen iß,
und von dem pd) auch Frau Rat enttäufd)t abwandte, den Neudrude? CUird er felbft in diefer
3ufammenftreid)ung der vier Bände auf 169 Seiten nod) Lefer finden? Moreck zeigt pd) übrigens
in feinem Nachwort nicht gut unterrichtet. Er fagt nichts von der Fehde, die CUielands Urteil
hervorrief, fpridjt von einer angeblichen Überfettung aus dem Englifchen, während doch das CUerk
tatfächlich ln London 1766 erfdüen, nennt als Verfaffer Ärmory ftatt ühomas Amory und als
erpen deutfehen Überfeiner Reinhard von Schieren ftatt Reimarus von Spieren! Sieht man alfo in
diefes hübfehe Buch hinein, dann fchwindet der fchöne (Hahn, und wir haben ein Beifpiel dafür
vor uns, daß eine fchöne äußere Buchgeftaltung an einen wertlofen Buchinhalt verfchwendet wurde.
In den Neudrucken der „Fjeloife“ und der „Jungfrau“ dagegen gilt die fchöne Buchausßattung er-
freulicherweife höchß wertvollen Cexten und zeigt das Beftreben, Ausdruck des Stilgefühls der
3eit zu fein, vor allem in den prächtigen Ganzlederbänden und der Beifügung der Stiche, die
übrigens zu lehrreichem Vergleich der Illußrierung des Deutfehen und des Franzofen anregen.
Mit Moreck bin ich aber auch hier nicht einverftanden. Mit der „Fjeloife“ kann man nicht ver-
fahren wie mit „Bunkels Leben“; das Unternehmen, die „ermüdenden Längen des CUerkes“ zu
kürzen und „den eigentlichen Roman aus dem Ganzen herauszukriftalüfieren“, ipeinVerßoß gegen
den Geift des CUerkes, dem er außerdem in feinen paar Sätzen des Nachworts nicht gerecht wird.
Der Neudrude ift „unter teilweifer (!) Benutzung“ — Otto Gildemeißer nennt diefe Verwendung
des Adverbs teilweife als Adjektiv einen Äbgrund fprachlicher Roheit — der deutfehen Äusgabe
von 1761 (nicht 1764, wie im Nachwort fteht) erfolgt, alfo der Überfettung von J. G. Gellius.
Moreck meint, daß hinter ihr die fpäteren Überfettungen bei weitem zurückßehen, daß pe voll-
kommen die Htmofphäre gibt, in der die Gepalten des Romans leben. CUeiß er nicht, daßKäßner
und Mendelsfopn, die doch auch ein Urteil befaßen, über diefe Überfettung ein geradezu ver-
nichtendes Urteil gefällt haben? Das Nachwort zur „Jungfrau“ ift ergiebiger. Es bringt eine
Gefcbichte des CUerkes Voltaires, zählt die deutfehen Überfettungen auf, denen eine neu auf-
gefundene angefügt wird, und fagt, daß diefe vollftändige deutfepe Bearbeitung in Profa pd) auf
eine Manufkript gebliebene Übertragung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ftü^t, die Moreck und
Magda Janßen ergänzt haben. Cüo diefes Manufkript pch fand, was dod) höchß wichtig iß, wird
nicht verraten, und nach dem Verfaffer zu forfchen, was doch aud) höd)ft wichtig fein muß, fchien
der Schwierigkeiten und der Auspd)tslopgkeit (?!) eines folchen Verfudjs gegenüber nicht wichtig
genug! Das ift allerdings bequem! CUenn fchöne Bücher nicht bloß zum Sammeln, fondern aud)
zum Lefen da pnd, dann gehört zum fchönen Buche, daß aud) das, was die Fjerausgeber fagen,
gediegen iß, weil fold) ein Buch ja auch einmal in die Fjände von Lefern geraten kann, die Vor-
oder Nachreden pd) anfehen und zwar kritifch fid) anfehen.
Durch Beifügung alter Illußrationen hat auch der Verlag 0. C. Recht in München feinen
Neudrucken den Reiz verleihen wollen. Er legt uns Goethes Leiden des jungen CUerther in
einem in Antiqua gedruckten Oktavbande mit zehn Lichtdrucken der Steinradierungen des üony
Johannot nad) dem in der Münchener GraphifchenSammlung beßndlichen Exemplar der franzö-
pfd)en Originalausgabe vor und Goethes Fjermann und Dorothea in einem in Ciemann-Fraktur
gedruckten Quartbande mit zehn Lichtdrucken der Radierungen von Jofef Führich in der Braun-
fchweiger Ausgabe von 1827. Für beide Bücher beforgten Dr. C. CUolf & Sohn in München den
Drude und Obernetter in München die Ijerßellung der Lichtdrucke. Es erfd)ienen verfchiedene
Ausgaben von Japan und Bandlederband bis zum holzfreien Papier und Fjalbleinenbande. Diefe
CUiedererweckung der alten Illußrationen in den ganz vorzüglichen Lichtdrucken iß ein guter Ge-
danke gewefen, und da die ganze bud)ted)nifd)e Geftaltung gefchmackvoll und folide iß, kann
man an diefen Neudrucken feine Freude haben.
Starkes Intereffe wird noch ein anderer Neudruck eines CUerkes Goethes erregen: Der Reineke
Fuchs mit Illußrationen nad) den 57 Radierungen von Allart van Everdingen mit Einleitung
des Leipziger Stadtbibliothekars Dr. Johannes Fjofmann jm Verlage J. J. CUeber in Leipzig
(in Leinen gbd. 33 M., in Pergament 110 M.). CUenn es noch einer befonderen Begründung über-
haupt bedurfte, um die höchß reizvolle Vereinigung der Dichtung Goethes mit diefen Bildern, die
Goethes Lieblingsbilder zur Fuchsfabel waren, zu rechtfertigen, fo gibt pe IJofmann, der vor
kurzem erft kenntnisreich über das Verhältnis Allarts van Everdingen zu Goethe gefeßrieben hat,
in feiner ausgezeichneten Einleitung. CUenn doch alle Einleitungen oder Nachreden zu fd)önen
Büchern fo gründlich wären! B°fmaan gibt die Gefd)id)te des Cierepos von Reineke Fuchs in
einem Überblick über die Cierdichtung überhaupt bis zu Gottfcheds hod)deutfd)er Profaüberfetjung,
die Goethe vor allem durch die Illußrationen Allarts van Everdingen anzog, würdigt das graphifdjß
124
und von dem pd) auch Frau Rat enttäufd)t abwandte, den Neudrude? CUird er felbft in diefer
3ufammenftreid)ung der vier Bände auf 169 Seiten nod) Lefer finden? Moreck zeigt pd) übrigens
in feinem Nachwort nicht gut unterrichtet. Er fagt nichts von der Fehde, die CUielands Urteil
hervorrief, fpridjt von einer angeblichen Überfettung aus dem Englifchen, während doch das CUerk
tatfächlich ln London 1766 erfdüen, nennt als Verfaffer Ärmory ftatt ühomas Amory und als
erpen deutfehen Überfeiner Reinhard von Schieren ftatt Reimarus von Spieren! Sieht man alfo in
diefes hübfehe Buch hinein, dann fchwindet der fchöne (Hahn, und wir haben ein Beifpiel dafür
vor uns, daß eine fchöne äußere Buchgeftaltung an einen wertlofen Buchinhalt verfchwendet wurde.
In den Neudrucken der „Fjeloife“ und der „Jungfrau“ dagegen gilt die fchöne Buchausßattung er-
freulicherweife höchß wertvollen Cexten und zeigt das Beftreben, Ausdruck des Stilgefühls der
3eit zu fein, vor allem in den prächtigen Ganzlederbänden und der Beifügung der Stiche, die
übrigens zu lehrreichem Vergleich der Illußrierung des Deutfehen und des Franzofen anregen.
Mit Moreck bin ich aber auch hier nicht einverftanden. Mit der „Fjeloife“ kann man nicht ver-
fahren wie mit „Bunkels Leben“; das Unternehmen, die „ermüdenden Längen des CUerkes“ zu
kürzen und „den eigentlichen Roman aus dem Ganzen herauszukriftalüfieren“, ipeinVerßoß gegen
den Geift des CUerkes, dem er außerdem in feinen paar Sätzen des Nachworts nicht gerecht wird.
Der Neudrude ift „unter teilweifer (!) Benutzung“ — Otto Gildemeißer nennt diefe Verwendung
des Adverbs teilweife als Adjektiv einen Äbgrund fprachlicher Roheit — der deutfehen Äusgabe
von 1761 (nicht 1764, wie im Nachwort fteht) erfolgt, alfo der Überfettung von J. G. Gellius.
Moreck meint, daß hinter ihr die fpäteren Überfettungen bei weitem zurückßehen, daß pe voll-
kommen die Htmofphäre gibt, in der die Gepalten des Romans leben. CUeiß er nicht, daßKäßner
und Mendelsfopn, die doch auch ein Urteil befaßen, über diefe Überfettung ein geradezu ver-
nichtendes Urteil gefällt haben? Das Nachwort zur „Jungfrau“ ift ergiebiger. Es bringt eine
Gefcbichte des CUerkes Voltaires, zählt die deutfehen Überfettungen auf, denen eine neu auf-
gefundene angefügt wird, und fagt, daß diefe vollftändige deutfepe Bearbeitung in Profa pd) auf
eine Manufkript gebliebene Übertragung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ftü^t, die Moreck und
Magda Janßen ergänzt haben. Cüo diefes Manufkript pch fand, was dod) höchß wichtig iß, wird
nicht verraten, und nach dem Verfaffer zu forfchen, was doch aud) höd)ft wichtig fein muß, fchien
der Schwierigkeiten und der Auspd)tslopgkeit (?!) eines folchen Verfudjs gegenüber nicht wichtig
genug! Das ift allerdings bequem! CUenn fchöne Bücher nicht bloß zum Sammeln, fondern aud)
zum Lefen da pnd, dann gehört zum fchönen Buche, daß aud) das, was die Fjerausgeber fagen,
gediegen iß, weil fold) ein Buch ja auch einmal in die Fjände von Lefern geraten kann, die Vor-
oder Nachreden pd) anfehen und zwar kritifch fid) anfehen.
Durch Beifügung alter Illußrationen hat auch der Verlag 0. C. Recht in München feinen
Neudrucken den Reiz verleihen wollen. Er legt uns Goethes Leiden des jungen CUerther in
einem in Antiqua gedruckten Oktavbande mit zehn Lichtdrucken der Steinradierungen des üony
Johannot nad) dem in der Münchener GraphifchenSammlung beßndlichen Exemplar der franzö-
pfd)en Originalausgabe vor und Goethes Fjermann und Dorothea in einem in Ciemann-Fraktur
gedruckten Quartbande mit zehn Lichtdrucken der Radierungen von Jofef Führich in der Braun-
fchweiger Ausgabe von 1827. Für beide Bücher beforgten Dr. C. CUolf & Sohn in München den
Drude und Obernetter in München die Ijerßellung der Lichtdrucke. Es erfd)ienen verfchiedene
Ausgaben von Japan und Bandlederband bis zum holzfreien Papier und Fjalbleinenbande. Diefe
CUiedererweckung der alten Illußrationen in den ganz vorzüglichen Lichtdrucken iß ein guter Ge-
danke gewefen, und da die ganze bud)ted)nifd)e Geftaltung gefchmackvoll und folide iß, kann
man an diefen Neudrucken feine Freude haben.
Starkes Intereffe wird noch ein anderer Neudruck eines CUerkes Goethes erregen: Der Reineke
Fuchs mit Illußrationen nad) den 57 Radierungen von Allart van Everdingen mit Einleitung
des Leipziger Stadtbibliothekars Dr. Johannes Fjofmann jm Verlage J. J. CUeber in Leipzig
(in Leinen gbd. 33 M., in Pergament 110 M.). CUenn es noch einer befonderen Begründung über-
haupt bedurfte, um die höchß reizvolle Vereinigung der Dichtung Goethes mit diefen Bildern, die
Goethes Lieblingsbilder zur Fuchsfabel waren, zu rechtfertigen, fo gibt pe IJofmann, der vor
kurzem erft kenntnisreich über das Verhältnis Allarts van Everdingen zu Goethe gefeßrieben hat,
in feiner ausgezeichneten Einleitung. CUenn doch alle Einleitungen oder Nachreden zu fd)önen
Büchern fo gründlich wären! B°fmaan gibt die Gefd)id)te des Cierepos von Reineke Fuchs in
einem Überblick über die Cierdichtung überhaupt bis zu Gottfcheds hod)deutfd)er Profaüberfetjung,
die Goethe vor allem durch die Illußrationen Allarts van Everdingen anzog, würdigt das graphifdjß
124