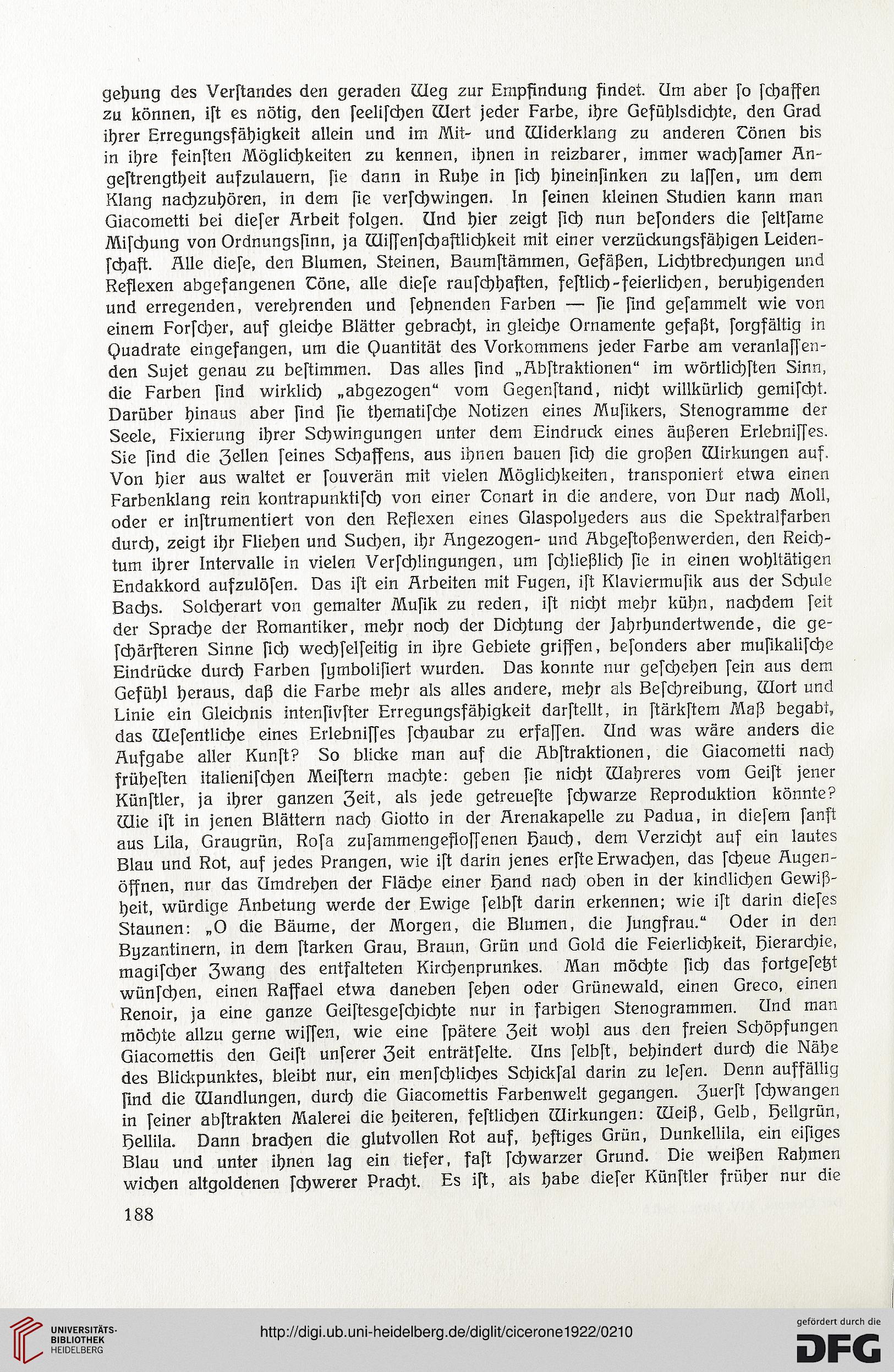geljung des Verftandes den geraden ÜUeg zur Empfindung findet Um aber fo fcßaffen
zu können, ift es nötig, den feelifdjen Udert jeder Farbe, ihre Gefüljlsdidjte, den Grad
ihrer Erregungsfähigkeit allein und im Mit- und üliderklang zu anderen Uönen bis
in ihre feinften Möglichkeiten zu kennen, ihnen in reizbarer, immer wadjfamer Än-
geftrengtljeit aufzulauern, fie dann in Ruhe in fid) hineinfinken zu laffen, um dem
Klang nachzuhören, in dem fie verfcßwingen. In feinen kleinen Studien kann man
Giacometti bei diefer Ärbeit folgen. Und hier zeigt fiel) nun befonders die feltfarne
Mifdjung von Ordnungsfinn, ja Uliffenfchaftlidjkeit mit einer verzückungsfähigen Leiden-
fchaft. Älle diefe, den Blumen, Steinen, Baumftämmen, Gefäßen, Lichtbrechungen und
Reflexen abgefangenen Cöne, alle diefe raufdjhaften, feftlich-feierlichen, beruhigenden
und erregenden, verehrenden und fehnenden Farben — fie find gefammelt wie von
einem Forfdjer, auf gleiche Blätter gebracht, in gleiche Ornamente gefaßt, forgfältig in
Quadrate eingefangen, um die Quantität des Vorkommens jeder Farbe am veranlaffen-
den Sujet genau zu beftimmen. Das alles find „Äbftraktionen“ im wörtlichften Sinn,
die Farben find wirklich „abgezogen“ vom Gegenftand, nicht willkürlich gemifcßt.
Darüber hinaus aber find fle tljematifche Notizen eines Mufikers, Stenogramme der
Seele, Fixierung ihrer Schwingungen unter dem Eindruck eines äußeren Erlebniffes.
Sie find die gellen feines Schaffens, aus ihnen bauen fiel) die großen Wirkungen auf.
Von hißr aus waltet er fouverän mit vielen Möglichkeiten, transponiert etwa einen
Farbenklang rein kontrapunktifch von einer Conart in die andere, von Dur nach Moll,
oder er inftrumentiert von den Reflexen eines Glaspolyeders aus die Spektralfarben
durch, zeigt ißr Fliehen und Suchen, ihr Ängezogen- und Äbgeftoßenwerden, den Reich-
tum ihrer Intervalle in vielen Verfclflirigungen, um fchließlid) fie in einen wohltätigen
Endakkord aufzulöfen. Das ift ein Ärbeiten mit Fugen, ift Klaviermufik aus der Schule
Bacfls. Solcherart von gemalter Mufik zu reden, ift nicht mehr kühn, nachdem feit
der Sprache der Romantiker, mehr noch der Dichtung der Jahrhundertwende, die ge-
fdjärfteren Sinne fleh wedjfelfeitig in ihre Gebiete griffen, befonders aber mufikalifche
Eindrücke durch Farben fymbolifiert wurden. Das konnte nur gefdjehen fein aus dem
Gefühl h^us, daß die Farbe mehr als alles andere, mehr als Befchreibung, Ulort und
Linie ein Gleichnis intenfivfter Erregungsfähigkeit darftellt, in ftärkftem Maß begabt,
das Ulefentliche eines Erlebniffes fdjaubar zu erfaffen. Und was wäre anders die
Aufgabe aller Kunft? So blicke man auf die Äbftraktionen, die Giacometti nach
früßeften italienifcljen Meiftern machte: geben fie nicht Ulaßreres vom Geift jener
Künftler, ja ihrer ganzen 3eit, als jede getreuefte fcßwarze Reproduktion könnte?
Ulie ift in jenen Blättern nach Giotto in der Ärenakapelle zu Padua, in diefem fanft
aus Lila, Graugrün, Rofa zufammengefloffenen Fjaud), dem Verzicht auf ein lautes
Blau und Rot, auf jedes Prangen, wie ift darin jenes erfte Erwachen, das fdjeue Äugen-
öffnen, nur das Umdrehen der Fläche einer Fjand nach oben in der kindlichen Gewiß-
heit, würdige Anbetung werde der Ewige felbft darin erkennen; wie ift darin diefes
Staunen: „O die Bäume, der Morgen, die Blumen, die Jungfrau.“ Oder in den
Byzantinern, in dem ftarken Grau, Braun, Grün und Gold die Feierlichkeit, Fjierarchie-
magifcher 3wang des entfalteten Kircßenprunkes. Man möchte fid) das fortgefetfl
wünfeflen, einen Raffael etwa daneben feljen oder Grünewald, einen Greco, einen
Renoir, ja eine ganze GeiftesgefcFiichte nur in farbigen Stenogrammen. Und man
möchte allzu gerne wiffen, wie eine fpätere 3eit wofll aus den freien Schöpfungen
Giacomettis den Geift unferer Seit enträtfelte. Uns felbft, behindert durch die Näfle
des Blickpunktes, bleibt nur, ein menfclfliches Sdflckfal darin zu lefen. Denn auffällig
find die {Handlungen, durch die Giacomettis Farbenwelt gegangen. fcflwangen
in feiner abftrakten Malerei die heiteren, feftlidjen ÜJirkungen: Uleiß, Gelb, Fjeilgrün,
Fjellila. Dann brachen die glutvollen Rot auf, heftiges Grün, Dunkellila, ein eifiges
Blau und unter ihnen lag ein tiefer, faft fcßwarzer Grund. Die weißen Rahmen
wichen altgoldenen fdjwerer Pracht Es ift, als i)abe diefer Künftler früher nur die
188
zu können, ift es nötig, den feelifdjen Udert jeder Farbe, ihre Gefüljlsdidjte, den Grad
ihrer Erregungsfähigkeit allein und im Mit- und üliderklang zu anderen Uönen bis
in ihre feinften Möglichkeiten zu kennen, ihnen in reizbarer, immer wadjfamer Än-
geftrengtljeit aufzulauern, fie dann in Ruhe in fid) hineinfinken zu laffen, um dem
Klang nachzuhören, in dem fie verfcßwingen. In feinen kleinen Studien kann man
Giacometti bei diefer Ärbeit folgen. Und hier zeigt fiel) nun befonders die feltfarne
Mifdjung von Ordnungsfinn, ja Uliffenfchaftlidjkeit mit einer verzückungsfähigen Leiden-
fchaft. Älle diefe, den Blumen, Steinen, Baumftämmen, Gefäßen, Lichtbrechungen und
Reflexen abgefangenen Cöne, alle diefe raufdjhaften, feftlich-feierlichen, beruhigenden
und erregenden, verehrenden und fehnenden Farben — fie find gefammelt wie von
einem Forfdjer, auf gleiche Blätter gebracht, in gleiche Ornamente gefaßt, forgfältig in
Quadrate eingefangen, um die Quantität des Vorkommens jeder Farbe am veranlaffen-
den Sujet genau zu beftimmen. Das alles find „Äbftraktionen“ im wörtlichften Sinn,
die Farben find wirklich „abgezogen“ vom Gegenftand, nicht willkürlich gemifcßt.
Darüber hinaus aber find fle tljematifche Notizen eines Mufikers, Stenogramme der
Seele, Fixierung ihrer Schwingungen unter dem Eindruck eines äußeren Erlebniffes.
Sie find die gellen feines Schaffens, aus ihnen bauen fiel) die großen Wirkungen auf.
Von hißr aus waltet er fouverän mit vielen Möglichkeiten, transponiert etwa einen
Farbenklang rein kontrapunktifch von einer Conart in die andere, von Dur nach Moll,
oder er inftrumentiert von den Reflexen eines Glaspolyeders aus die Spektralfarben
durch, zeigt ißr Fliehen und Suchen, ihr Ängezogen- und Äbgeftoßenwerden, den Reich-
tum ihrer Intervalle in vielen Verfclflirigungen, um fchließlid) fie in einen wohltätigen
Endakkord aufzulöfen. Das ift ein Ärbeiten mit Fugen, ift Klaviermufik aus der Schule
Bacfls. Solcherart von gemalter Mufik zu reden, ift nicht mehr kühn, nachdem feit
der Sprache der Romantiker, mehr noch der Dichtung der Jahrhundertwende, die ge-
fdjärfteren Sinne fleh wedjfelfeitig in ihre Gebiete griffen, befonders aber mufikalifche
Eindrücke durch Farben fymbolifiert wurden. Das konnte nur gefdjehen fein aus dem
Gefühl h^us, daß die Farbe mehr als alles andere, mehr als Befchreibung, Ulort und
Linie ein Gleichnis intenfivfter Erregungsfähigkeit darftellt, in ftärkftem Maß begabt,
das Ulefentliche eines Erlebniffes fdjaubar zu erfaffen. Und was wäre anders die
Aufgabe aller Kunft? So blicke man auf die Äbftraktionen, die Giacometti nach
früßeften italienifcljen Meiftern machte: geben fie nicht Ulaßreres vom Geift jener
Künftler, ja ihrer ganzen 3eit, als jede getreuefte fcßwarze Reproduktion könnte?
Ulie ift in jenen Blättern nach Giotto in der Ärenakapelle zu Padua, in diefem fanft
aus Lila, Graugrün, Rofa zufammengefloffenen Fjaud), dem Verzicht auf ein lautes
Blau und Rot, auf jedes Prangen, wie ift darin jenes erfte Erwachen, das fdjeue Äugen-
öffnen, nur das Umdrehen der Fläche einer Fjand nach oben in der kindlichen Gewiß-
heit, würdige Anbetung werde der Ewige felbft darin erkennen; wie ift darin diefes
Staunen: „O die Bäume, der Morgen, die Blumen, die Jungfrau.“ Oder in den
Byzantinern, in dem ftarken Grau, Braun, Grün und Gold die Feierlichkeit, Fjierarchie-
magifcher 3wang des entfalteten Kircßenprunkes. Man möchte fid) das fortgefetfl
wünfeflen, einen Raffael etwa daneben feljen oder Grünewald, einen Greco, einen
Renoir, ja eine ganze GeiftesgefcFiichte nur in farbigen Stenogrammen. Und man
möchte allzu gerne wiffen, wie eine fpätere 3eit wofll aus den freien Schöpfungen
Giacomettis den Geift unferer Seit enträtfelte. Uns felbft, behindert durch die Näfle
des Blickpunktes, bleibt nur, ein menfclfliches Sdflckfal darin zu lefen. Denn auffällig
find die {Handlungen, durch die Giacomettis Farbenwelt gegangen. fcflwangen
in feiner abftrakten Malerei die heiteren, feftlidjen ÜJirkungen: Uleiß, Gelb, Fjeilgrün,
Fjellila. Dann brachen die glutvollen Rot auf, heftiges Grün, Dunkellila, ein eifiges
Blau und unter ihnen lag ein tiefer, faft fcßwarzer Grund. Die weißen Rahmen
wichen altgoldenen fdjwerer Pracht Es ift, als i)abe diefer Künftler früher nur die
188