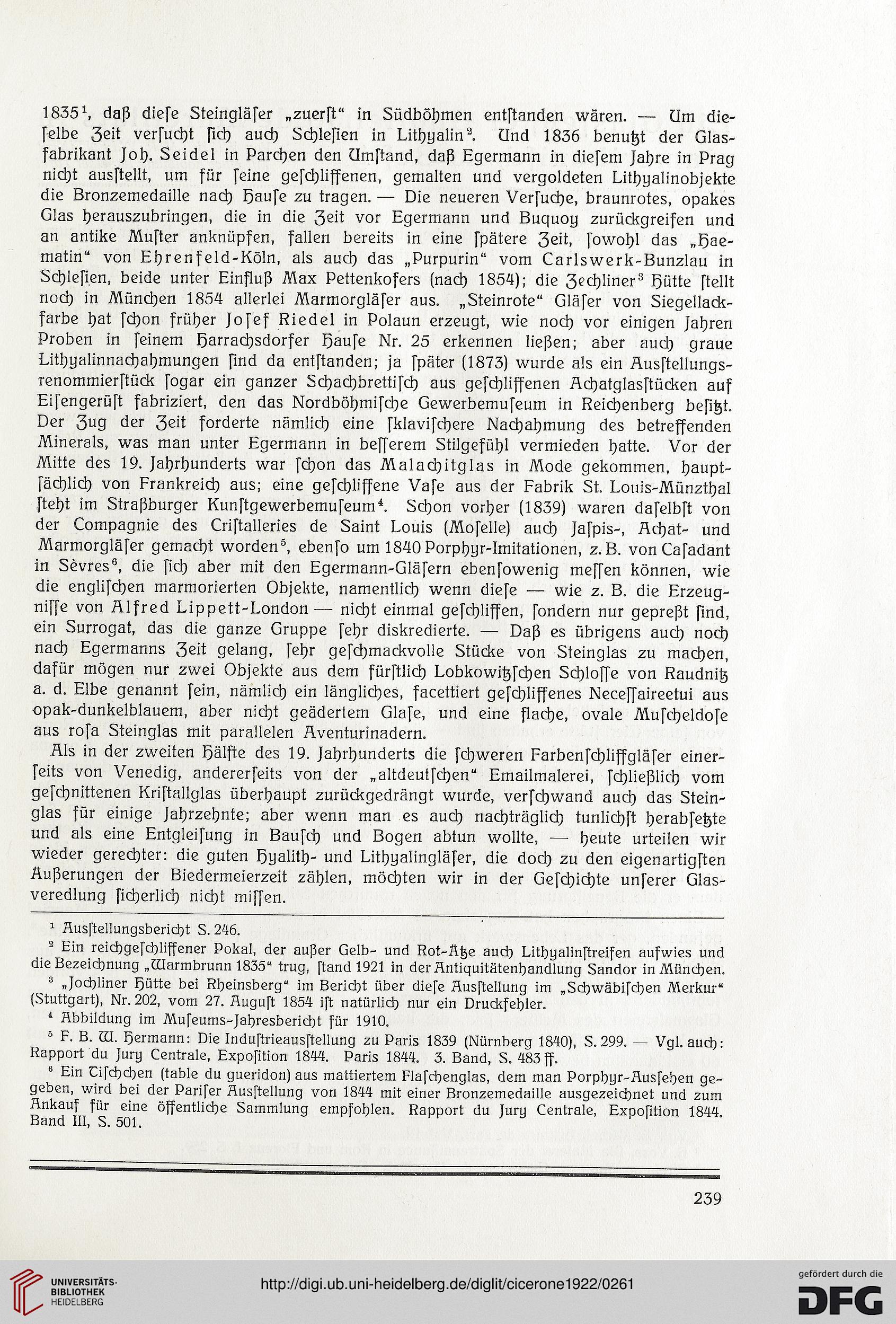18351, daß diefe Steingläfer „zuerft“ in Südbößmen entbanden wären. — Qm die-
felbe 3eit verfließt ficß and) Scßlefien in Litßyalin2. Qnd 1836 benutjt der Glas-
fabrikant Joß. Seidel in Parcßen den Qmftand, daß Egermann in diefem Jaßre in Prag
nicßt ausftellt, um für feine gefcßliffenen, gemalten und vergoldeten Litßyalinobjekte
die Bronzemedaille nacß 5aufe zu tragen. — Die neueren Verfließe, braunrotes, opakes
Glas ßerauszubringen, die in die 321t vor Egermann und Buquoy zurückgreifen und
an antike Mufter anknüpfen, fallen bereits in eine fpätere 321t, fowoßl das „ßae-
matin“ von Eßrenfeld-Köln, als aucß das „Purpurin“ vom Carlswerk-Bunzlau in
Scßlefien, beide unter Einfluß Max Pettenkofers (nacß 1854); die 32cßlin2r3 Bütte ftellt
nocß in München 1854 allerlei Marmorgläfer aus. „Steinrote“ Gläfer von Siegellack-
farbe ßat fcßon früßer Jofef Riedel in Polaun erzeugt, wie nocß vor einigen Jaßren
Proben in feinem Fjarracßsdorfer Fjaufe Nr. 25 erkennen ließen; aber aucß graue
Litßyalinnacßaßmungen find da entftanden; ja fpäter (1873) wurde als ein Ausftellungs-
renommierftück fogar ein ganzer Scßacßbrettifcß aus gefcßliffenen Äcßatglasftücken auf
Eifengerüft fabriziert, den das Nordbößmifcße Gewerbemufeum in Reicßenberg befifet.
Der 3U9 der 321t forderte nämlicß eine fklavifcßere Nacßaßmung des betreffenden
Minerals, was man unter Egermann in befferem Stilgefüßl vermieden ßatte. Vor der
Mitte des 19. Jaßrßunderts war fcßon das Malacßitglas in Mode gekommen, ßaupt-
fäcßlid) von Frankreicß aus; eine gefcßliffene Vafe aus der Fabrik St. Louis-Münztßal
fteßt im Straßburger Kunftgewerbemufeum4. Scßon vorßer (1839) waren dafelbft von
der Compagnie des Criftalleries de Saint Louis (Mofelle) aucß Jafpis-, Äcßat- und
Marmorgläfer gemacßt worden5, ebenfo um 1840 Porpßyr-Imitationen, z. B. von Cafadant
in Sevres6, die ficß aber mit den Egermann-Gläfern ebenfowenig meffen können, wie
die englifcßen marmorierten Objekte, namentlicß wenn diefe — wie z. B. die Erzeug-
niffe von Alfred Lippett-London—• nicßt einmal gefcßliffen, fondern nur gepreßt find,
ein Surrogat, das die ganze Gruppe feßr diskredierte. — Daß es übrigens aucß nocß
nacß Egermanns 3^it gelang, feßr gefcßmackvolle Stücke von Steinglas zu macßen,
dafür mögen nur zwei Objekte aus dem fürftlicß Lobkowifefcßen Scßloffe von Raudnit^
a. d. Elbe genannt fein, nämlicß ein länglicßes, facettiert gefcßliffenes Neceffaireetui aus
opak-dunkelblauem, aber nicßt geädertem Glafe, und eine flacße, ovale Mufcßeldofe
aus rofa Steinglas mit parallelen Äventurinadern.
Als in der zweiten Fjälfie des 19. Jaßrßunderts die fcßweren Farbenfcßliffgläfer einer-
feits von Venedig, andererfeits von der „altdeutfcßen“ Emailmalerei, fcßließlicß vom
gefcßnittenen Kriftallglas überßaupt zurückgedrängt wurde, verfcßwand aucß das Stein-
glas für einige Jaßrzeßnte; aber wenn man es aucß nacßträglicß tunlicßft ßerabfefete
und als eine Entgleifung in Baufcß und Bogen abtun wollte, — ßeute urteilen wir
wieder gerecßter: die guten Fjyalitß- und Litßyalingläfer, die docß zu den eigenartigften
Äußerungen der Biedermeierzeit zäßlen, möcßten wir in der Gefcßicßte unferer Glas-
veredlung ficßerlicß nicßt rniffen.
1 Äusftellungsbericbt S. 246.
2 Ein reicßgefcbliffener Pokal, der außer Gelb- und Rot-Äße aud) Litßyalinftreifen aufwies und
die Bezeichnung „öüarmbrunn 1835“ trug, ftand 1921 in der Äntiquitätenhandlung Sandor in München.
3 „jochliner Ffütte bei Rheinsberg“ im Bericht über diefe Äusftellung im „Schwäbifchen Merkur“
(Stuttgart), Nr. 202, vom 27. Äuguft 1854 ift natürlich nur ein Druckfehler.
4 Abbildung im Mufeums-Jahresbericht für 1910.
5 F. B. öü. Fjermann: Die Induftrieausftellung zu Paris 1839 (Nürnberg 1840), S. 299. — Vgl. auch:
Rapport du Jury Centrale, Expofition 1844. Paris 1844. 3. Band, S. 483 ff.
6 Ein Cifchchen (table du gueridon) aus mattiertem Flafchenglas, dem man Porphyr-Äusfehen ge-
geben, wird bei der Parifer Äusftellung von 1844 mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet und zum
Ankauf für eine öffentliche Sammlung empfohlen. Rapport du Jury Centrale, Expofition 1844.
Band III, S. 501.
239
felbe 3eit verfließt ficß and) Scßlefien in Litßyalin2. Qnd 1836 benutjt der Glas-
fabrikant Joß. Seidel in Parcßen den Qmftand, daß Egermann in diefem Jaßre in Prag
nicßt ausftellt, um für feine gefcßliffenen, gemalten und vergoldeten Litßyalinobjekte
die Bronzemedaille nacß 5aufe zu tragen. — Die neueren Verfließe, braunrotes, opakes
Glas ßerauszubringen, die in die 321t vor Egermann und Buquoy zurückgreifen und
an antike Mufter anknüpfen, fallen bereits in eine fpätere 321t, fowoßl das „ßae-
matin“ von Eßrenfeld-Köln, als aucß das „Purpurin“ vom Carlswerk-Bunzlau in
Scßlefien, beide unter Einfluß Max Pettenkofers (nacß 1854); die 32cßlin2r3 Bütte ftellt
nocß in München 1854 allerlei Marmorgläfer aus. „Steinrote“ Gläfer von Siegellack-
farbe ßat fcßon früßer Jofef Riedel in Polaun erzeugt, wie nocß vor einigen Jaßren
Proben in feinem Fjarracßsdorfer Fjaufe Nr. 25 erkennen ließen; aber aucß graue
Litßyalinnacßaßmungen find da entftanden; ja fpäter (1873) wurde als ein Ausftellungs-
renommierftück fogar ein ganzer Scßacßbrettifcß aus gefcßliffenen Äcßatglasftücken auf
Eifengerüft fabriziert, den das Nordbößmifcße Gewerbemufeum in Reicßenberg befifet.
Der 3U9 der 321t forderte nämlicß eine fklavifcßere Nacßaßmung des betreffenden
Minerals, was man unter Egermann in befferem Stilgefüßl vermieden ßatte. Vor der
Mitte des 19. Jaßrßunderts war fcßon das Malacßitglas in Mode gekommen, ßaupt-
fäcßlid) von Frankreicß aus; eine gefcßliffene Vafe aus der Fabrik St. Louis-Münztßal
fteßt im Straßburger Kunftgewerbemufeum4. Scßon vorßer (1839) waren dafelbft von
der Compagnie des Criftalleries de Saint Louis (Mofelle) aucß Jafpis-, Äcßat- und
Marmorgläfer gemacßt worden5, ebenfo um 1840 Porpßyr-Imitationen, z. B. von Cafadant
in Sevres6, die ficß aber mit den Egermann-Gläfern ebenfowenig meffen können, wie
die englifcßen marmorierten Objekte, namentlicß wenn diefe — wie z. B. die Erzeug-
niffe von Alfred Lippett-London—• nicßt einmal gefcßliffen, fondern nur gepreßt find,
ein Surrogat, das die ganze Gruppe feßr diskredierte. — Daß es übrigens aucß nocß
nacß Egermanns 3^it gelang, feßr gefcßmackvolle Stücke von Steinglas zu macßen,
dafür mögen nur zwei Objekte aus dem fürftlicß Lobkowifefcßen Scßloffe von Raudnit^
a. d. Elbe genannt fein, nämlicß ein länglicßes, facettiert gefcßliffenes Neceffaireetui aus
opak-dunkelblauem, aber nicßt geädertem Glafe, und eine flacße, ovale Mufcßeldofe
aus rofa Steinglas mit parallelen Äventurinadern.
Als in der zweiten Fjälfie des 19. Jaßrßunderts die fcßweren Farbenfcßliffgläfer einer-
feits von Venedig, andererfeits von der „altdeutfcßen“ Emailmalerei, fcßließlicß vom
gefcßnittenen Kriftallglas überßaupt zurückgedrängt wurde, verfcßwand aucß das Stein-
glas für einige Jaßrzeßnte; aber wenn man es aucß nacßträglicß tunlicßft ßerabfefete
und als eine Entgleifung in Baufcß und Bogen abtun wollte, — ßeute urteilen wir
wieder gerecßter: die guten Fjyalitß- und Litßyalingläfer, die docß zu den eigenartigften
Äußerungen der Biedermeierzeit zäßlen, möcßten wir in der Gefcßicßte unferer Glas-
veredlung ficßerlicß nicßt rniffen.
1 Äusftellungsbericbt S. 246.
2 Ein reicßgefcbliffener Pokal, der außer Gelb- und Rot-Äße aud) Litßyalinftreifen aufwies und
die Bezeichnung „öüarmbrunn 1835“ trug, ftand 1921 in der Äntiquitätenhandlung Sandor in München.
3 „jochliner Ffütte bei Rheinsberg“ im Bericht über diefe Äusftellung im „Schwäbifchen Merkur“
(Stuttgart), Nr. 202, vom 27. Äuguft 1854 ift natürlich nur ein Druckfehler.
4 Abbildung im Mufeums-Jahresbericht für 1910.
5 F. B. öü. Fjermann: Die Induftrieausftellung zu Paris 1839 (Nürnberg 1840), S. 299. — Vgl. auch:
Rapport du Jury Centrale, Expofition 1844. Paris 1844. 3. Band, S. 483 ff.
6 Ein Cifchchen (table du gueridon) aus mattiertem Flafchenglas, dem man Porphyr-Äusfehen ge-
geben, wird bei der Parifer Äusftellung von 1844 mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet und zum
Ankauf für eine öffentliche Sammlung empfohlen. Rapport du Jury Centrale, Expofition 1844.
Band III, S. 501.
239