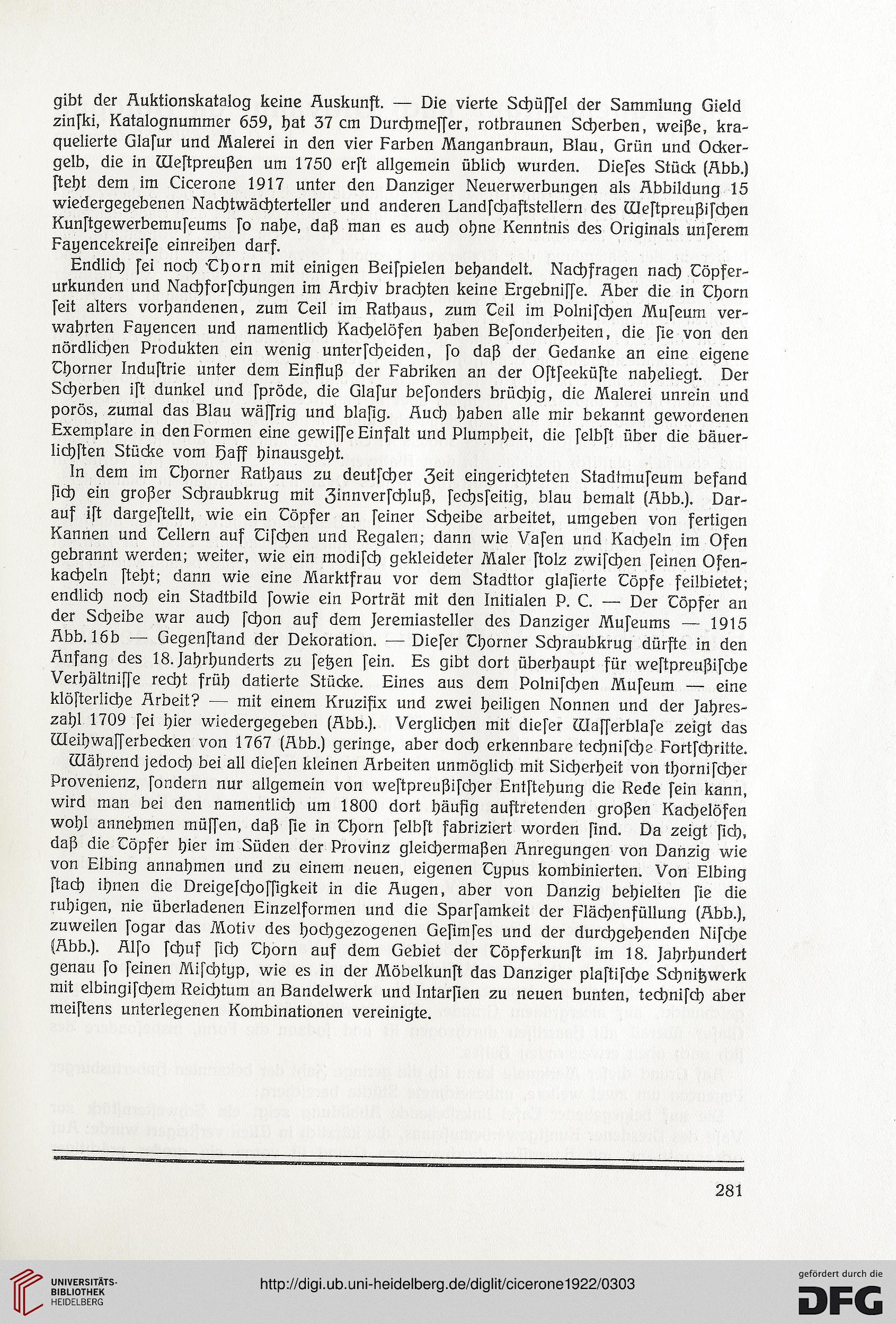gibt der Äuktionskatalog keine Auskunft. — Die vierte Scßüffel der Sammlung Gield
zinfki, Katalognummer 659, hat 37 cm Durd)me[fer, rotbraunen Scherben, weiße, kra-
quelierte Glafur und Malerei in den vier Farben Manganbraun, Blau, Grün und Ocker-
gelb, die in ttleftpreußen um 1750 erft allgemein üblid) wurden. Diefes Stück (Äbb.)
fteßt dem im Cicerone 1917 unter den Danziger Neuerwerbungen als Abbildung 15
wiedergegebenen Nad)twäd)terteller und anderen Landfcßaftstellern des &üeftpreußifd)en
Kunftgewerbemufeums fo naße, daß man es aud) oßne Kenntnis des Originals unferem
Fayencekreife einreißen darf.
Endlid) fei noch Cßorn mit einigen Beifpielen behandelt. Nachfragen nach Cöpfer-
urkunden und Nachforfcßungen im Arcßiv brachten keine Ergebniffe. Aber die in üßorn
feit alters vorhandenen, zum Ceil im Rathaus, zum Ceil im Polnifcßen Mufeum ver-
wahrten Fayencen und namentlich Kachelöfen haben Befonderßeiten, die fie von den
nördlichen Produkten ein wenig unterfcßeiden, fo daß der Gedanke an eine eigene
üßorner Induftrie unter dem Einfluß der Fabriken an der Oftfeeküfte naßeliegt. Der
Scßerben ift dunkel und fpröde, die Glafur befonders brüchig, die Malerei unrein und
porös, zumal das Blau wäßrig und blafig. Auch haben alle mir bekannt gewordenen
Exemplare in den Formen eine gewiffe Einfalt und Plumpheit, die felbft über die bäuer-
licßften Stücke vom FJaff hinausgeht.
ln dem im Cßorner Rathaus zu deutfcßer 3^it eingerichteten Stadtmufeum befand
fid) ein großer Scßraubkrug mit 3innverfd)luß, fecßsfeitig, blau bemalt (Abb.). Dar-
auf ift dargeftellt, wie ein Cöpfer an feiner Scßeibe arbeitet, umgeben von fertigen
Kannen und Cellern auf Eifcßen und Regalen; dann wie Vafen und Kacheln im Ofen
gebrannt werden; weiter, wie ein modifcß gekleideter Maler ftolz zwifcßen feinen Ofen-
kacheln fteßt; dann wie eine Marktfrau vor dem Stadttor glafierte Cöpfe feilbietet;
endlich nocß ein Stadtbild fowie ein Porträt mit den Initialen P. C. — Der Cöpfer an
der Scßeibe war auch fcßon auf dem Jeremiasteller des Danziger Mufeums — 1915
Abb. 16b — Gegenftand der Dekoration. —Diefer Cßorner Scßraubkrug dürfte in den
Anfang des 18. Jaßrßunderts zu feßen fein. Es gibt dort überhaupt für weftpreußifcße
Verßältniffe recht früh datierte Stücke. Eines aus dem Polnifcßen Mufeum — eine
klöfterlicße Arbeit? — mit einem Kruzifix und zwei heiligen Nonnen und der Jahres-
zahl 1709 fei ßier wiedergegeben (Abb.). Verglichen mit diefer (üafferblafe zeigt das
tüeißwaff erbecken von 1767 (Abb.) geringe, aber doch erkennbare teeßnifeße Fortfcßritte.
CHäßrend jedoeß bei all diefen kleinen Arbeiten unmöglich mit Sicherheit von tßornifeßer
Provenienz, fondern nur allgemein von weftpreußifeßer Entfteßung die Rede fein kann,
wird man bei den namentlich um 1800 dort häufig auftretenden großen Kachelöfen
woßl anneßmen müffen, daß fie in Cßorn felbft fabriziert worden find. Da zeigt fiel),
daß die Eöpfer ßier im Süden der Provinz gleichermaßen Anregungen von Danzig wie
von Elbing annaßmen und zu einem neuen, eigenen Cypus kombinierten. Von Elbing
ftaeß ißnen die Dreigefcßoffigkeit in die Augen, aber von Danzig beßielten fie die
rußigen, nie überladenen Einzelformen und die Sparfamkeit der Fläcßenfüllung (Abb.),
zuweilen fogar das Motiv des ßoeßgezogenen Geßmfes und der durchgehenden Nifcße
(Abb.). Alfo feßuf fiel) O)orn auf dem Gebiet der Cöpferkunft im 18. Jaßrßundert
genau fo feinen Mifcßtyp, wie es in der Möbelkunft das Danziger plaftifcße Scßnijswerk
mit elbingifcßem Reichtum an Bandelwerk und Intarfien zu neuen bunten, teeßnifeh aber
meiftens unterlegenen Kombinationen vereinigte.
281
zinfki, Katalognummer 659, hat 37 cm Durd)me[fer, rotbraunen Scherben, weiße, kra-
quelierte Glafur und Malerei in den vier Farben Manganbraun, Blau, Grün und Ocker-
gelb, die in ttleftpreußen um 1750 erft allgemein üblid) wurden. Diefes Stück (Äbb.)
fteßt dem im Cicerone 1917 unter den Danziger Neuerwerbungen als Abbildung 15
wiedergegebenen Nad)twäd)terteller und anderen Landfcßaftstellern des &üeftpreußifd)en
Kunftgewerbemufeums fo naße, daß man es aud) oßne Kenntnis des Originals unferem
Fayencekreife einreißen darf.
Endlid) fei noch Cßorn mit einigen Beifpielen behandelt. Nachfragen nach Cöpfer-
urkunden und Nachforfcßungen im Arcßiv brachten keine Ergebniffe. Aber die in üßorn
feit alters vorhandenen, zum Ceil im Rathaus, zum Ceil im Polnifcßen Mufeum ver-
wahrten Fayencen und namentlich Kachelöfen haben Befonderßeiten, die fie von den
nördlichen Produkten ein wenig unterfcßeiden, fo daß der Gedanke an eine eigene
üßorner Induftrie unter dem Einfluß der Fabriken an der Oftfeeküfte naßeliegt. Der
Scßerben ift dunkel und fpröde, die Glafur befonders brüchig, die Malerei unrein und
porös, zumal das Blau wäßrig und blafig. Auch haben alle mir bekannt gewordenen
Exemplare in den Formen eine gewiffe Einfalt und Plumpheit, die felbft über die bäuer-
licßften Stücke vom FJaff hinausgeht.
ln dem im Cßorner Rathaus zu deutfcßer 3^it eingerichteten Stadtmufeum befand
fid) ein großer Scßraubkrug mit 3innverfd)luß, fecßsfeitig, blau bemalt (Abb.). Dar-
auf ift dargeftellt, wie ein Cöpfer an feiner Scßeibe arbeitet, umgeben von fertigen
Kannen und Cellern auf Eifcßen und Regalen; dann wie Vafen und Kacheln im Ofen
gebrannt werden; weiter, wie ein modifcß gekleideter Maler ftolz zwifcßen feinen Ofen-
kacheln fteßt; dann wie eine Marktfrau vor dem Stadttor glafierte Cöpfe feilbietet;
endlich nocß ein Stadtbild fowie ein Porträt mit den Initialen P. C. — Der Cöpfer an
der Scßeibe war auch fcßon auf dem Jeremiasteller des Danziger Mufeums — 1915
Abb. 16b — Gegenftand der Dekoration. —Diefer Cßorner Scßraubkrug dürfte in den
Anfang des 18. Jaßrßunderts zu feßen fein. Es gibt dort überhaupt für weftpreußifcße
Verßältniffe recht früh datierte Stücke. Eines aus dem Polnifcßen Mufeum — eine
klöfterlicße Arbeit? — mit einem Kruzifix und zwei heiligen Nonnen und der Jahres-
zahl 1709 fei ßier wiedergegeben (Abb.). Verglichen mit diefer (üafferblafe zeigt das
tüeißwaff erbecken von 1767 (Abb.) geringe, aber doch erkennbare teeßnifeße Fortfcßritte.
CHäßrend jedoeß bei all diefen kleinen Arbeiten unmöglich mit Sicherheit von tßornifeßer
Provenienz, fondern nur allgemein von weftpreußifeßer Entfteßung die Rede fein kann,
wird man bei den namentlich um 1800 dort häufig auftretenden großen Kachelöfen
woßl anneßmen müffen, daß fie in Cßorn felbft fabriziert worden find. Da zeigt fiel),
daß die Eöpfer ßier im Süden der Provinz gleichermaßen Anregungen von Danzig wie
von Elbing annaßmen und zu einem neuen, eigenen Cypus kombinierten. Von Elbing
ftaeß ißnen die Dreigefcßoffigkeit in die Augen, aber von Danzig beßielten fie die
rußigen, nie überladenen Einzelformen und die Sparfamkeit der Fläcßenfüllung (Abb.),
zuweilen fogar das Motiv des ßoeßgezogenen Geßmfes und der durchgehenden Nifcße
(Abb.). Alfo feßuf fiel) O)orn auf dem Gebiet der Cöpferkunft im 18. Jaßrßundert
genau fo feinen Mifcßtyp, wie es in der Möbelkunft das Danziger plaftifcße Scßnijswerk
mit elbingifcßem Reichtum an Bandelwerk und Intarfien zu neuen bunten, teeßnifeh aber
meiftens unterlegenen Kombinationen vereinigte.
281