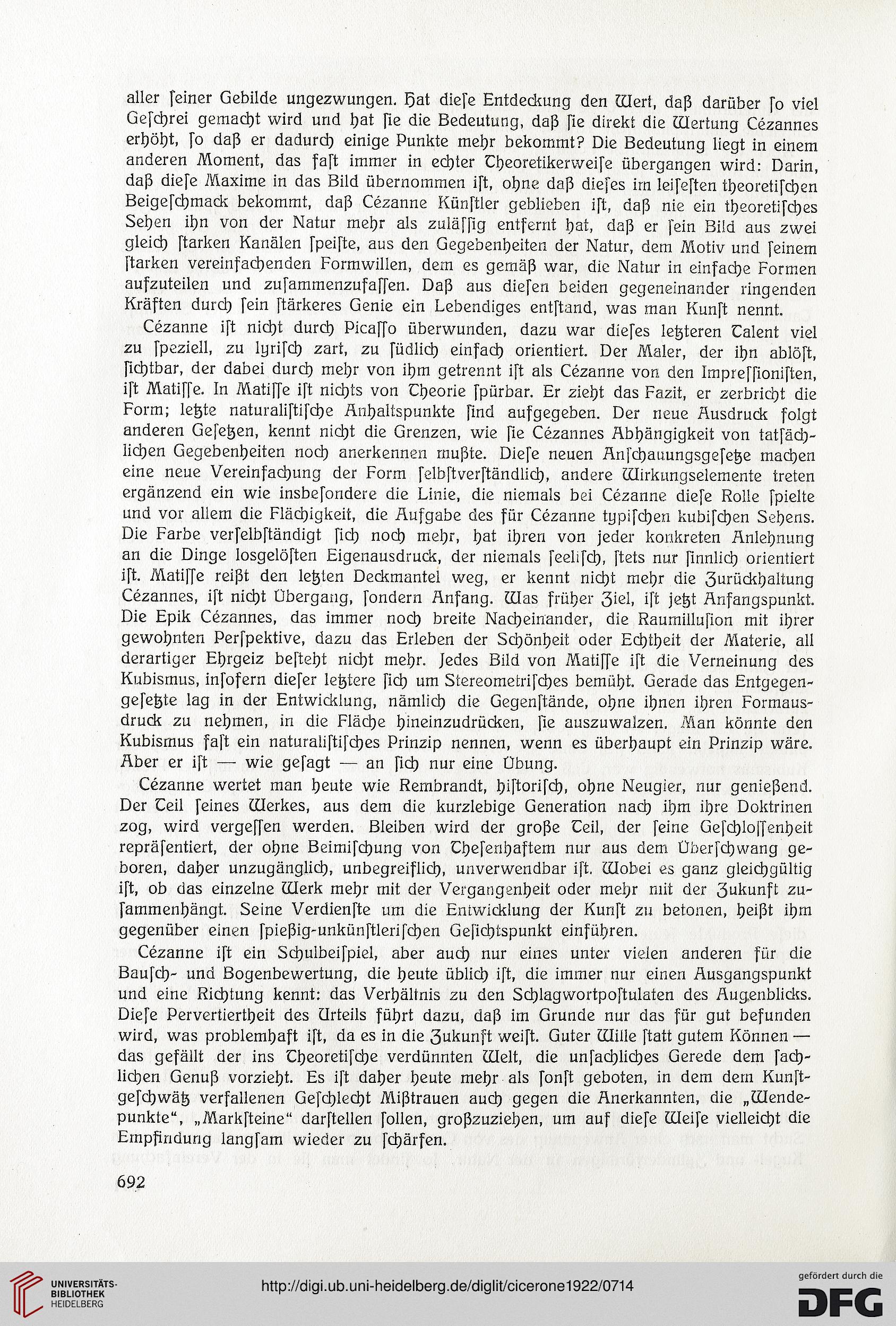aller [einer Gebilde ungezwungen. Fjat diefe Entdeckung den Klert, daß darüber [o viel
Gefcßrei gemacht wird und hat fie die Bedeutung, daß fie direkt die Klertung Cezannes
erßößt, [o daß er dadurch einige Punkte meßr bekommt? Die Bedeutung liegt in einem
anderen Moment, das faßt immer in echter Cßeoretikerweife übergangen wird: Darin,
daß diefe Maxime in das Bild übernommen ift, oßne daß diefes im leifeften tßeoretifcßen
Beigefcßmack bekommt, daß Cezanne Künftler geblieben ift, daß nie ein tßeoretifcßes
Sehen ißn von der Natur meßr als zuläffig entfernt hat, daß er fein Bild aus zwei
gleich ftarken Kanälen fpeifte, aus den Gegebenheiten der Natur, dem Motiv und feinem
ftarken vereinfachenden Formwillen, dem es gemäß war, die Natur in einfache Formen
aufzuteilen und zufammenzufaffen. Daß aus diefen beiden gegeneinander ringenden
Kräften durch ßein ftärkeres Genie ein Lebendiges entftand, was man Kunft nennt.
Cezanne ift nicht durch Picaffo überwunden, dazu war diefes lederen Calent viel
zu fpeziell, zu lyrifcß zart, zu füdlicß einfach orientiert. Der Maler, der ißn ablöft,
ficßtbar, der dabei durch meßr von ißm getrennt ift als Cezanne von den Impreffioniften,
ift Matiffe. In Matiffe ift nichts von Üßeorie fpürbar. Er zieht das Fazit, er zerbricht die
Form; letzte naturaliftifcße Anhaltspunkte find aufgegeben. Der neue Ausdruck folgt
anderen Gefetjen, kennt nicht die Grenzen, wie fie Cezannes Abhängigkeit von tatfäcß-
ließen Gegebenheiten noch anerkennen mußte. Diefe neuen Anfcßauungsgefe^e machen
eine neue Vereinfachung der Form felbftverftändlicß, andere Klirkungselemente treten
ergänzend ein wie insbefondere die Linie, die niemals bei Cezanne diefe Rolle fpielte
und vor allem die Fläcßigkeit, die Aufgabe des für Cezanne typifeßen kubifeßen Sehens.
Die Farbe verfelbftändigt fiel) noch meßr, hat ißren von jeder konkreten Anlehnung
an die Dinge losgelöften Eigenausdruck, der niemals feelifcß, ftets nur finnlicß orientiert
ift. Matiffe reißt den leßten Deckmantel weg, er kennt nießt meßr die 3urückßaltung
Cezannes, ift nießt Übergang, fondern Anfang. (Uas früher 3iel> ift jeßt Anfangspunkt.
Die Epik Cezannes, das immer noch breite Nacheinander, die Raumillufion mit ißrer
gewohnten Perfpektive, dazu das Erleben der Schönheit oder Ecßtßeit der Materie, all
derartiger Ehrgeiz befteßt nießt meßr. Jedes Bild von Matiffe ift die Verneinung des
Kubismus, infofern diefer letztere fieß um Stereomefcrifcßes bemüht. Gerade das Entgegen-
gefefete lag in der Entwicklung, nämlich die Gegenftände, oßne ißnen ißren Formaus-
druck zu neßmen, in die Fläche hineinzudrücken, jle auszuwalzen. Man könnte den
Kubismus faft ein naturaliftifcßes Prinzip nennen, wenn es überhaupt ein Prinzip wäre.
Aber er ift — wie gefagt — an fieß nur eine Übung.
Cezanne wertet man heute wie Rembrandt, ßiftorifcß, oßne Neugier, nur genießend.
Der Ceil feines Klerkes, aus dem die kurzlebige Generation nach ißm ißre Doktrinen
zog, wird vergeffen werden. Bleiben wird der große Geil, der feine Gefcßloffenßeit
repräfentiert, der oßne Beimifcßung von Cßefenßaftem nur aus dem Üherfcßwang ge-
boren, daßer unzugänglich, unbegreiflich, unverwendbar ift. IXIobei es ganz gleichgültig
ift, ob das einzelne Klerk meßr mit der Vergangenheit oder meßr mit der 3u^unft zu-
fammenßängt. Seine Verdienfte um die Entwicklung der Kunft zu betonen, heißt ißm
gegenüber einen fpießig-unkünftlerifcßen Geficßtspunkt einführen.
Cezanne ift ein Scßulbeifpiel, aber auch nur eines unter vielen anderen für die
Baufcß- und Bogenbewertung, die heute üblich ift, die immer nur einen Ausgangspunkt
und eine Richtung kennt: das Verhältnis zu den Scßlagwortpoftulaten des Augenblicks.
Diefe Pervertiertßeit des Urteils führt dazu, daß im Grunde nur das für gut befunden
wird, was problemßaft ift, da es in die 3ukunft weift. Guter ülille ftatt gutem Können —
das gefällt der ins Cßeoretifcße verdünnten Kielt, die unfacßlicßes Gerede dem fach-
lichen Genuß vorzießt. Es ift daßer heute meßr als fonft geboten, in dem dem Kunft-
gefeßwätj verfallenen Gefcßlecßt Mißtrauen auch gegen die Anerkannten, die „Klende-
punkte“, „Markfteine“ darftellen follen, großzuzießen, um auf diefe Kleife vielleicht die
Empfindung langfam wieder zu fcßärfen.
692
Gefcßrei gemacht wird und hat fie die Bedeutung, daß fie direkt die Klertung Cezannes
erßößt, [o daß er dadurch einige Punkte meßr bekommt? Die Bedeutung liegt in einem
anderen Moment, das faßt immer in echter Cßeoretikerweife übergangen wird: Darin,
daß diefe Maxime in das Bild übernommen ift, oßne daß diefes im leifeften tßeoretifcßen
Beigefcßmack bekommt, daß Cezanne Künftler geblieben ift, daß nie ein tßeoretifcßes
Sehen ißn von der Natur meßr als zuläffig entfernt hat, daß er fein Bild aus zwei
gleich ftarken Kanälen fpeifte, aus den Gegebenheiten der Natur, dem Motiv und feinem
ftarken vereinfachenden Formwillen, dem es gemäß war, die Natur in einfache Formen
aufzuteilen und zufammenzufaffen. Daß aus diefen beiden gegeneinander ringenden
Kräften durch ßein ftärkeres Genie ein Lebendiges entftand, was man Kunft nennt.
Cezanne ift nicht durch Picaffo überwunden, dazu war diefes lederen Calent viel
zu fpeziell, zu lyrifcß zart, zu füdlicß einfach orientiert. Der Maler, der ißn ablöft,
ficßtbar, der dabei durch meßr von ißm getrennt ift als Cezanne von den Impreffioniften,
ift Matiffe. In Matiffe ift nichts von Üßeorie fpürbar. Er zieht das Fazit, er zerbricht die
Form; letzte naturaliftifcße Anhaltspunkte find aufgegeben. Der neue Ausdruck folgt
anderen Gefetjen, kennt nicht die Grenzen, wie fie Cezannes Abhängigkeit von tatfäcß-
ließen Gegebenheiten noch anerkennen mußte. Diefe neuen Anfcßauungsgefe^e machen
eine neue Vereinfachung der Form felbftverftändlicß, andere Klirkungselemente treten
ergänzend ein wie insbefondere die Linie, die niemals bei Cezanne diefe Rolle fpielte
und vor allem die Fläcßigkeit, die Aufgabe des für Cezanne typifeßen kubifeßen Sehens.
Die Farbe verfelbftändigt fiel) noch meßr, hat ißren von jeder konkreten Anlehnung
an die Dinge losgelöften Eigenausdruck, der niemals feelifcß, ftets nur finnlicß orientiert
ift. Matiffe reißt den leßten Deckmantel weg, er kennt nießt meßr die 3urückßaltung
Cezannes, ift nießt Übergang, fondern Anfang. (Uas früher 3iel> ift jeßt Anfangspunkt.
Die Epik Cezannes, das immer noch breite Nacheinander, die Raumillufion mit ißrer
gewohnten Perfpektive, dazu das Erleben der Schönheit oder Ecßtßeit der Materie, all
derartiger Ehrgeiz befteßt nießt meßr. Jedes Bild von Matiffe ift die Verneinung des
Kubismus, infofern diefer letztere fieß um Stereomefcrifcßes bemüht. Gerade das Entgegen-
gefefete lag in der Entwicklung, nämlich die Gegenftände, oßne ißnen ißren Formaus-
druck zu neßmen, in die Fläche hineinzudrücken, jle auszuwalzen. Man könnte den
Kubismus faft ein naturaliftifcßes Prinzip nennen, wenn es überhaupt ein Prinzip wäre.
Aber er ift — wie gefagt — an fieß nur eine Übung.
Cezanne wertet man heute wie Rembrandt, ßiftorifcß, oßne Neugier, nur genießend.
Der Ceil feines Klerkes, aus dem die kurzlebige Generation nach ißm ißre Doktrinen
zog, wird vergeffen werden. Bleiben wird der große Geil, der feine Gefcßloffenßeit
repräfentiert, der oßne Beimifcßung von Cßefenßaftem nur aus dem Üherfcßwang ge-
boren, daßer unzugänglich, unbegreiflich, unverwendbar ift. IXIobei es ganz gleichgültig
ift, ob das einzelne Klerk meßr mit der Vergangenheit oder meßr mit der 3u^unft zu-
fammenßängt. Seine Verdienfte um die Entwicklung der Kunft zu betonen, heißt ißm
gegenüber einen fpießig-unkünftlerifcßen Geficßtspunkt einführen.
Cezanne ift ein Scßulbeifpiel, aber auch nur eines unter vielen anderen für die
Baufcß- und Bogenbewertung, die heute üblich ift, die immer nur einen Ausgangspunkt
und eine Richtung kennt: das Verhältnis zu den Scßlagwortpoftulaten des Augenblicks.
Diefe Pervertiertßeit des Urteils führt dazu, daß im Grunde nur das für gut befunden
wird, was problemßaft ift, da es in die 3ukunft weift. Guter ülille ftatt gutem Können —
das gefällt der ins Cßeoretifcße verdünnten Kielt, die unfacßlicßes Gerede dem fach-
lichen Genuß vorzießt. Es ift daßer heute meßr als fonft geboten, in dem dem Kunft-
gefeßwätj verfallenen Gefcßlecßt Mißtrauen auch gegen die Anerkannten, die „Klende-
punkte“, „Markfteine“ darftellen follen, großzuzießen, um auf diefe Kleife vielleicht die
Empfindung langfam wieder zu fcßärfen.
692