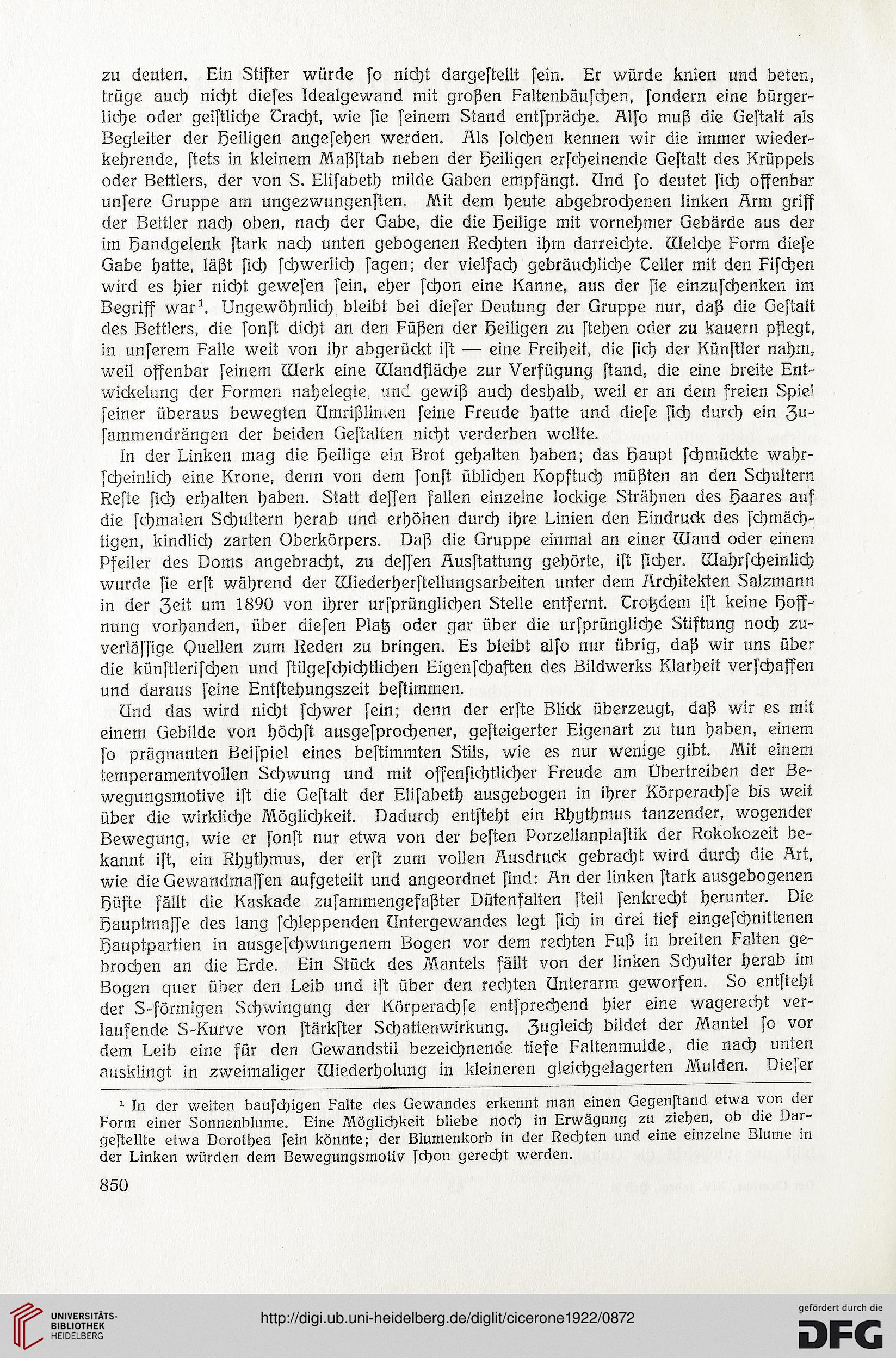zu deuten. Ein Stifter würde fo nicht dargeftellt fein. Er würde knien und beten,
trüge auch nicht diefes Idealgewand mit großen Faltenbäufcßen, fondern eine bürger-
liche oder geiftlicße Gracht, wie fie feinem Stand entfpräcße. Älfo muß die Geftalt als
Begleiter der ^eiligen angefeßen werden. Als folcßen kennen wir die immer wieder-
kehrende, ftets in kleinem Maßftab neben der Geiligen erfcßeinende Geftalt des Krüppels
oder Bettlers, der von S. Elifabetß milde Gaben empfängt. Und fo deutet fid) offenbar
unfere Gruppe am ungezwungenften. Mit dem heute abgebrochenen linken Arm griff
der Bettler nach oben, nach der Gabe, die die heilige mjt vornehmer Gebärde aus der
im Gandgelenk ftark nach unten gebogenen Rechten ißm darreicßte. Gleiche Form diefe
Gabe hatte, läßt fich fcßwerlid) fagen; der vielfach gebräuchliche Geller mit den Fifcßen
wird es 'gier nicht gewefen fein, eher fcßon eine Kanne, aus der pe einzufchenken im
Begriff war1. Ungewöhnlich bleibt bei diefer Deutung der Gruppe nur, daß die Geftalt
des Bettlers, die fonft dicht an den Füßen der Geiligen zu fteßen oder zu kauern pflegt,
in unferem Falle weit von ißr abgerückt ift — eine Freiheit, die pcß der Künftler nahm,
weil offenbar feinem fcüerk eine (Uandßäche zur Verfügung ftand, die eine breite Ent-
wickelung der Formen nahelegte und gewiß auch deshalb, weil er an dem freien Spiel
feiner überaus bewegten ümrißlimen feine Freude hatte und diefe pcß durch ein 3u-
fammendrängen der beiden Gepalten nicht verderben wollte.
In der Linken mag die Geilige ein Brot gehalten haben; das Gaupt fcßmückte waßr-
fäßeinlich eine Krone, denn von dem fonft üblichen Kopftuch müßten an den Schultern
Refte ficß erhalten haben. Statt deffen fallen einzelne lockige Strähnen des Gaares auf
die fcßmalen Schultern herab und erhöhen durch ißre Linien den Eindruck des fcßmäcß-
tigen, kindlich zarten Oberkörpers. Daß die Gruppe einmal an einer üüand oder einem
Pfeiler des Doms angebracht, zu deffen Ausftattung gehörte, ift pcßer. (Xlaßrfcheinlid)
wurde fie erft während der Uliederßerftellungsarbeiten unter dem Architekten Salzmann
in der 3eit um 1890 von ißrer urfprünglicßen Stelle entfernt. Croßdem ift keine Goff-
nung vorhanden, über diefen Plaß oder gar über die urfprünglicße Stiftung noch zu"
verläffige Quellen zum Reden zu bringen. Es bleibt alfo nur übrig, daß wir uns über
die künftlerifcßen und ftilgefcßicßtlichen Eigenfcßapen des Bildwerks Klarheit verfcßaffen
und daraus feine Entfteßungszeit beftimmen.
Und das wird nicht fcßwer fein; denn der erfte Blick überzeugt, daß wir es mit
einem Gebilde von ßöcßft ausgefprocßener, gefteigerter Eigenart zu tun haben, einem
fo prägnanten Beifpiel eines beftimmten Stils, wie es nur wenige gibt. Mit einem
temperamentvollen Schwung und mit offenficßtlicßer Freude am Übertreiben der Be-
wegungsmotive ift die Geftalt der Elifabetß ausgebogen in ißrer Körperacßfe bis weit
über die wirkliche Möglichkeit. Dadurch entfteßt ein Rhythmus tanzender, wogender
Bewegung, wie er fonft nur etwa von der beften Porzellanplaftik der Rokokozeit be-
kannt ift, ein Rhythmus, der erft zum vollen Ausdruck gebracht wird durch die Art,
wie die Gewandmaßen aufgeteilt und angeordnet find: An der linken ftark ausgebogenen
Güfte fällt die Kaskade zufammengefaßter Dütenfalten fteil fenkrecßt herunter. Die
Gauptmaffe des lang fcßleppenden üntergewandes legt fid) in drei tief eingefcßnittenen
Gauptpartien in ausgefcßwungenem Bogen vor dem rechten Fuß in breiten Falten ge-
brochen an die Erde. Ein Stück des Mantels fällt von der linken Schulter herab im
Bogen quer über den Leib und ift über den rechten Unterarm geworfen. So entfteßt
der S-förmigen Schwingung der Körperacßfe entfprecßend hier eine wagerecßt ver-
laufende S-Kurve von ftärkfter Scßattenwirkung. 3ugleicß bildet der Mantel fo vor
dem Leib eine für den Gewandstil bezeichnende tiefe Faltenmulde, die nach unten
ausklingt in zweimaliger Ödiederßolung in kleineren gleichgelagerten Mulden. Diefer
1 In der weiten baufchjigen Falte des Gewandes erkennt man einen Gegenßand etwa von der
Form einer Sonnenblume. Eine Möglichkeit bliebe noch in Erwägung zu ziehen, ob die Dar-
gepellte etwa Dorothea fein könnte; der Blumenkorb in der Rechten und eine einzelne Blume in
der Linken würden dem Bewegungsmotiv fd)on gerecht werden.
850
trüge auch nicht diefes Idealgewand mit großen Faltenbäufcßen, fondern eine bürger-
liche oder geiftlicße Gracht, wie fie feinem Stand entfpräcße. Älfo muß die Geftalt als
Begleiter der ^eiligen angefeßen werden. Als folcßen kennen wir die immer wieder-
kehrende, ftets in kleinem Maßftab neben der Geiligen erfcßeinende Geftalt des Krüppels
oder Bettlers, der von S. Elifabetß milde Gaben empfängt. Und fo deutet fid) offenbar
unfere Gruppe am ungezwungenften. Mit dem heute abgebrochenen linken Arm griff
der Bettler nach oben, nach der Gabe, die die heilige mjt vornehmer Gebärde aus der
im Gandgelenk ftark nach unten gebogenen Rechten ißm darreicßte. Gleiche Form diefe
Gabe hatte, läßt fich fcßwerlid) fagen; der vielfach gebräuchliche Geller mit den Fifcßen
wird es 'gier nicht gewefen fein, eher fcßon eine Kanne, aus der pe einzufchenken im
Begriff war1. Ungewöhnlich bleibt bei diefer Deutung der Gruppe nur, daß die Geftalt
des Bettlers, die fonft dicht an den Füßen der Geiligen zu fteßen oder zu kauern pflegt,
in unferem Falle weit von ißr abgerückt ift — eine Freiheit, die pcß der Künftler nahm,
weil offenbar feinem fcüerk eine (Uandßäche zur Verfügung ftand, die eine breite Ent-
wickelung der Formen nahelegte und gewiß auch deshalb, weil er an dem freien Spiel
feiner überaus bewegten ümrißlimen feine Freude hatte und diefe pcß durch ein 3u-
fammendrängen der beiden Gepalten nicht verderben wollte.
In der Linken mag die Geilige ein Brot gehalten haben; das Gaupt fcßmückte waßr-
fäßeinlich eine Krone, denn von dem fonft üblichen Kopftuch müßten an den Schultern
Refte ficß erhalten haben. Statt deffen fallen einzelne lockige Strähnen des Gaares auf
die fcßmalen Schultern herab und erhöhen durch ißre Linien den Eindruck des fcßmäcß-
tigen, kindlich zarten Oberkörpers. Daß die Gruppe einmal an einer üüand oder einem
Pfeiler des Doms angebracht, zu deffen Ausftattung gehörte, ift pcßer. (Xlaßrfcheinlid)
wurde fie erft während der Uliederßerftellungsarbeiten unter dem Architekten Salzmann
in der 3eit um 1890 von ißrer urfprünglicßen Stelle entfernt. Croßdem ift keine Goff-
nung vorhanden, über diefen Plaß oder gar über die urfprünglicße Stiftung noch zu"
verläffige Quellen zum Reden zu bringen. Es bleibt alfo nur übrig, daß wir uns über
die künftlerifcßen und ftilgefcßicßtlichen Eigenfcßapen des Bildwerks Klarheit verfcßaffen
und daraus feine Entfteßungszeit beftimmen.
Und das wird nicht fcßwer fein; denn der erfte Blick überzeugt, daß wir es mit
einem Gebilde von ßöcßft ausgefprocßener, gefteigerter Eigenart zu tun haben, einem
fo prägnanten Beifpiel eines beftimmten Stils, wie es nur wenige gibt. Mit einem
temperamentvollen Schwung und mit offenficßtlicßer Freude am Übertreiben der Be-
wegungsmotive ift die Geftalt der Elifabetß ausgebogen in ißrer Körperacßfe bis weit
über die wirkliche Möglichkeit. Dadurch entfteßt ein Rhythmus tanzender, wogender
Bewegung, wie er fonft nur etwa von der beften Porzellanplaftik der Rokokozeit be-
kannt ift, ein Rhythmus, der erft zum vollen Ausdruck gebracht wird durch die Art,
wie die Gewandmaßen aufgeteilt und angeordnet find: An der linken ftark ausgebogenen
Güfte fällt die Kaskade zufammengefaßter Dütenfalten fteil fenkrecßt herunter. Die
Gauptmaffe des lang fcßleppenden üntergewandes legt fid) in drei tief eingefcßnittenen
Gauptpartien in ausgefcßwungenem Bogen vor dem rechten Fuß in breiten Falten ge-
brochen an die Erde. Ein Stück des Mantels fällt von der linken Schulter herab im
Bogen quer über den Leib und ift über den rechten Unterarm geworfen. So entfteßt
der S-förmigen Schwingung der Körperacßfe entfprecßend hier eine wagerecßt ver-
laufende S-Kurve von ftärkfter Scßattenwirkung. 3ugleicß bildet der Mantel fo vor
dem Leib eine für den Gewandstil bezeichnende tiefe Faltenmulde, die nach unten
ausklingt in zweimaliger Ödiederßolung in kleineren gleichgelagerten Mulden. Diefer
1 In der weiten baufchjigen Falte des Gewandes erkennt man einen Gegenßand etwa von der
Form einer Sonnenblume. Eine Möglichkeit bliebe noch in Erwägung zu ziehen, ob die Dar-
gepellte etwa Dorothea fein könnte; der Blumenkorb in der Rechten und eine einzelne Blume in
der Linken würden dem Bewegungsmotiv fd)on gerecht werden.
850