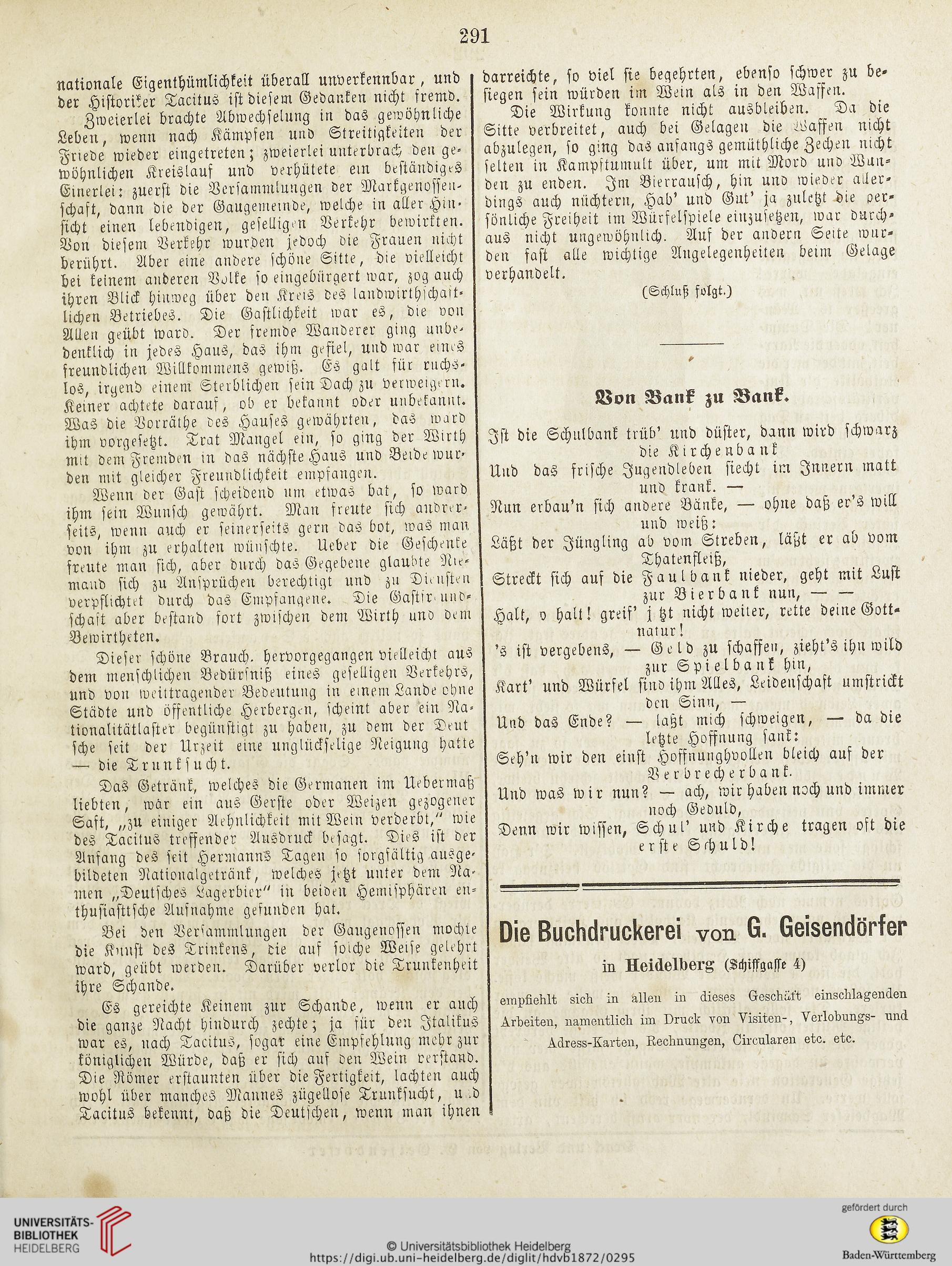nationale Eigenthümlichkeit überall unverkennbar, und
der Hiſtorider Tacitus iſt dieſem Gedanken nicht fremd.
Zweierlei brachte Abwechſelung in das gewöhnliche
Leben, wenn nach Kämpfen und Streitigkeiten der-
Friede wieder eingetreten; zweierlei unterbrach den ge-
wöhnlichen Kreislauf und verhütete ein beſtändiges
Einerlei: zuerſt die Verſammlungen der Markgenoſſen-
ſchaft, dann die der Gaugemeinde, welche in aller Hin ⸗
ſicht einen lebendigen, geſelligen Verkehr bewirkten.
Von dieſem Verkehr wurden jedoch die Frauen nicht
berührt. Aber eine andere ſchöne Sitte, die vielleicht
bei keinem anderen Volke ſo eingebürgert war, zog auch
ihren Blick hinweg über den Kreis des landwirthſchaft-
lichen Betriebes. Die Gaſtlichkeit war es, die von
Allen geübt ward. Der fremde Wanderer ging unbe-
denklich in jedes Haus, das ihm gefiel, und war eines
freundlichen Willkommens gewiß. Es galt für ruchs-
los, irgend einem Sterblichen ſein Dach zu verweigern.
Keiner achtete darauf, ob er bekannt oder unbekannt.
Was die Vorräthe des Hauſes gewährten, das ward
ihm vorgeſetzt. Trat Mangel ein, ſo ging der Wirth
mit dem Fremden in das nächſte Haus und Beide wur-
den mit gleicher Freundlichkeit empfangen.
Wenn der Gaſt ſcheidend um etwas bat, ſo ward-
ihm ſein Wunſch gewährt. Man freute ſich andrer-
ſeits, wenn auch er ſeinerſeits gern das bot, was man
von ihm zu erhalten wünſchte. Ueber die Geſchenke
freute man ſich, aber durch das Gegebene glaubte Nie-
mand ſich zu Anſprüchen berechtigt und zu Dienſten
verpflichtet durch das Empfangene.
ſchaft aber beſtand fort zwiſchen dem Wirth und dem
Bewirtheten.
Dieſer ſchöne Brauch. hervorgegangen vielleicht aus
dem menſchlichen Bedürſniß eines geſelligen Verkehrs,
und von weittragender Bedeutung in einem Lande ohne
Städte und öffentliche Herbergen, ſcheint aber ein Na-
tionalitätlaſter begünſtigt zu haben, zu dem der Deut
ſche ſeit der Urzeit eine unglückſelige Neigung hatte
— die Trunkſucht.
Das Getränk, welches die Germanen im Uebermaß
war ein aus Gerſte oder Weizen gezogener
liebten,
Saft, „zu einiger Aehnlichkeit mit Wein verderbt,“ wie
des Tacitus treffender Ausdruck beſagt. Dies iſt der
Anfang des ſeit Hermanns Tagen ſo ſorgfältig ausge-
bildeten Nationalgetränk,
thuſiaſttſche Aufnahme gefunden hat.
Bei den Verſammlungen der Gaugenoſſen mochie
die Kunſt des Trinkens, die auf ſoiche Weiſe gelehrt
ward, geübt werden. Darüber verlor die Trunkenheit
ihre Schande.
Es gereichte Keinem zur Schande, wenn er auch
die ganze Nacht hindurch zechte; ja für den Italikus
war es, nach Tacitus, ſogar eine Empfehlung mehr zur
königlichen Würde, daß er ſich auf den Wein verſtand.
Die Römer erſtaunten über die Fertigkeit, lachten auch
ö wohl über manches Mannes zügelloſe Trunkſucht, und
Tacitus bekennt, daß die Deutſchen, wenn man ihnen
Die Gaſtireund-
welches jetzt unter dem Na-
men „Deutſches Lagerbier“ in beiden Hemiſphären en-
darreichte, ſo viel ſie begehrten, ebenſo ſchwer zu be-
ſiegen ſein würden im Wein als in den Waffen.
Die Wirkung konnte nicht ausbleiben. Da die
Sitte verbreitet, auch bei Gelagen die Waffen nicht
abzulegen, ſo ging das anfangs gemüthliche Zechen nicht
ſelten in Kampftumult über, um mit Mord und Wun-
den zu enden. Im Bierrauſch, hin und wieder aller-
dings auch nüchtern, Hab' und Gut' ja zuletzt die der-
ſönliche Freiheit im Würfelſpiele einzuſetzen, war durch-
aus nicht ungewöhnlich. Auf der andern Seite wur-
den faſt alle wichtige Angelegenheiten beim Gelage
verhandelt. ö ö
(Schluß folgt.)
Von Bank zu Bank.
Iſt die Schulbank trüb' und düſter, dann wird ſchwarz
die Kirchenbank
Und das friſche Jugendleben ſiecht im Innern matt
und krank. —
Nun erbau'n ſich andere Bänke, — ohne daß er's will
und weiß:
Läßt der Jüngling ab vom Streben, läßt er ab vom
Thatenfleiß, —
Streckt ſich auf die Faulbank nieder, geht mit Luſt
zur Bierbank nun, — —
Halt, 0 halt! greif' jitzt nicht weiter, rette deine Gott-
natur!
5 iſt vergebens, — Geld zu ſbafter⸗ zieht's ihn wild
zur Spielbank hin,
Kart' und Würfel ſind ihm Alles, Leidenſchaft umſtrickt
den Sinn, —
Und das Ende? — laßt mich ſchweigen,
letzte Hoffnung ſank:
Seh'n wir den einſt Hoffnunghvollen bleich auf der
ö Verbrecherbank.
Und was wir nun? — ach, wir haben noch und immer
noch Geduld,
Denn wir wiſſen, Schul' und Kirche tragen oft die
erſte Schuld!
— da die
Die Buchdruckerei von G. Geisendörfer
in Heidelberg (Schiffgaſſe 4)
empfiehlt sich in allen in dieses Geschäft einschlagenden
Arbeiten, namentlich im Druck von Visiten-,
Verlobungs- und
Adress-Karten, Rechnungen, Circularen etc. etc.
der Hiſtorider Tacitus iſt dieſem Gedanken nicht fremd.
Zweierlei brachte Abwechſelung in das gewöhnliche
Leben, wenn nach Kämpfen und Streitigkeiten der-
Friede wieder eingetreten; zweierlei unterbrach den ge-
wöhnlichen Kreislauf und verhütete ein beſtändiges
Einerlei: zuerſt die Verſammlungen der Markgenoſſen-
ſchaft, dann die der Gaugemeinde, welche in aller Hin ⸗
ſicht einen lebendigen, geſelligen Verkehr bewirkten.
Von dieſem Verkehr wurden jedoch die Frauen nicht
berührt. Aber eine andere ſchöne Sitte, die vielleicht
bei keinem anderen Volke ſo eingebürgert war, zog auch
ihren Blick hinweg über den Kreis des landwirthſchaft-
lichen Betriebes. Die Gaſtlichkeit war es, die von
Allen geübt ward. Der fremde Wanderer ging unbe-
denklich in jedes Haus, das ihm gefiel, und war eines
freundlichen Willkommens gewiß. Es galt für ruchs-
los, irgend einem Sterblichen ſein Dach zu verweigern.
Keiner achtete darauf, ob er bekannt oder unbekannt.
Was die Vorräthe des Hauſes gewährten, das ward
ihm vorgeſetzt. Trat Mangel ein, ſo ging der Wirth
mit dem Fremden in das nächſte Haus und Beide wur-
den mit gleicher Freundlichkeit empfangen.
Wenn der Gaſt ſcheidend um etwas bat, ſo ward-
ihm ſein Wunſch gewährt. Man freute ſich andrer-
ſeits, wenn auch er ſeinerſeits gern das bot, was man
von ihm zu erhalten wünſchte. Ueber die Geſchenke
freute man ſich, aber durch das Gegebene glaubte Nie-
mand ſich zu Anſprüchen berechtigt und zu Dienſten
verpflichtet durch das Empfangene.
ſchaft aber beſtand fort zwiſchen dem Wirth und dem
Bewirtheten.
Dieſer ſchöne Brauch. hervorgegangen vielleicht aus
dem menſchlichen Bedürſniß eines geſelligen Verkehrs,
und von weittragender Bedeutung in einem Lande ohne
Städte und öffentliche Herbergen, ſcheint aber ein Na-
tionalitätlaſter begünſtigt zu haben, zu dem der Deut
ſche ſeit der Urzeit eine unglückſelige Neigung hatte
— die Trunkſucht.
Das Getränk, welches die Germanen im Uebermaß
war ein aus Gerſte oder Weizen gezogener
liebten,
Saft, „zu einiger Aehnlichkeit mit Wein verderbt,“ wie
des Tacitus treffender Ausdruck beſagt. Dies iſt der
Anfang des ſeit Hermanns Tagen ſo ſorgfältig ausge-
bildeten Nationalgetränk,
thuſiaſttſche Aufnahme gefunden hat.
Bei den Verſammlungen der Gaugenoſſen mochie
die Kunſt des Trinkens, die auf ſoiche Weiſe gelehrt
ward, geübt werden. Darüber verlor die Trunkenheit
ihre Schande.
Es gereichte Keinem zur Schande, wenn er auch
die ganze Nacht hindurch zechte; ja für den Italikus
war es, nach Tacitus, ſogar eine Empfehlung mehr zur
königlichen Würde, daß er ſich auf den Wein verſtand.
Die Römer erſtaunten über die Fertigkeit, lachten auch
ö wohl über manches Mannes zügelloſe Trunkſucht, und
Tacitus bekennt, daß die Deutſchen, wenn man ihnen
Die Gaſtireund-
welches jetzt unter dem Na-
men „Deutſches Lagerbier“ in beiden Hemiſphären en-
darreichte, ſo viel ſie begehrten, ebenſo ſchwer zu be-
ſiegen ſein würden im Wein als in den Waffen.
Die Wirkung konnte nicht ausbleiben. Da die
Sitte verbreitet, auch bei Gelagen die Waffen nicht
abzulegen, ſo ging das anfangs gemüthliche Zechen nicht
ſelten in Kampftumult über, um mit Mord und Wun-
den zu enden. Im Bierrauſch, hin und wieder aller-
dings auch nüchtern, Hab' und Gut' ja zuletzt die der-
ſönliche Freiheit im Würfelſpiele einzuſetzen, war durch-
aus nicht ungewöhnlich. Auf der andern Seite wur-
den faſt alle wichtige Angelegenheiten beim Gelage
verhandelt. ö ö
(Schluß folgt.)
Von Bank zu Bank.
Iſt die Schulbank trüb' und düſter, dann wird ſchwarz
die Kirchenbank
Und das friſche Jugendleben ſiecht im Innern matt
und krank. —
Nun erbau'n ſich andere Bänke, — ohne daß er's will
und weiß:
Läßt der Jüngling ab vom Streben, läßt er ab vom
Thatenfleiß, —
Streckt ſich auf die Faulbank nieder, geht mit Luſt
zur Bierbank nun, — —
Halt, 0 halt! greif' jitzt nicht weiter, rette deine Gott-
natur!
5 iſt vergebens, — Geld zu ſbafter⸗ zieht's ihn wild
zur Spielbank hin,
Kart' und Würfel ſind ihm Alles, Leidenſchaft umſtrickt
den Sinn, —
Und das Ende? — laßt mich ſchweigen,
letzte Hoffnung ſank:
Seh'n wir den einſt Hoffnunghvollen bleich auf der
ö Verbrecherbank.
Und was wir nun? — ach, wir haben noch und immer
noch Geduld,
Denn wir wiſſen, Schul' und Kirche tragen oft die
erſte Schuld!
— da die
Die Buchdruckerei von G. Geisendörfer
in Heidelberg (Schiffgaſſe 4)
empfiehlt sich in allen in dieses Geschäft einschlagenden
Arbeiten, namentlich im Druck von Visiten-,
Verlobungs- und
Adress-Karten, Rechnungen, Circularen etc. etc.