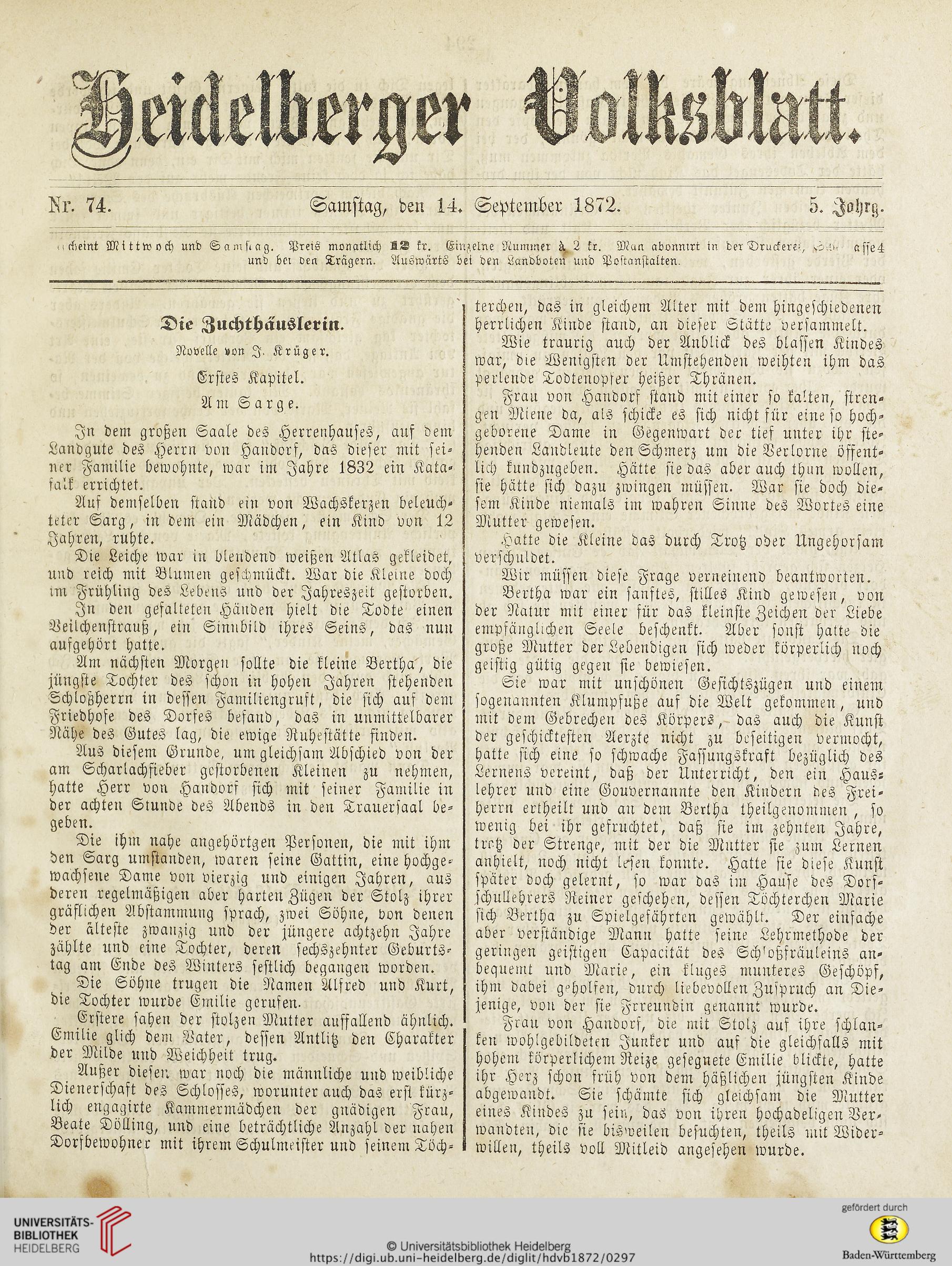Samſtag, den 14. September 1872. 5. Joahrg.
cheint Mittwoch und Samſtag. Preis monatlich 12 kr.
Einzelne Nummer
2 kr. Man abonnirt in der Druckeret, sdan aſſea
und bei dea Trägern. Auswärts bei den Landboten und Poſtanſtalten.
Die Zuchthäuslerin.
Novelle von J. Krüger.
Erſtes Kapitel.
Am Sarge.
In dem großen Saale des Herrenhauſes, auf dem
Landgute des Herrn von Handorf, das dieſer mit ſei-
ner Familie bewohnte, war im Jahre 1832 ein Kata-
falk errichtet.
Auf demſelben ſtand ein von Wachskerzen beleuch-
teter Sarg, in dem ein Mädchen, ein Kind von 12
Jahren, ruhte. ö ö
Die Leiche war in blendend weißen Atlas gekleidet,
und reich mit Blumen geſchmückt. War die Kleine doch
im Frühling des Lebens und der Jahreszeit geſtorben.
In den gefalteten Händen hielt die Todte einen
Veilchenſtrauß, ein Sinnbild ihres Seins, das nun
aufgehört hatte. ö
Am nächſten Morgen ſollte die kleine Bertha, die
jüngſte Tochter des ſchon in hohen Jahren ſtehenden
Schlozherrn in deſſen Familiengruft, die ſich auf dem
Friedhofe des Dorfes befand, das in unmittelbarer
Nähs des Gutes lag, die ewige Ruheſtätte finden.
Aus dieſem Grunde, um gleichſam Abſchied von der
am Scharlachfieber geſtorbenen Kleinen zu nehmen,
hatte Herr von Handorf ſich mit ſeiner Familie in
e achten Stunde des Abends in den Trauerſaal be-
geben. ö
Die ihm nahe angehörtgen Perſonen, die mit ihm
den Sarg umſtanden, waren ſeine Gattin, eine hochge-
wachſene Dame von vierzig und einigen Jahren, aus
deren regelmäßigen aber harten Zügen der Stolz ihrer
gräflichen Abſtammung ſprach, zwei Söhne, von denen
der älteſte zwanzig und der jüngere achtzehn Jahre
zählte und eine Tochter, deren ſechszehnter Geburts-
tag am Ende des Winters ſeſtlich begangen worden.
Die Söhne trugen die Namen Alfred und Kurt,
die Tochter wurde Emilie gerufen.
Erſtere ſahen der ſtolzen Mutter auffallend ähnlich.
Emilie glich dem Vater, deſſen Antlitz den Charakter
der Milde und Weichheit trug.
Außer dieſen war noch die männliche und weibliche
Die nerſchaft des Schloſſes, worunter auch das erſt kürz-
lich engagirte Kammermädchen der gnädigen Frau,
Beate Dölling, und eine beträchtliche Anzahl der nahen
Dorfbewohner mit ihrem Schulmeiſter und ſeinem Töch-
terchen, das in gleichem Alter mit dem hingeſchiedenen
herrlichen Kinde ſtand, an dieſer Stätte verſammelt.
Wie traurig auch der Anblick des blaſſen Kindes
war, die Wenigſten der Umſtehenden weihten ihm das
perlende Todtenopfer heißer Thränen. —
Frau von Handorf ſtand mit einer ſo kalten, ſtren-
gen Miene da, als ſchicke es ſich nicht für eine ſo hoch-
geborene Dame in Gegenwart der tief unter ihr ſte-
henden Landleute den Schmerz um die Verlorne öffent-
lich kundzugeben. Hätte ſie das aber auch thun wollen,
ſie hätte ſich dazu zwingen müſſen. War ſie doch die-
ſem Kinde niemals im wahren Sinne des Wortes eine
Mutter geweſen. ö ö
Hatte die Kleine das durch Trotz oder Ungehorſam
verſchuldet. ö
Wir müſſen dieſe Frage verneinend beantworten.
Bertha war ein ſanftes, ſtilles Kind geweſen, von
der Natur mit einer für das kleinſte Zeichen der Liebe
empfänglichen Seele beſchenkt. Aber ſonſt hatte die
große Mutter der Lebendigen ſich weder körperlich noch
geiſtig gütig gegen ſie bewieſen. ö
Sie war mit unſchönen Geſichtszügen und einem
ſogenannten Klumpfuße auf die Welt gekommen, und
mit dem Gebrechen des Körpers „ das auch die Kunſt
der geſchickteſten Aerzte nicht zu beſeitigen vermocht,
hatte ſich eine ſo ſchwache Faſſungskraft bezüglich des
Lernens vereint, daß der Unterricht, den ein Haus-
lehrer und eine Gouvernannte den Kindern des Frei-
herrn ertheilt und an dem Bertha theilgenommen, ſo
wenig bei ihr gefruchtet, daß ſie im zehnten Jahre,
tretz der Strenge, mit der die Mutter ſie zum Lernen
anhielt, noch nicht leſen konnte. Hatte ſie dieſe Kunſt
ſpäter doch gelernt, ſo war das im Hauſe des Dorf-
ſchullehrers Reiner geſchehen, deſſen Töchterchen Marie
ſich Bertha zu Spielgefährten gewählt. Der einfache
aber verſtändige Mann hatte ſeine Lehrmethode der
geringen geiſtigen Capacität des Schloßfräuleins an-
bequemt und Marie, ein kluges munteres Geſchöpf,
ihm dabei geholfen, durch liebevollen Zuſpruch an Die-
jenige, von der ſie Frreundin genannt wurde.
Frau von Handorf, die mit Stolz auf ihre ſchlan-
ken wohlgebildeten Junker und auf die gleichfalls mit
hohem körperlichem Reize geſegnete Emilie blickte, hatte
ihr Herz ſchon früh von dem häßlichen jüngſten Kinde
abgewandt. Sie ſchämte ſich gleichſam die Mutter
eines Kindes zu ſein, das von ihren hochadeligen Ver-
wandten, die ſie bisweilen beſuchten, theils mit Wider-
willen, theils voll Mitleid angeſehen wurde.
cheint Mittwoch und Samſtag. Preis monatlich 12 kr.
Einzelne Nummer
2 kr. Man abonnirt in der Druckeret, sdan aſſea
und bei dea Trägern. Auswärts bei den Landboten und Poſtanſtalten.
Die Zuchthäuslerin.
Novelle von J. Krüger.
Erſtes Kapitel.
Am Sarge.
In dem großen Saale des Herrenhauſes, auf dem
Landgute des Herrn von Handorf, das dieſer mit ſei-
ner Familie bewohnte, war im Jahre 1832 ein Kata-
falk errichtet.
Auf demſelben ſtand ein von Wachskerzen beleuch-
teter Sarg, in dem ein Mädchen, ein Kind von 12
Jahren, ruhte. ö ö
Die Leiche war in blendend weißen Atlas gekleidet,
und reich mit Blumen geſchmückt. War die Kleine doch
im Frühling des Lebens und der Jahreszeit geſtorben.
In den gefalteten Händen hielt die Todte einen
Veilchenſtrauß, ein Sinnbild ihres Seins, das nun
aufgehört hatte. ö
Am nächſten Morgen ſollte die kleine Bertha, die
jüngſte Tochter des ſchon in hohen Jahren ſtehenden
Schlozherrn in deſſen Familiengruft, die ſich auf dem
Friedhofe des Dorfes befand, das in unmittelbarer
Nähs des Gutes lag, die ewige Ruheſtätte finden.
Aus dieſem Grunde, um gleichſam Abſchied von der
am Scharlachfieber geſtorbenen Kleinen zu nehmen,
hatte Herr von Handorf ſich mit ſeiner Familie in
e achten Stunde des Abends in den Trauerſaal be-
geben. ö
Die ihm nahe angehörtgen Perſonen, die mit ihm
den Sarg umſtanden, waren ſeine Gattin, eine hochge-
wachſene Dame von vierzig und einigen Jahren, aus
deren regelmäßigen aber harten Zügen der Stolz ihrer
gräflichen Abſtammung ſprach, zwei Söhne, von denen
der älteſte zwanzig und der jüngere achtzehn Jahre
zählte und eine Tochter, deren ſechszehnter Geburts-
tag am Ende des Winters ſeſtlich begangen worden.
Die Söhne trugen die Namen Alfred und Kurt,
die Tochter wurde Emilie gerufen.
Erſtere ſahen der ſtolzen Mutter auffallend ähnlich.
Emilie glich dem Vater, deſſen Antlitz den Charakter
der Milde und Weichheit trug.
Außer dieſen war noch die männliche und weibliche
Die nerſchaft des Schloſſes, worunter auch das erſt kürz-
lich engagirte Kammermädchen der gnädigen Frau,
Beate Dölling, und eine beträchtliche Anzahl der nahen
Dorfbewohner mit ihrem Schulmeiſter und ſeinem Töch-
terchen, das in gleichem Alter mit dem hingeſchiedenen
herrlichen Kinde ſtand, an dieſer Stätte verſammelt.
Wie traurig auch der Anblick des blaſſen Kindes
war, die Wenigſten der Umſtehenden weihten ihm das
perlende Todtenopfer heißer Thränen. —
Frau von Handorf ſtand mit einer ſo kalten, ſtren-
gen Miene da, als ſchicke es ſich nicht für eine ſo hoch-
geborene Dame in Gegenwart der tief unter ihr ſte-
henden Landleute den Schmerz um die Verlorne öffent-
lich kundzugeben. Hätte ſie das aber auch thun wollen,
ſie hätte ſich dazu zwingen müſſen. War ſie doch die-
ſem Kinde niemals im wahren Sinne des Wortes eine
Mutter geweſen. ö ö
Hatte die Kleine das durch Trotz oder Ungehorſam
verſchuldet. ö
Wir müſſen dieſe Frage verneinend beantworten.
Bertha war ein ſanftes, ſtilles Kind geweſen, von
der Natur mit einer für das kleinſte Zeichen der Liebe
empfänglichen Seele beſchenkt. Aber ſonſt hatte die
große Mutter der Lebendigen ſich weder körperlich noch
geiſtig gütig gegen ſie bewieſen. ö
Sie war mit unſchönen Geſichtszügen und einem
ſogenannten Klumpfuße auf die Welt gekommen, und
mit dem Gebrechen des Körpers „ das auch die Kunſt
der geſchickteſten Aerzte nicht zu beſeitigen vermocht,
hatte ſich eine ſo ſchwache Faſſungskraft bezüglich des
Lernens vereint, daß der Unterricht, den ein Haus-
lehrer und eine Gouvernannte den Kindern des Frei-
herrn ertheilt und an dem Bertha theilgenommen, ſo
wenig bei ihr gefruchtet, daß ſie im zehnten Jahre,
tretz der Strenge, mit der die Mutter ſie zum Lernen
anhielt, noch nicht leſen konnte. Hatte ſie dieſe Kunſt
ſpäter doch gelernt, ſo war das im Hauſe des Dorf-
ſchullehrers Reiner geſchehen, deſſen Töchterchen Marie
ſich Bertha zu Spielgefährten gewählt. Der einfache
aber verſtändige Mann hatte ſeine Lehrmethode der
geringen geiſtigen Capacität des Schloßfräuleins an-
bequemt und Marie, ein kluges munteres Geſchöpf,
ihm dabei geholfen, durch liebevollen Zuſpruch an Die-
jenige, von der ſie Frreundin genannt wurde.
Frau von Handorf, die mit Stolz auf ihre ſchlan-
ken wohlgebildeten Junker und auf die gleichfalls mit
hohem körperlichem Reize geſegnete Emilie blickte, hatte
ihr Herz ſchon früh von dem häßlichen jüngſten Kinde
abgewandt. Sie ſchämte ſich gleichſam die Mutter
eines Kindes zu ſein, das von ihren hochadeligen Ver-
wandten, die ſie bisweilen beſuchten, theils mit Wider-
willen, theils voll Mitleid angeſehen wurde.