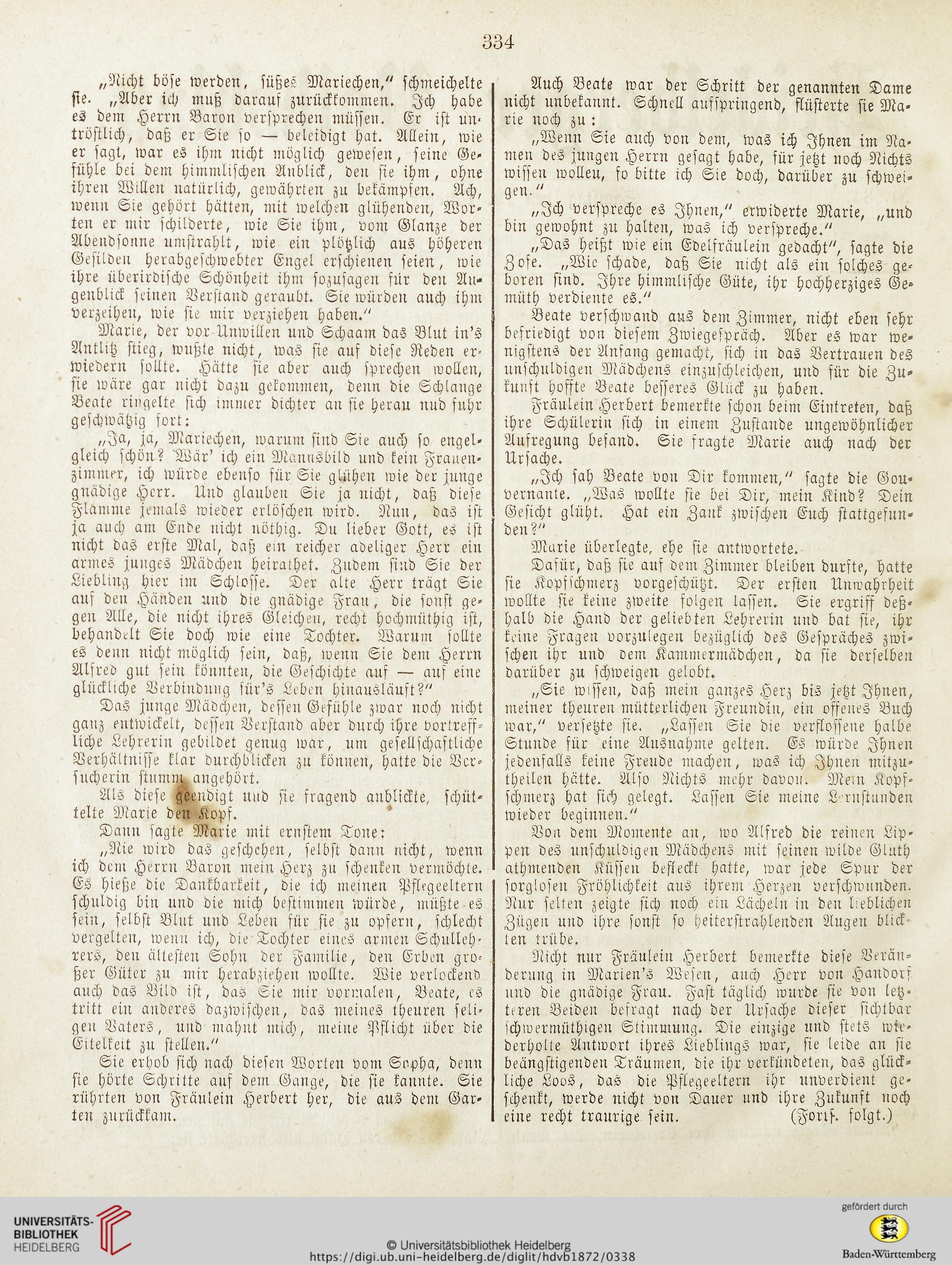334
„Nicht böſe werden, ſüßes Mariechen,“ ſchmeichelte
ſie. „Aber ich muß darauf zurückkommen. Ich habe
es dem Herrn Baron verſprechen müſſen. Er iſt un-
tröſtlich, daß er Sie ſo — beleidigt hat. Allein, wie
er ſagt, war es ihm nicht möglich geweſen, ſeine Ge-
fühle bei dem himmliſchen Anblick, den ſie ihm, ohne
ihren Willen natürlich, gewährten zu bekämpfen. Ach,
wenn Sie gehört hätten, mit welchen glühenden, Wor-
ten er mir ſchilderte, wie Sie ihm, vom Glanze der
Abendſonne umſtrahlt, wie ein plötzlich aus höheren
Geſilden herabgeſchwebter Engel erſchienen ſeien, wie
ihre überirdiſche Schönheit ihm ſozuſagen für den Au-
genblick ſeinen Verſtand geraubt. Sie würden auch ihm
verzeihen, wie ſie mir verziehen haben.“
Marie, der vor Unwillen und Schaam das Blut in's
Antlitz ſtieg, wußte nicht, was ſie auf dieſe Reden er-
wiedern ſollte. Hätte ſie aber auch ſprechen wollen,
ſie wäre gar nicht dazu gekommen, denn die Schlange
Beate ringelte ſich immer dichter an ſie herau nud fuhr
geſchwätzig fort: ö
„Ja, ja, Mariechen, warum ſind Sie auch ſo engel-
gleich ſchön? Wär' ich ein Mannsbild und kein Frauen-
zimmer, ich würde ebenſo für Sie glühen wie der junge
gnädige Herr. Und glauben Sie ja nicht, daß dieſe
Flamme jemals wieder erlöſchen wird. Nun, das iſt
ja auch am Ende nicht nöthig. Du lieber Gott, es iſt
nicht das erſte Mal, daß ein reicher adeliger Herr ein
armes junges Mädchen heirathet. Zudem ſind Sie der
Liebling hier im Schloſſe. Der alte Herr trägt Sie
auf den Händen und die gnädige Frau, die ſonſt ge-
gen Alle, die nicht ihres Gleichen, recht hochmüthig iſt,
behandelt Sie doch wie eine Tochter. Warum ſollte
es denn nicht möglich ſein, daß, wenn Sie dem Herrn
Alfred gut ſein könnten, die Geſchichte auf — auf eine
glückliche Verbindung für's Leben hinausläuft?“
Das junge Mädchen, deſſen Gefühle zwar noch nicht
ganz entwickelt, deſſen Verſtand aber durch ihre vortreff-
liche Lehrerin gebildet genug war, um geſellſchaftliche
Verhältniſſe klar durchblicken zu können, hatte die Ver-
ſucherin ſtumm angehört. ö
Als dieſe Udigt und ſie fragend anblickte, ſchüt-
telte Marie dopf.
Dann ſagte Marie mit ernſtem Tone:
„Nie wird das geſchehen, ſelbſt dann nicht, wenn
ich dem Herrn Baron mein Herz zu ſchenken vermöchte.
Es hieße die Dankbarkeit, die ich meinen Pflegeeltern
ſchuldig bin und die mich beſtimmen würde, müßte es
ſein, ſelbſt Blut und Leben für ſie zu opfern, ſchlecht
vergelten, wenn ich, die Tochter eines armen Schulleh-
rers, den älteſten Sohn der Familie, den Erben gro-
ßer Güter zu mir herabziehen wollte. Wie verlockend
auch das Bild iſt, das Sie mir vormalen, Beate, es
tritt ein anderes dazwiſchen, das meines theuren ſeli-
gen Vaters, und mahnt mich, meine Pflicht über die
Eitelkeit zu ſtellen.“ — ö
Sie erhob ſich nach dieſen Worten vom Sopha, denn
ſie hörte Schritte auf dem Gange, die ſie kannte. Sie
rührten von Fräulein Herbert her, die aus dem Gar-
ten zurückkam. ö
Auch Beate war der Schritt der genannten Dame
nicht unbekannt. Schnell aufſpringend, flüſterte ſie Ma-
rie noch zu: ö
„Wenn Sie auch von dem, was ich Ihnen im Na-
men des jungen Herrn geſagt habe, für jetzt noch Nichts
wiſſen wolleu, fo bitte ich Sie doch, darüber zu ſchwei-
gen. ö
„Ich verſpreche es Ihnen,“ erwiderte Marie, „und
bin gewohnt zu halten, was ich verſpreche.“
„Das heißt wie ein Edelfräulein gedacht“, ſagte die
Zofe. „Wie ſchade, daß Sie nicht als ein ſolches ge-
boren ſind. Ihre himmliſche Güte, ihr hochherziges Ge-
müth verdiente es.“
Beate verſchwand aus dem Zimmer, nicht eben ſehr
befriedigt von dieſem Zwiegeſpräch. Aber es war we-
nigſtens der Anfang gemacht, ſich in das Vertrauen des
unſchuldigen Mädchens einzuſchleichen, und für die Zu-
kunft hoffte Beate beſſeres Glück zu haben.
Fräulein Herbert bemerkte ſchon beim Eintreten, daß
ihre Schülerin ſich in einem Zuſtande ungewöhnlicher
Aufregung befand. Sie fragte Marie auch nach der
Urſache.
„Ich ſah Beate von Dir kommen,“ ſagte die Gou-
vernante. „Was wollte fie bei Dir, mein Kind? Dein
Geſicht glüht. Hat ein Zank zwiſchen Euch ſtattgefun-
den?“ ö
Marie überlegte, ehe ſie antwortete.
Dafür, daß ſie auf dem Zimmer bleiben durfte, hatte
ſie Kopfſchmerz vorgeſchützt. Der erſten Unwahrheit
wollte ſie keine zweite folgen laſſen. Sie ergriff deß-
halb die Hand der geliebten Lehrerin und bat ſie, ihr
keine Fragen vorzulegen bezüglich des Geſpräches zwi-
ſchen ihr und dem Kammermädchen, da ſie derſelben
darüber zu ſchweigen gelobt.
„Sie wiſſen, daß mein ganzes Herz bis jetzt Ihnen,
meiner theuren mütterlichen Freundin, ein offenes Buch
war,“ verſetzte ſie. „Laſſen Sie die verfloſſene halbe
Stunde für eine Ausnahme gelten. Es würde Ihnen
jedenfalls keine Freude machen, was ich Ihnen mitzu-—
theilen hätte. Alſo Nichts mehr davon. Mein Kopf-
ſchmerz hat ſich gelegt. Laſſen Sie meine Lernſtunden
wieder beginnen.“
Von dem Momente an, wo Alfred die reinen Lip-
pen des unſchuldigen Mädchens mit ſeinen wilde Gluth
athmenden Küſſen befleckt hatte, war jede Spur der
ſorgloſen Fröhlichkeit aus ihrem Herzen verſchwunden.
Nur ſelten zeigte ſich noch ein Lächeln in den lieblichen
Zügen und ihre ſonſt ſo heiterſtrahlenden Augen blick-
ten trübe.
Nicht nur Fräulein Herbert bemerkte dieſe Verän-
derung in Marien's Weſen, auch Herr von Handorf
und die gnädige Frau. Faſt täglich wurde ſie von letz-
teren Beiden befragt nach der Urſache dieſer ſichtbar
ſchwermüthigen Stimmung. Die einzige und ſtets wie-
derholte Antwort ihres Lieblings war, ſie leide an ſie
beängſtigenden Träumen, die ihr verkündeten, das glück-
liche Loos, das die Pflegeeltern ihr unverdient ge-
ſchenkt, werde nicht von Dauer und ihre Zukunft noch
eine recht traurige ſein. (Fortf. folgt.)
„Nicht böſe werden, ſüßes Mariechen,“ ſchmeichelte
ſie. „Aber ich muß darauf zurückkommen. Ich habe
es dem Herrn Baron verſprechen müſſen. Er iſt un-
tröſtlich, daß er Sie ſo — beleidigt hat. Allein, wie
er ſagt, war es ihm nicht möglich geweſen, ſeine Ge-
fühle bei dem himmliſchen Anblick, den ſie ihm, ohne
ihren Willen natürlich, gewährten zu bekämpfen. Ach,
wenn Sie gehört hätten, mit welchen glühenden, Wor-
ten er mir ſchilderte, wie Sie ihm, vom Glanze der
Abendſonne umſtrahlt, wie ein plötzlich aus höheren
Geſilden herabgeſchwebter Engel erſchienen ſeien, wie
ihre überirdiſche Schönheit ihm ſozuſagen für den Au-
genblick ſeinen Verſtand geraubt. Sie würden auch ihm
verzeihen, wie ſie mir verziehen haben.“
Marie, der vor Unwillen und Schaam das Blut in's
Antlitz ſtieg, wußte nicht, was ſie auf dieſe Reden er-
wiedern ſollte. Hätte ſie aber auch ſprechen wollen,
ſie wäre gar nicht dazu gekommen, denn die Schlange
Beate ringelte ſich immer dichter an ſie herau nud fuhr
geſchwätzig fort: ö
„Ja, ja, Mariechen, warum ſind Sie auch ſo engel-
gleich ſchön? Wär' ich ein Mannsbild und kein Frauen-
zimmer, ich würde ebenſo für Sie glühen wie der junge
gnädige Herr. Und glauben Sie ja nicht, daß dieſe
Flamme jemals wieder erlöſchen wird. Nun, das iſt
ja auch am Ende nicht nöthig. Du lieber Gott, es iſt
nicht das erſte Mal, daß ein reicher adeliger Herr ein
armes junges Mädchen heirathet. Zudem ſind Sie der
Liebling hier im Schloſſe. Der alte Herr trägt Sie
auf den Händen und die gnädige Frau, die ſonſt ge-
gen Alle, die nicht ihres Gleichen, recht hochmüthig iſt,
behandelt Sie doch wie eine Tochter. Warum ſollte
es denn nicht möglich ſein, daß, wenn Sie dem Herrn
Alfred gut ſein könnten, die Geſchichte auf — auf eine
glückliche Verbindung für's Leben hinausläuft?“
Das junge Mädchen, deſſen Gefühle zwar noch nicht
ganz entwickelt, deſſen Verſtand aber durch ihre vortreff-
liche Lehrerin gebildet genug war, um geſellſchaftliche
Verhältniſſe klar durchblicken zu können, hatte die Ver-
ſucherin ſtumm angehört. ö
Als dieſe Udigt und ſie fragend anblickte, ſchüt-
telte Marie dopf.
Dann ſagte Marie mit ernſtem Tone:
„Nie wird das geſchehen, ſelbſt dann nicht, wenn
ich dem Herrn Baron mein Herz zu ſchenken vermöchte.
Es hieße die Dankbarkeit, die ich meinen Pflegeeltern
ſchuldig bin und die mich beſtimmen würde, müßte es
ſein, ſelbſt Blut und Leben für ſie zu opfern, ſchlecht
vergelten, wenn ich, die Tochter eines armen Schulleh-
rers, den älteſten Sohn der Familie, den Erben gro-
ßer Güter zu mir herabziehen wollte. Wie verlockend
auch das Bild iſt, das Sie mir vormalen, Beate, es
tritt ein anderes dazwiſchen, das meines theuren ſeli-
gen Vaters, und mahnt mich, meine Pflicht über die
Eitelkeit zu ſtellen.“ — ö
Sie erhob ſich nach dieſen Worten vom Sopha, denn
ſie hörte Schritte auf dem Gange, die ſie kannte. Sie
rührten von Fräulein Herbert her, die aus dem Gar-
ten zurückkam. ö
Auch Beate war der Schritt der genannten Dame
nicht unbekannt. Schnell aufſpringend, flüſterte ſie Ma-
rie noch zu: ö
„Wenn Sie auch von dem, was ich Ihnen im Na-
men des jungen Herrn geſagt habe, für jetzt noch Nichts
wiſſen wolleu, fo bitte ich Sie doch, darüber zu ſchwei-
gen. ö
„Ich verſpreche es Ihnen,“ erwiderte Marie, „und
bin gewohnt zu halten, was ich verſpreche.“
„Das heißt wie ein Edelfräulein gedacht“, ſagte die
Zofe. „Wie ſchade, daß Sie nicht als ein ſolches ge-
boren ſind. Ihre himmliſche Güte, ihr hochherziges Ge-
müth verdiente es.“
Beate verſchwand aus dem Zimmer, nicht eben ſehr
befriedigt von dieſem Zwiegeſpräch. Aber es war we-
nigſtens der Anfang gemacht, ſich in das Vertrauen des
unſchuldigen Mädchens einzuſchleichen, und für die Zu-
kunft hoffte Beate beſſeres Glück zu haben.
Fräulein Herbert bemerkte ſchon beim Eintreten, daß
ihre Schülerin ſich in einem Zuſtande ungewöhnlicher
Aufregung befand. Sie fragte Marie auch nach der
Urſache.
„Ich ſah Beate von Dir kommen,“ ſagte die Gou-
vernante. „Was wollte fie bei Dir, mein Kind? Dein
Geſicht glüht. Hat ein Zank zwiſchen Euch ſtattgefun-
den?“ ö
Marie überlegte, ehe ſie antwortete.
Dafür, daß ſie auf dem Zimmer bleiben durfte, hatte
ſie Kopfſchmerz vorgeſchützt. Der erſten Unwahrheit
wollte ſie keine zweite folgen laſſen. Sie ergriff deß-
halb die Hand der geliebten Lehrerin und bat ſie, ihr
keine Fragen vorzulegen bezüglich des Geſpräches zwi-
ſchen ihr und dem Kammermädchen, da ſie derſelben
darüber zu ſchweigen gelobt.
„Sie wiſſen, daß mein ganzes Herz bis jetzt Ihnen,
meiner theuren mütterlichen Freundin, ein offenes Buch
war,“ verſetzte ſie. „Laſſen Sie die verfloſſene halbe
Stunde für eine Ausnahme gelten. Es würde Ihnen
jedenfalls keine Freude machen, was ich Ihnen mitzu-—
theilen hätte. Alſo Nichts mehr davon. Mein Kopf-
ſchmerz hat ſich gelegt. Laſſen Sie meine Lernſtunden
wieder beginnen.“
Von dem Momente an, wo Alfred die reinen Lip-
pen des unſchuldigen Mädchens mit ſeinen wilde Gluth
athmenden Küſſen befleckt hatte, war jede Spur der
ſorgloſen Fröhlichkeit aus ihrem Herzen verſchwunden.
Nur ſelten zeigte ſich noch ein Lächeln in den lieblichen
Zügen und ihre ſonſt ſo heiterſtrahlenden Augen blick-
ten trübe.
Nicht nur Fräulein Herbert bemerkte dieſe Verän-
derung in Marien's Weſen, auch Herr von Handorf
und die gnädige Frau. Faſt täglich wurde ſie von letz-
teren Beiden befragt nach der Urſache dieſer ſichtbar
ſchwermüthigen Stimmung. Die einzige und ſtets wie-
derholte Antwort ihres Lieblings war, ſie leide an ſie
beängſtigenden Träumen, die ihr verkündeten, das glück-
liche Loos, das die Pflegeeltern ihr unverdient ge-
ſchenkt, werde nicht von Dauer und ihre Zukunft noch
eine recht traurige ſein. (Fortf. folgt.)