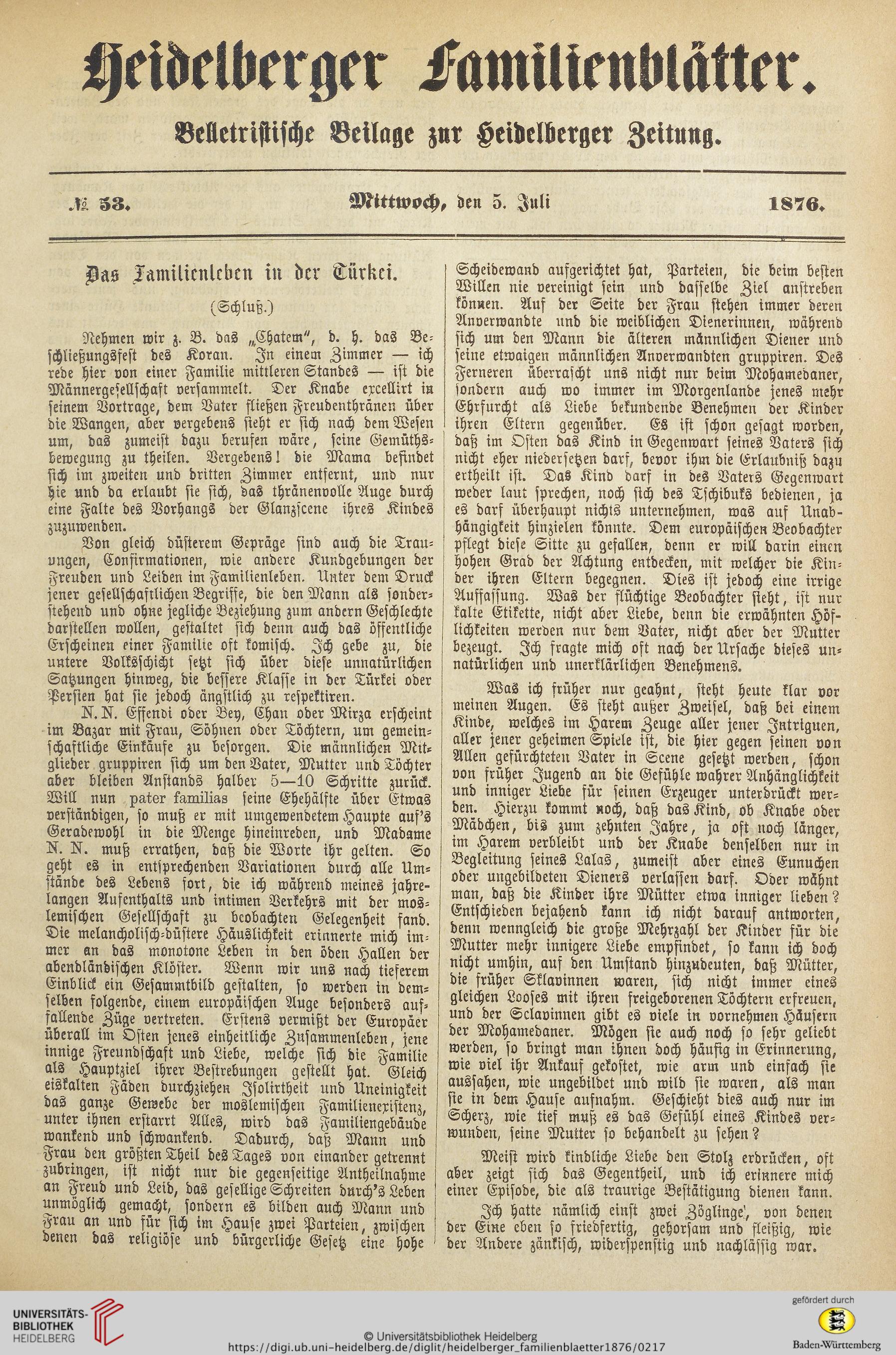Heidelberger Familienblätter.
Belletriſtiſche Beilage zur Heidelberger Zeitung.
Mittwoch, den 5. Juli
1876.
Das Tamilienleben in der Türkei.
(Schluß.)
Nehmen wir z. B. das „Chatem“, d. h. das Be-
ſchließungsfeſt des Koran. In einem Zimmer — ich
rede hier von einer Familie mittleren Standes — iſt die
Männergeſellſchaft verſammelt. Der Knabe excellirt in
ſeinem Vortrage, dem Vater fließen Freudenthränen über
die Wangen, aber vergebens ſieht er ſich nach dem Weſen
um, das zumeiſt dazu berufen wäre, ſeine Gemüths-
bewegung zu theilen. Vergebens! die Mama befindet
ſich im zweiten und dritten Zimmer entfernt, und nur
hie und da erlaubt ſie ſich, das thränenvolle Auge durch
eine Falte des Vorhangs der Glanzſcene ihres Kindes
zuzuwenden. *
Von gleich düſterem Gepräge ſind auch die Trau-
ungen, Confirmationen, wie andere Kundgebungen der
Freuden und Leiden im Familienleben. Unter dem Druck
jener geſellſchaftlichen Begriffe, die den Mann als ſonder-
ſtehend und ohne jegliche Beziehung zum andern Geſchlechte
darſtellen wollen, geſtaltet ſich denn auch das öffentliche
Erſcheinen einer Familie oft komiſch. Ich gebe zu, die
untere Volksſchicht ſetzt ſich über dieſe unnatürlichen
Satzungen hinweg, die beſſere Klaſſe in der Türkei oder
Perſien hat ſie jedoch ängſtlich zu reſpektiren.
N. N. Effendi oder Bey, Chan oder Mirza erſcheint
im Bazar mit Frau, Söhnen oder Töchtern, um gemein-
ſchaftliche Einkäufe zu beſorgen. Die männlichen Mit-
glieder gruppiren ſich um den Vater, Mutter und Töchter
aber bleiben Anſtands halber 5—10 Schritte zurück.
Will nun pater familias ſeine Ehehälfte über Etwas
verſtändigen, ſo muß er mit umgewendetem Haupte auf's
Geradewohl in die Menge hineinreden, und Madame
N. N. muß errathen, daß die Worte ihr gelten. So
geht es in entſprechenden Variationen durch alle Um-
ſtände des Lebens fort, die ich während meines jahre-
langen Aufenthalts und intimen Verkehrs mit der mos-
lemiſchen Geſellſchaft zu beobachten Gelegenheit fand.
Die melancholiſch⸗düſtere Häuslichkeit erinnerte mich im-
mer an das monotone Leben in den öden Hallen der
abendländiſchen Klöſter. Wenn wir uns nach tieferem
Einblick ein Geſammtbild geſtalten, ſo werden in dem-
ſelben folgende, einem europäiſchen Auge beſonders auf-
fallende Züge vertreten. Erſtens vermißt der Europäer
überall im Oſten jenes einheitliche Zuſammenleben, jene
innige Freundſchaft und Liebe, welche ſich die Familie
als Hauptziel ihrer Beſtrebungen geſtellt hat. Gleich
eiskalten Fäden durchziehen Iſolirtheit und Uneinigkeit
das ganze Gewebe der moslemiſchen Familienexiſtenz,
unter ihnen erſtarrt Alles, wird das Familiengebäude
wankend und ſchwankend. Dadurch, daß Mann und
Frau den größten Theil des Tages von einander getrennt
zubringen, iſt nicht nur die gegenſeitige Antheilnahme
an Freud und Leid, das geſellige Schreiten durch's Leben
unmöglich gemacht, ſondern es bilden auch Mann und
Frau an und für ſich im Hauſe zwei Parteien, zwiſchen
denen das religiöſe und bürgerliche Geſetz eine hohe
Scheidewand aufgerichtet hat, Parteien, die beim beſten
Willen nie vereinigt ſein und daſſelbe Ziel anſtreben
können. Auf der Seite der Frau ſtehen immer deren
Anverwandte und die weiblichen Dienerinnen, während
ſich um den Mann die älteren männlichen Diener und
ſeine etwaigen männlichen Anverwandten gruppiren. Des
Ferneren überraſcht uns nicht nur beim Mohamedaner,
ſondern auch wo immer im Morgenlande jenes mehr
Ehrfurcht als Liebe bekundende Benehmen der Kinder
ihren Eltern gegenüber. Es ift ſchon geſagt worden,
daß im Oſten das Kind in Gegenwart ſeines Vaters ſich
nicht eher niederſetzen darf, bevor ihm die Erlaubniß dazu
ertheilt iſt. Das Kind darf in des Vaters Gegenwart
weder laut ſprechen, noch ſich des Tſchibuks bedienen, ja
es darf überhaupt nichts unternehmen, was auf Unab-
hängigkeit hinzielen könnte. Dem europäiſchen Beobachter
pflegt dieſe Sitte zu gefallen, denn er will darin einen
hohen Grad der Achtung entdecken, mit welcher die Kin-
der ihren Eltern begegnen. Dies iſt jedoch eine irrige
Auffaſſung. Was der flüchtige Beobachter ſieht, iſt nur
kalte Etikette, nicht aber Liebe, denn die erwähnten Höf-
lichkeiten werden nur dem Vater, nicht aber der Mutter
bezeugt. Ich fragte mich oft nach der Urſache dieſes un-
natürlichen und unerklärlichen Benehmens. ö
Was ich früher nur geahnt, ſteht heute klar vor
meinen Augen. Es ſteht außer Zweiſel, daß bei einem
Kinde, welches im Harem Zeuge aller jener Intriguen,
aller jener geheimen Spiele iſt, die hier gegen ſeinen von
Allen gefürchteten Vater in Scene geſetzt werden, ſchon
von früher Jugend an die Gefühle wahrer Anhänglichkeit
und inniger Liebe für ſeinen Erzeuger unterdrückt wer-
den. Hierzu kommt noch, daß das Kind, ob Knabe oder
Mädchen, bis zum zehnten Jahre, ja oft noch länger,
im Harem verbleibt und der Knabe denſelben nur in
Begleitung ſeines Lalas, zumeiſt aber eines Eunuchen
oder ungebildeten Dieners verlaſſen darf. Oder wähnt
man, daß die Kinder ihre Mütter etwa inniger lieben?
Entſchieden bejahend kann ich nicht darauf antworten,
denn wenngleich die große Mehrzahl der Kinder für die
Mutter mehr innigere Liebe empfindet, ſo kann ich doch
nicht umhin, auf den Umſtand hinzudeuten, daß Mütter,
die früher Sklavinnen waren, ſich nicht immer eines
gleichen Looſes mit ihren freigeborenen Töchtern erfreuen,
und der Sclavinnen gibt es viele in vornehmen Häuſern
der Mohamedaner. Mogen ſie auch noch ſo ſehr geliebt
werden, ſo bringt man ihnen doch häufig in Erinnerung,
wie viel ihr Ankauf gekoſtet, wie arm und einfach ſie
ausſahen, wie ungebildet und wild ſie waren, als man
ſie in dem Hauſe aufnahm. Geſchieht dies auch nur im
Scherz, wie tief muß es das Gefühl eines Kindes ver-
wunden, ſeine Mutter ſo behandelt zu ſehen?
Meiſt wird kindliche Liebe den Stolz erdrücken, oft
aber zeigt ſich das Gegentheil, und ich erinnere mich
einer Epiſode, die als traurige Beſtätigung dienen kann.
Ich hatte nämlich einſt zwei Zöglinge, von denen
der Eine eben ſo friedfertig, gehorſam und fleißig, wie
der Andere zänkiſch, widerſpenſtig und nachläſſig war.
Belletriſtiſche Beilage zur Heidelberger Zeitung.
Mittwoch, den 5. Juli
1876.
Das Tamilienleben in der Türkei.
(Schluß.)
Nehmen wir z. B. das „Chatem“, d. h. das Be-
ſchließungsfeſt des Koran. In einem Zimmer — ich
rede hier von einer Familie mittleren Standes — iſt die
Männergeſellſchaft verſammelt. Der Knabe excellirt in
ſeinem Vortrage, dem Vater fließen Freudenthränen über
die Wangen, aber vergebens ſieht er ſich nach dem Weſen
um, das zumeiſt dazu berufen wäre, ſeine Gemüths-
bewegung zu theilen. Vergebens! die Mama befindet
ſich im zweiten und dritten Zimmer entfernt, und nur
hie und da erlaubt ſie ſich, das thränenvolle Auge durch
eine Falte des Vorhangs der Glanzſcene ihres Kindes
zuzuwenden. *
Von gleich düſterem Gepräge ſind auch die Trau-
ungen, Confirmationen, wie andere Kundgebungen der
Freuden und Leiden im Familienleben. Unter dem Druck
jener geſellſchaftlichen Begriffe, die den Mann als ſonder-
ſtehend und ohne jegliche Beziehung zum andern Geſchlechte
darſtellen wollen, geſtaltet ſich denn auch das öffentliche
Erſcheinen einer Familie oft komiſch. Ich gebe zu, die
untere Volksſchicht ſetzt ſich über dieſe unnatürlichen
Satzungen hinweg, die beſſere Klaſſe in der Türkei oder
Perſien hat ſie jedoch ängſtlich zu reſpektiren.
N. N. Effendi oder Bey, Chan oder Mirza erſcheint
im Bazar mit Frau, Söhnen oder Töchtern, um gemein-
ſchaftliche Einkäufe zu beſorgen. Die männlichen Mit-
glieder gruppiren ſich um den Vater, Mutter und Töchter
aber bleiben Anſtands halber 5—10 Schritte zurück.
Will nun pater familias ſeine Ehehälfte über Etwas
verſtändigen, ſo muß er mit umgewendetem Haupte auf's
Geradewohl in die Menge hineinreden, und Madame
N. N. muß errathen, daß die Worte ihr gelten. So
geht es in entſprechenden Variationen durch alle Um-
ſtände des Lebens fort, die ich während meines jahre-
langen Aufenthalts und intimen Verkehrs mit der mos-
lemiſchen Geſellſchaft zu beobachten Gelegenheit fand.
Die melancholiſch⸗düſtere Häuslichkeit erinnerte mich im-
mer an das monotone Leben in den öden Hallen der
abendländiſchen Klöſter. Wenn wir uns nach tieferem
Einblick ein Geſammtbild geſtalten, ſo werden in dem-
ſelben folgende, einem europäiſchen Auge beſonders auf-
fallende Züge vertreten. Erſtens vermißt der Europäer
überall im Oſten jenes einheitliche Zuſammenleben, jene
innige Freundſchaft und Liebe, welche ſich die Familie
als Hauptziel ihrer Beſtrebungen geſtellt hat. Gleich
eiskalten Fäden durchziehen Iſolirtheit und Uneinigkeit
das ganze Gewebe der moslemiſchen Familienexiſtenz,
unter ihnen erſtarrt Alles, wird das Familiengebäude
wankend und ſchwankend. Dadurch, daß Mann und
Frau den größten Theil des Tages von einander getrennt
zubringen, iſt nicht nur die gegenſeitige Antheilnahme
an Freud und Leid, das geſellige Schreiten durch's Leben
unmöglich gemacht, ſondern es bilden auch Mann und
Frau an und für ſich im Hauſe zwei Parteien, zwiſchen
denen das religiöſe und bürgerliche Geſetz eine hohe
Scheidewand aufgerichtet hat, Parteien, die beim beſten
Willen nie vereinigt ſein und daſſelbe Ziel anſtreben
können. Auf der Seite der Frau ſtehen immer deren
Anverwandte und die weiblichen Dienerinnen, während
ſich um den Mann die älteren männlichen Diener und
ſeine etwaigen männlichen Anverwandten gruppiren. Des
Ferneren überraſcht uns nicht nur beim Mohamedaner,
ſondern auch wo immer im Morgenlande jenes mehr
Ehrfurcht als Liebe bekundende Benehmen der Kinder
ihren Eltern gegenüber. Es ift ſchon geſagt worden,
daß im Oſten das Kind in Gegenwart ſeines Vaters ſich
nicht eher niederſetzen darf, bevor ihm die Erlaubniß dazu
ertheilt iſt. Das Kind darf in des Vaters Gegenwart
weder laut ſprechen, noch ſich des Tſchibuks bedienen, ja
es darf überhaupt nichts unternehmen, was auf Unab-
hängigkeit hinzielen könnte. Dem europäiſchen Beobachter
pflegt dieſe Sitte zu gefallen, denn er will darin einen
hohen Grad der Achtung entdecken, mit welcher die Kin-
der ihren Eltern begegnen. Dies iſt jedoch eine irrige
Auffaſſung. Was der flüchtige Beobachter ſieht, iſt nur
kalte Etikette, nicht aber Liebe, denn die erwähnten Höf-
lichkeiten werden nur dem Vater, nicht aber der Mutter
bezeugt. Ich fragte mich oft nach der Urſache dieſes un-
natürlichen und unerklärlichen Benehmens. ö
Was ich früher nur geahnt, ſteht heute klar vor
meinen Augen. Es ſteht außer Zweiſel, daß bei einem
Kinde, welches im Harem Zeuge aller jener Intriguen,
aller jener geheimen Spiele iſt, die hier gegen ſeinen von
Allen gefürchteten Vater in Scene geſetzt werden, ſchon
von früher Jugend an die Gefühle wahrer Anhänglichkeit
und inniger Liebe für ſeinen Erzeuger unterdrückt wer-
den. Hierzu kommt noch, daß das Kind, ob Knabe oder
Mädchen, bis zum zehnten Jahre, ja oft noch länger,
im Harem verbleibt und der Knabe denſelben nur in
Begleitung ſeines Lalas, zumeiſt aber eines Eunuchen
oder ungebildeten Dieners verlaſſen darf. Oder wähnt
man, daß die Kinder ihre Mütter etwa inniger lieben?
Entſchieden bejahend kann ich nicht darauf antworten,
denn wenngleich die große Mehrzahl der Kinder für die
Mutter mehr innigere Liebe empfindet, ſo kann ich doch
nicht umhin, auf den Umſtand hinzudeuten, daß Mütter,
die früher Sklavinnen waren, ſich nicht immer eines
gleichen Looſes mit ihren freigeborenen Töchtern erfreuen,
und der Sclavinnen gibt es viele in vornehmen Häuſern
der Mohamedaner. Mogen ſie auch noch ſo ſehr geliebt
werden, ſo bringt man ihnen doch häufig in Erinnerung,
wie viel ihr Ankauf gekoſtet, wie arm und einfach ſie
ausſahen, wie ungebildet und wild ſie waren, als man
ſie in dem Hauſe aufnahm. Geſchieht dies auch nur im
Scherz, wie tief muß es das Gefühl eines Kindes ver-
wunden, ſeine Mutter ſo behandelt zu ſehen?
Meiſt wird kindliche Liebe den Stolz erdrücken, oft
aber zeigt ſich das Gegentheil, und ich erinnere mich
einer Epiſode, die als traurige Beſtätigung dienen kann.
Ich hatte nämlich einſt zwei Zöglinge, von denen
der Eine eben ſo friedfertig, gehorſam und fleißig, wie
der Andere zänkiſch, widerſpenſtig und nachläſſig war.