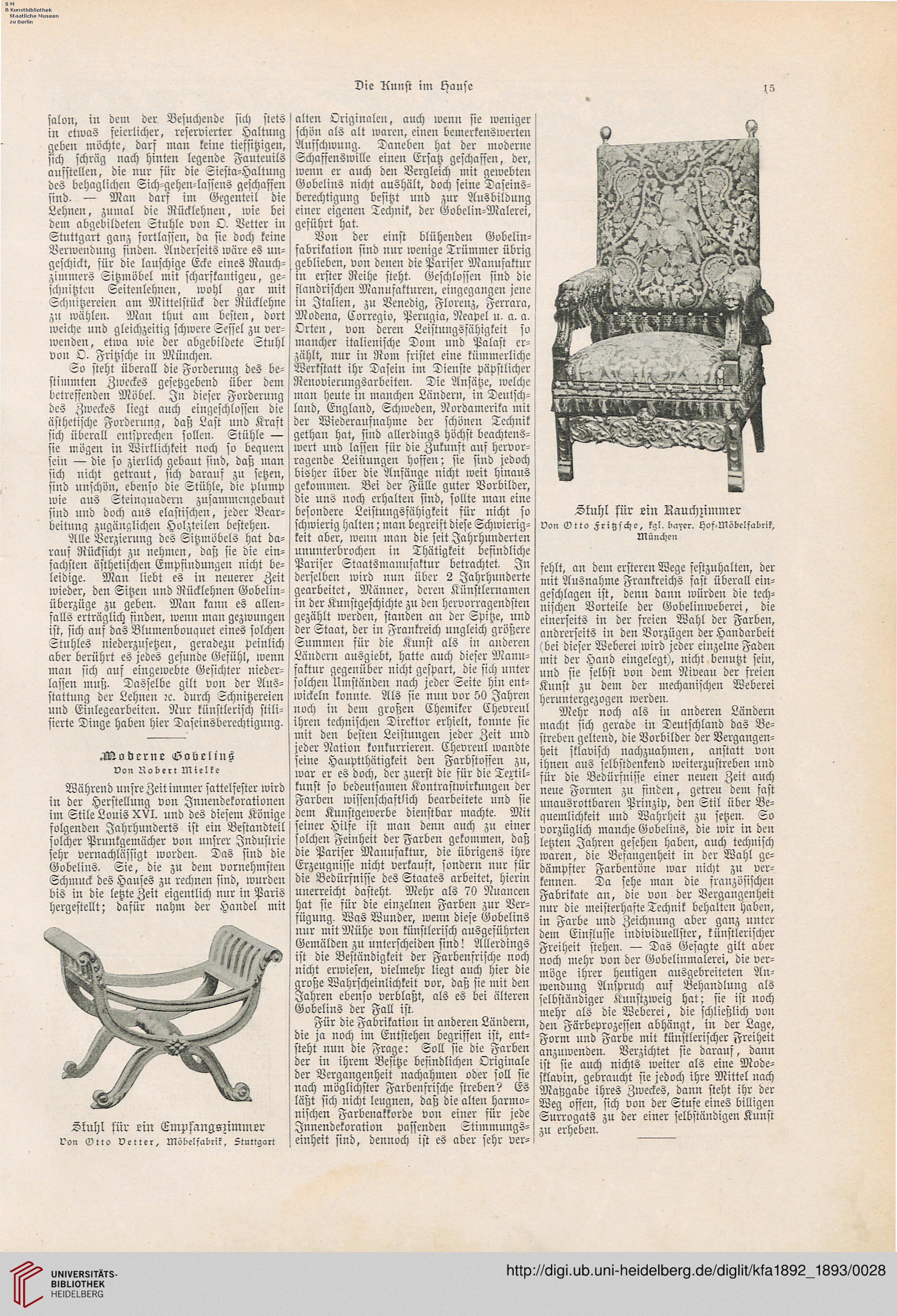salon, in dem der Besuchende sich stets
in etwas feierlicher, reservierter Haltung
geben mochte, darf man keine tiefsitzigen,
sich schräg nach hinten legende Fauteuils
aufstellen, die nur für die Siesta-Haltung
des behaglichen Sich-gehen-lassens geschaffen
sind. — Man darf im Gegenteil die
Lehnen, zumal die Rücklehnen, wie bei
dem abgebildeten Stuhle von O. Vetter in
Stuttgart ganz fortlassen, da sie doch keine
Verwendung finden. Anderseits wäre es un-
geschickt, sür die lauschige Ecke eines Rauch-
zimmers Sitzmöbel mit scharfkantigen, ge-
schnitzten Seitenlehnen, wohl gar mit
Schnitzereien am Mittelstück der Rücklehne
zu wählen. Man thut am besten, dort
weiche und gleichzeitig schwere Sessel zu ver-
wenden, etwa wie der abgebildete Stuhl
von O. Fritzsche in München.
So steht überall die Forderung des be-
stimmten Zweckes gesetzgebend über dem
betreffenden Möbel. In dieser Forderung
des Zweckes liegt auch eingeschlossen die
ästhetische Forderung, daß Last und Kraft
sich überall entsprechen sollen. Stühle —
sie mögen in Wirklichkeit noch so bequem
sein — die so zierlich gebaut sind, daß man
sich nicht getraut, sich darauf zu setzen,
sind unschön, ebenso die Stühle, die plump
wie aus Steinquadern zusammcngebaut
sind und doch aus elastischen, jeder Bear-
beitung zugänglichen Holzteilen bestehen.
Alle Verzierung des Sitzmöbels hat da-
rauf Rücksicht zu nehmen, daß sie die ein-
fachsten ästhetischen Empfindungen nicht be-
leidige. Man liebt es in neuerer Zeit
wieder, den Sitzen und Rücklehnen Gobelin-
überzüge zu geben. Man kann es allen-
falls erträglich finden, wenn man gezwungen
ist, sich auf das Blumenbouquet eines solchen
Stuhles niederzusetzen, geradezu Peinlich
aber berührt es jedes gesunde Gefühl, wenn
man sich auf eingewebte Gesichter nieder-
lassen muß. Dasselbe gilt von der Aus-
stattung der Lehnen re. durch Schnitzereien
und Einlegearbeiten. Nur künstlerisch stili-
sierte Dinge haben hier Daseinsberechtigung.
^Noderne SobrliuK
von Robert Mielke
Während unsre Zeit immer sattelfester wird
in der Herstellung von Innendekorationen
im Stile Louis XVI. und des diesem Könige
folgenden Jahrhunderts ist ein Bestandteil
solcher Prunkgemächer von unsrer Industrie
sehr vernachlässigt worden. Das sind die
Gobelins. Sie, die zu dem vornehmsten
Schmuck des Hauses zu rechnen sind, wurden
bis in die letzte Zeit eigentlich nur in Paris
hergestellt; dafür nahm der Handel mit
Sluhl sür ein Empfangszimmer
von Otto Vetter, Möbelfabrik, Stuttgart
Die Kunst im ksause
alten Originalen, auch wenn sie weniger
schön als alt waren, einen bemerkenswerten
Aufschwung. Daneben hat der moderne
Schaffenswille einen Ersatz geschaffen, der,
wenn er auch den Vergleich mit gewebten
Gobelins nicht aushält, doch seine Daseins-
berechtigung besitzt und zur Ausbildung
einer eigenen Technik, der Gobelin-Malerei,
geführt hat.
Von der einst blühenden Gobelin-
fabrikation sind nur wenige Trümmer übrig
geblieben, von denen die Pariser Manufaktur
in erster Reihe steht. Geschlossen sind die
flandrischen Manufakturen, eingegangen jene
in Italien, zu Venedig, Florenz, Ferrara,
Modena, Corregio, Perugia, Neapel u. a. a.
Orten, von deren Leistungsfähigkeit so
mancher italienische Dom und Palast er-
zählt, nur in Rom fristet eine kümmerliche
Werkstatt ihr Dasein im Dienste päpstlicher
Renovierungsarbeiten. Die Ansätze, welche
man heute in manchen Ländern, in Deutsch-
land, England, Schweden, Nordamerika mit
der Wiederaufnahme der schönen Technik
gethan hat, sind allerdings höchst beachtens-
wert und lassen für die Zukunst ans hervor-
ragende Leibungen hoffen; sie sind jedoch
bisher über die Anfänge nicht weit hinaus
gekommen. Bei der Fülle guter Vorbilder,
die unS noch erhalten sind, sollte man eine
besondere Leistungsfähigkeit für nicht so
schwierig halten; man begreift diese Schwierig-
keit aber, wenn man die seit Jahrhunderten
ununterbrochen in Thätigkeit befindliche
Pariser Staatsmanufaktur betrachtet. In
derselben wird nun über 2 Jahrhunderte
gearbeitet, Männer, deren Künstlernamen
in der Kunstgeschichte zu den hervorragendsten
gezählt werden, standen an der Spitze, und
der Staat, der in Frankreich ungleich größere
Summen für die Kunst als in anderen
Ländern ausgiebt, hatte auch dieser Manu-
faktur gegenüber nicht gespart, die sich unter
solchen Umständen nach jeder Seite hin ent-
wickeln konnte. Als sie nun vor 50 Jahren
noch in dem großen Chemiker Chevreul
ihren technischen Direktor erhielt, konnte sie
mit den besten Leistungen jeder Zeit und
jeder Nation konkurrieren. Chevreul wandte
seine Hauptthätigkeit den Farbstoffen zu,
war er es doch, der zuerst die für die Textil-
kunst so bedeutsamen Kontrastwirkungen der
Farben wissenschaftlich bearbeitete und sie
dem Kunstgewerbe dienstbar machte. Mit
seiner Hilfe ist man denn auch zu einer
solchen Feinheit der Farben gekommen, daß
die Pariser Manufaktur, die übrigens ihre
Erzeugnisse nicht verkauft, sondern nur für
die Bedürfnisse des Staates arbeitet, hierin
unerreicht dasteht. Mehr als 70 Nuancen
hat sie für die einzelnen Farben zur Ver-
fügung. Was Wunder, wenn diese Gobelins
nur mit Mühe von künstlerisch ausgeführten
Gemälden zu unterscheiden sind! Allerdings
ist die Beständigkeit der Farbenfrische noch
nicht erwiesen, vielmehr liegt auch hier die
große Wahrscheinlichkeit vor, daß sie mit den
Jahren ebenso verblaßt, als es bei älteren
Gobelins der Fall ist.
Für die Fabrikation in anderen Ländern,
die ja noch im Entstehen begriffen ist, ent-
steht nun die Frage: Soll sie die Farben
der in ihrem Besitze befindlichen Originale
der Vergangenheit nachahmen oder soll sie
nach möglichster Farbenfrische streben? Es
läßt sich nicht leugnen, daß die allen harmo-
nischen Farbenakkorde von einer für jede
Innendekoration passenden Stimmungs-
einheit sind, dennoch ist es aber sehr ver-
ls
Skuhl für rin Rauchzimmer
von Otto Fritzsche, kgl. ba^er. Hof-Möbelfabrik,
München
fehlt, an dem elfteren Wege festzuhalten, der
mit Ausnahme Frankreichs fast überall ein-
geschlagen ist, denn dann würden die tech-
nischen Vorteile der Gobelinweberei, die
einerseits in der freien Wahl der Farben,
andrerseits in den Vorzügen der Handarbeit
(bei dieser Weberei wird jeder einzelne Faden
mit der Hand eingelegt), nicht benutzt sein,
und sie selbst von dem Niveau der freien
Kunst zu dem der mechanischen Weberei
heruntergezogen werden.
Mehr noch als in anderen Ländern
macht sich gerade in Deutschland das Be-
streben geltend, die Vorbilder der Vergangen-
heit sklavisch nachzuahmen, anstatt von
ihnen aus selbstdcnkend weiterzustreben und
für die Bedürfnisse einer neuen Zeit auch
neue Formen zu finden, getreu dem fast
unausrottbaren Prinzip, den Stil über Be-
quemlichkeit und Wahrheit zu setzen. So
vorzüglich manche Gobelins, die wir in den
letzten Jahren gesehen haben, auch technisch
waren, die Befangenheit in der Wahl ge-
dämpfter Farbentöne war nicht zu ver-
kennen. Da sehe man die französischen
Fabrikate an, die von der Vergangenheit
nur die meisterhafte Technik behalten haben,
in Farbe und Zeichnung aber ganz unter
dem Einflüsse individuellster, künstlerischer
Freiheit stehen. — Das Gesagte gilt aber
noch mehr von der Gobelinmalerei, die ver-
möge ihrer heutigen ausgebreiteten An-
wendung Anspruch auf Behandlung als
selbständiger Kunstzweig hat; sie ist noch
mehr als die Weberei, die schließlich von
den Färbeprozessen abhängt, in der Lage,
Form und Farbe mit künstlerischer Freiheit
anzuwenden. Verzichtet sie darauf, dann
ist sie auch nichts weiter als eine Mode-
sklavin, gebraucht sie jedoch ihre Mittel nach
Maßgabe ihres Zweckes, dann steht ihr der
Weg offen, sich von der Stufe eines billigen
Surrogats zu der einer selbständigen Kunst
zu erheben.