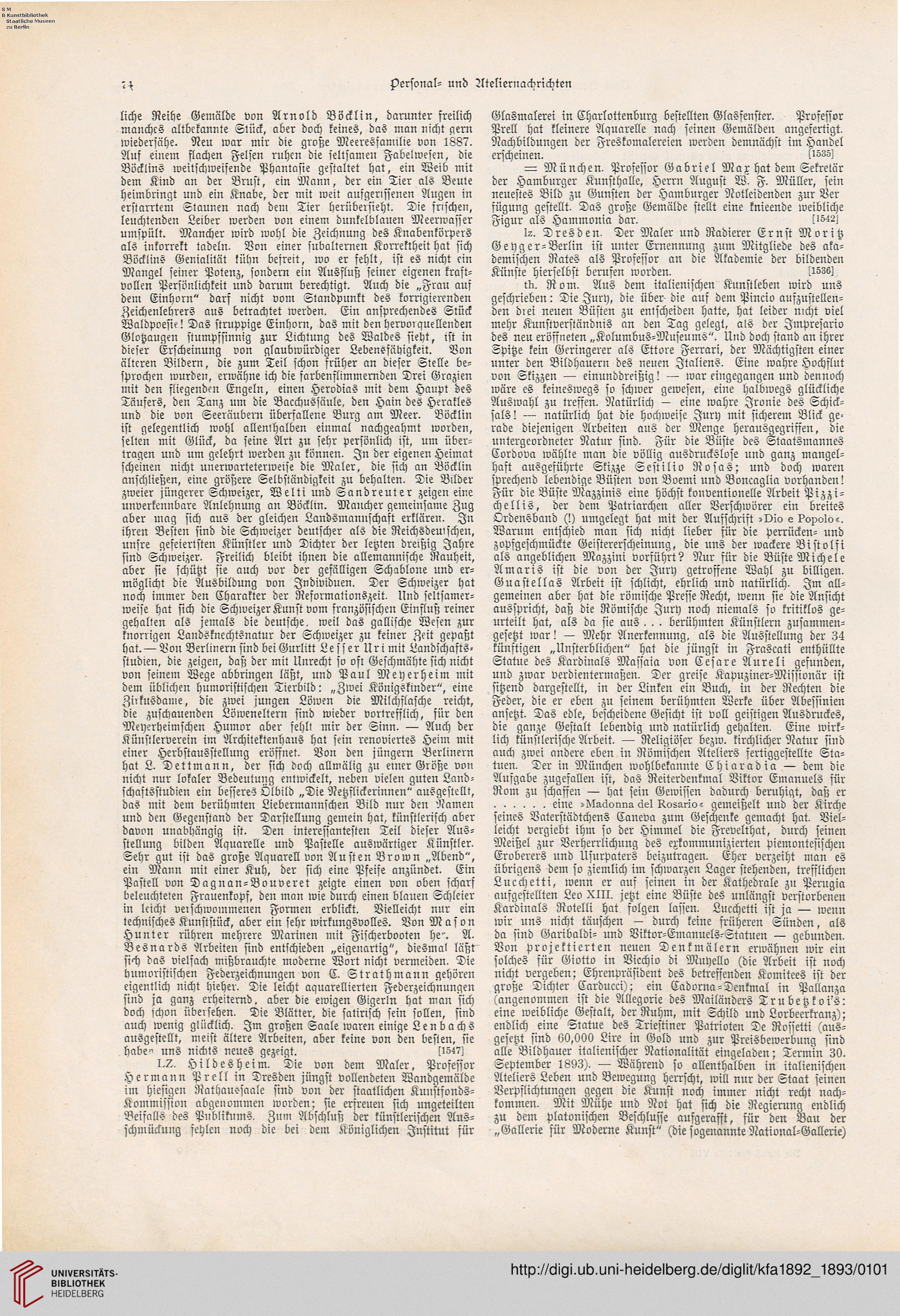Personal- und Ateliernachrichten
14
liche Reihe Gemälde von Arnold Böcklin, darunter freilich
manches altbekannte Stuck, aber doch keines, das man nicht gern
wiedersähe. Neu war mir die große Meeresfamilie von 1887.
Auf einem flachen Felsen ruhen die seltsamen Fabelwesen, die
Böcklins weitschweifende Phantasie gestaltet hat, ein Weib mit
dem Kind an der Brust, ein Mann, der ein Tier als Beute
heimbringt und ein Knabe, der mit weit aufgerissenen Augen in
erstarrtem Staunen nach dem Tier herübersieht. Die frischen,
leuchtenden Leiber werden von einem dunkelblauen Meerwasser
umspült. Mancher wird wohl die Zeichnung des Knabenkörpers
als inkorrekt tadeln. Von einer subalternen Korrektheit hat sich
Böcklins Genialität kühn befreit, wo er fehlt, ist es nicht ein
Mangel seiner Potenz, sondern ein Ausfluß seiner eigenen kraft-
vollen Persönlichkeit und darum berechtigt. Auch die „Frau auf
dem Einhorn" darf nicht vom Standpunkt des korrigierenden
Zeichenlehrers aus betrachtet werden. Ein ansprechendes Stück
Waldpoesie! Das struppige Einhorn, das mit den hervorquellenden
Glotzaugen stumpfsinnig zur Lichtung des Waldes sieht, ist in
dieser Erscheinung von glaubwürdiger Lebensfähigkeit. Von
älteren Bildern, die zum Teil schon früher an dieser Stelle be-
sprochen wurden, erwähne ich die farbenflimmernden Drei Grazien
mit den fliegenden Engeln, einen Herodias mit dem Haupt des
Täufers, den Tanz um die Bacchussäule, den Hain des Herakles
und die von Seeräubern überfallene Burg am Meer. Böcklin
ist gelegentlich wohl allenthalben einmal nachgeahmt worden,
selten mit Glück, da seine Art zu sehr persönlich ist, um über-
tragen und um gelehrt werden zu können. In der eigenen Heimat
scheinen nicht unerwarteterweise die Maler, die sich an Böcklin
anschließen, eine größere Selbständigkeit zu behalten. Die Bilder
zweier jüngerer Schweizer, Welti und Sandreuter zeigen eine
unverkennbare Anlehnung an Böcklin. Mancher gemeinsame Zug
aber mag sich aus der gleichen Landsmannschaft erklären. In
ihren Besten sind die Schweizer deutscher als die Reichsdeutschen,
unsre gefeiertsten Künstler und Dichter der letzten dreißig Jahre
sind Schweizer. Freilich bleibt ihnen die allemannische Rauheit,
aber sie schützt sie auch vor der gefälligen Schablone und er-
möglicht die Ausbildung von Individuen. Der Schweizer hat
noch immer den Charakter der Reformationszeit, lind seltsamer-
weise hat sich die Schweizer Kunst vom französischen Einfluß reiner
gehalten als jemals die deutsche, weil das gallische Wesen zur
knorrigen Landsknechtsnatur der Schweizer zu keiner Zeit gepaßt
hat. — Von Berlinern sind bei Gurlitt Lesser Uri mit Landschafts-
studien, die zeigen, daß der mit Unrecht so oft Geschmähte sich nicht
von seinem Wege abbringen läßt, und Paul Meyerheim mit
dem üblichen humoristischen Tierbild: „Zwei Königskinder", eine
Ziikusdame, die zwei jungen Löwen die Milchflasche reicht,
die zuschauenden Löweneltern sind wieder vortrefflich, für den
Meyerheimschen Humor aber fehlt mir der Sinn. — Auch der
Künstlerverein im Archilektenhaus hat sein renoviertes Heim mit
einer Herbstausstellung eröffnet. Von den jüngern Berlinern
hat L. Dettmann, der sich doch allmälig zu einer Größe von
nicht nur lokaler Bedeutung entwickelt, neben vielen guten Land-
schastsstudien ein besseres Ölbild „Die Netzflickerinnen" ausgestellt,
das mit dem berühmten Liebermannschen Bild nur den Namen
und den Gegenstand der Darstellung gemein hat, künstlerisch aber
davon unabhängig ist. Den interessantesten Teil dieser Aus-
stellung bilden Aquarelle und Pastelle auswärtiger Künstler.
Sehr gut ist das große Aquarell von Austen Brown „Abend",
ein Mann mit einer Kuh, der sich eine Pfeife anzündet. Ein
Pastell von Dagnan-Bouveret zeigte einen von oben scharf
beleuchteten Frauenkopf, den man wie durch einen blauen Schleier
in leicht veischwoinmenen Formen erblickt. Vielleicht nur ein
technisches Kunststück, aber ein sehr wirkungsvolles. Von Mason
Hunter rühren mehrere Marinen mit Fischerbooten he-. A.
Besnards Arbeiten sind entschieden „eigenartig", diesmal läßt
sich das vielfach mißbrauchte moderne Wort nicht vermeiden. Die
bumoristischen Federzeichnungen von C. Strathmann gehören
eigentlich nicht hieher. Die leicht aquarellierten Federzeichnungen
sind ja ganz erheiternd, aber die ewigen Gigerln hat man sich
doch schon übersehen. Die Blätter, die satirisch sein sollen, sind
auch wenig glücklich. Im großen Saale waren einige L e n b a ch s
ausgestellt, meist ältere Arbeiten, aber keine von den besten, sie
habe" uns Nickis neues gezeigt. l>5«7)
H Hildesheim. Die von dem Maler, Professor
Hermann Prell in Dresden jüngst vollendeten Wandgemälde
im hiesigen Rathaussaale sind von der staatlichen Kuustfonds-
Kommission abgenommen worden; sie erfreuen sich ungeteilten
Beifalls des Publikums. Zum Abschluß der künstlerischen Aus-
schmückung fehlen noch die bei dem Königlichen Institut für
Glasmalerei in Charlottenburg bestellten Glasfenster. Professor
Prell hat kleinere Aquarelle nach seinen Gemälden angefertigt.
Nachbildungen der Freskomalereien werden demnächst im Handel
erscheinen. lisssj
— München. Professor Gabriel Max hat dem Sekrelär
der Hamburger Kunsthalle, Herrn August W. F. Müller, sein
neuestes Bild zu Gunsten der Hainburger Notleidenden zur Ver
fügung gestellt. Das große Gemälde stellt eine knieende weibliche
Figur als Hammonia dar. l>S42j
Ir. Dresden. Der Maler und Radierer Ernst Moritz
Geyger-Berlin ist unter Ernennung zum Mitglieds des aka-
demischen Rates als Professor an die Akademie der bildenden
Künste Hierselbst berufen worden. Iiszej
tb. Rom. Aus dem italienischen Kunstleben wird uns
geschrieben: Die Jury, die über die auf dem Pincio aufzustellen-
dm die! neuen Büsten zu entscheiden hatte, hat leider nicht viel
mehr Kunstverständnis an den Tag gelegt, als der Impresario
des neu eröffneten „Kolumbus-Museums". Und doch stand an ihrer
Spitze kein Geringerer als Ettore Ferrari, der Mächtigsten einer
unter den Bildhauern des neuen Italiens. Eine wahre Hochflut
von Skizzen — einunddreißig! — war eingegangen und dennoch
wäre es keineswegs so schwer gewesen, eine halbwegs glückliche
Auswahl zu treffen. Natürlich — eine wahre Ironie des Schick-
sals! — natürlich hat die hochweise Jury mit sicherem Blick ge-
rade diejenigen Arbeiten aus der Menge herausgegriffen, die
untergeordneter Natur sind. Für die Büste des Staatsmannes
Cordova wählte man die völlig ausdruckslose und ganz mangel-
haft ausgeführte Skizze Sestilio Rosas; und doch waren
sprechend lebendige Büsten von Boemi und Boncaglia vorhanden!
Für die Büste Mazzinis eine höchst konventionelle Arbeit Pizzi-
chellis, der dem Patriarchen aller Verschwörer ein breites
Ordensband (!) umgelegt hat mit der Aufschrift ,vic> e kopolor.
Warum entschied man sich nicht lieber für die Perrücken- und
zopfgeschmückte Geistererscheinung, die uns der wackere Bistolfi
als angeblichen Mazzini vorsührt? Nur für die Büste Michele
Amaris ist die von der Jury getroffene Wahl zu billigen.
Guastellas Arbeit ist schlicht, ehrlich und natürlich. Im all-
gemeinen aber hat die römische Presse Recht, wenn sie die Ansicht
ausspricht, daß die Römische Jury noch niemals so kritiklos ge-
urteilt hat, als da sie aus. . . berühmten Künstlern zusammen-
gesetzt war! — Mehr Anerkennung, als die Ausstellung der 34
künftigen „Unsterblichen" hat die jüngst in Frascati enthüllte
Statue des Kardinals Maffaia von Cesare Aureli gefunden,
und zwar verdientermaßen. Der greise Kapuziner-Missionär ist
sitzend dargestellt, in der Linken ein Buch, in der Rechten die
Feder, die er eben zu seinem berühmten Werke über Abessinien
ansetzt. Das edle, bescheidene Gesicht ist voll geistigen Ausdruckes,
die ganze Gestalt lebendig und natürlich gehalten. Eine wirk-
lich künstlerische Arbeit. — Religiöser bezw. kirchlicher Natur sind
auch zwei andere eben in Römischen Ateliers fertiggestellte Sta-
tuen. Ter in München wohlbekannte Chiaradia — dem die
Aufgabe zugefallen ist, das Reiterdenkmal Viktor Emanuels für
Rom zu schaffen — hat sein Gewissen dadurch beruhigt, daß er
.eine »dlackonnL ckel Hosario« gemeißelt und der Kirche
seines Vaterstädtchens Caneva zum Geschenke gemacht hat. Viel-
leicht vergiebt ihm so der Himmel die Frevelthat, durch seinen
Meißel zur Verherrlichung des exkommunizierten piemontesischen
Eroberers und Üsurpaters beizutragen. Eher verzeiht man es
übrigens dem so ziemlich im schwarzen Lager stehenden, trefflichen
Lucchetti, wenn er auf seinen in der Kathedrale zu Perugia
aufgestellten Leo X1H, jetzt eine Büste des unlängst verstorbenen
Kardinals Rotelli hat folgen lassen. Lucchetti ist ja — wenn
wir uns nicht täuschen — durch keine früheren Sünden, als
da sind Garibaldi- und Viktor-Emanuels-Statuen — gebunden.
Von projektierten neuen Denkmälern erwähnen wir ein
solches für Giotto in Vicchio di Muyello (die Arbeit ist noch
nicht vergeben; Ehrenpräsident des betreffenden Komitees ist der
große Dichter Carducci); ein Cadorna-Denkmal in Pallanza
(angenommen ist die Allegorie des Mailänders Trubetzkoi's:
eine weibliche Gestalt, der Ruhm, mit Schild und Lorbeerkranz);
endlich eine Sratue des Triestiner Patrioten De Rossetti (aus-
gesetzt sind 60,000 Lire in Gold und zur Preisbewerbung sind
alle Bildhauer italienischer Nationalität eingeladen; Termin 30.
September 1893). — Während so allenthalben in italienischen
Ateliers Leben und Bewegung herrscht, will nur der Staat seinen
Verpflichtungen gegen die Kunst noch immer nicht recht Nach-
kommen. Mit Mühe und Not hat sich die Regierung endlich
zu dem platonischen Beschlüsse aufgerafft, für den Bau der
„Gallerie für Moderne Kunst" (die sogenannte National-Gallerie)
14
liche Reihe Gemälde von Arnold Böcklin, darunter freilich
manches altbekannte Stuck, aber doch keines, das man nicht gern
wiedersähe. Neu war mir die große Meeresfamilie von 1887.
Auf einem flachen Felsen ruhen die seltsamen Fabelwesen, die
Böcklins weitschweifende Phantasie gestaltet hat, ein Weib mit
dem Kind an der Brust, ein Mann, der ein Tier als Beute
heimbringt und ein Knabe, der mit weit aufgerissenen Augen in
erstarrtem Staunen nach dem Tier herübersieht. Die frischen,
leuchtenden Leiber werden von einem dunkelblauen Meerwasser
umspült. Mancher wird wohl die Zeichnung des Knabenkörpers
als inkorrekt tadeln. Von einer subalternen Korrektheit hat sich
Böcklins Genialität kühn befreit, wo er fehlt, ist es nicht ein
Mangel seiner Potenz, sondern ein Ausfluß seiner eigenen kraft-
vollen Persönlichkeit und darum berechtigt. Auch die „Frau auf
dem Einhorn" darf nicht vom Standpunkt des korrigierenden
Zeichenlehrers aus betrachtet werden. Ein ansprechendes Stück
Waldpoesie! Das struppige Einhorn, das mit den hervorquellenden
Glotzaugen stumpfsinnig zur Lichtung des Waldes sieht, ist in
dieser Erscheinung von glaubwürdiger Lebensfähigkeit. Von
älteren Bildern, die zum Teil schon früher an dieser Stelle be-
sprochen wurden, erwähne ich die farbenflimmernden Drei Grazien
mit den fliegenden Engeln, einen Herodias mit dem Haupt des
Täufers, den Tanz um die Bacchussäule, den Hain des Herakles
und die von Seeräubern überfallene Burg am Meer. Böcklin
ist gelegentlich wohl allenthalben einmal nachgeahmt worden,
selten mit Glück, da seine Art zu sehr persönlich ist, um über-
tragen und um gelehrt werden zu können. In der eigenen Heimat
scheinen nicht unerwarteterweise die Maler, die sich an Böcklin
anschließen, eine größere Selbständigkeit zu behalten. Die Bilder
zweier jüngerer Schweizer, Welti und Sandreuter zeigen eine
unverkennbare Anlehnung an Böcklin. Mancher gemeinsame Zug
aber mag sich aus der gleichen Landsmannschaft erklären. In
ihren Besten sind die Schweizer deutscher als die Reichsdeutschen,
unsre gefeiertsten Künstler und Dichter der letzten dreißig Jahre
sind Schweizer. Freilich bleibt ihnen die allemannische Rauheit,
aber sie schützt sie auch vor der gefälligen Schablone und er-
möglicht die Ausbildung von Individuen. Der Schweizer hat
noch immer den Charakter der Reformationszeit, lind seltsamer-
weise hat sich die Schweizer Kunst vom französischen Einfluß reiner
gehalten als jemals die deutsche, weil das gallische Wesen zur
knorrigen Landsknechtsnatur der Schweizer zu keiner Zeit gepaßt
hat. — Von Berlinern sind bei Gurlitt Lesser Uri mit Landschafts-
studien, die zeigen, daß der mit Unrecht so oft Geschmähte sich nicht
von seinem Wege abbringen läßt, und Paul Meyerheim mit
dem üblichen humoristischen Tierbild: „Zwei Königskinder", eine
Ziikusdame, die zwei jungen Löwen die Milchflasche reicht,
die zuschauenden Löweneltern sind wieder vortrefflich, für den
Meyerheimschen Humor aber fehlt mir der Sinn. — Auch der
Künstlerverein im Archilektenhaus hat sein renoviertes Heim mit
einer Herbstausstellung eröffnet. Von den jüngern Berlinern
hat L. Dettmann, der sich doch allmälig zu einer Größe von
nicht nur lokaler Bedeutung entwickelt, neben vielen guten Land-
schastsstudien ein besseres Ölbild „Die Netzflickerinnen" ausgestellt,
das mit dem berühmten Liebermannschen Bild nur den Namen
und den Gegenstand der Darstellung gemein hat, künstlerisch aber
davon unabhängig ist. Den interessantesten Teil dieser Aus-
stellung bilden Aquarelle und Pastelle auswärtiger Künstler.
Sehr gut ist das große Aquarell von Austen Brown „Abend",
ein Mann mit einer Kuh, der sich eine Pfeife anzündet. Ein
Pastell von Dagnan-Bouveret zeigte einen von oben scharf
beleuchteten Frauenkopf, den man wie durch einen blauen Schleier
in leicht veischwoinmenen Formen erblickt. Vielleicht nur ein
technisches Kunststück, aber ein sehr wirkungsvolles. Von Mason
Hunter rühren mehrere Marinen mit Fischerbooten he-. A.
Besnards Arbeiten sind entschieden „eigenartig", diesmal läßt
sich das vielfach mißbrauchte moderne Wort nicht vermeiden. Die
bumoristischen Federzeichnungen von C. Strathmann gehören
eigentlich nicht hieher. Die leicht aquarellierten Federzeichnungen
sind ja ganz erheiternd, aber die ewigen Gigerln hat man sich
doch schon übersehen. Die Blätter, die satirisch sein sollen, sind
auch wenig glücklich. Im großen Saale waren einige L e n b a ch s
ausgestellt, meist ältere Arbeiten, aber keine von den besten, sie
habe" uns Nickis neues gezeigt. l>5«7)
H Hildesheim. Die von dem Maler, Professor
Hermann Prell in Dresden jüngst vollendeten Wandgemälde
im hiesigen Rathaussaale sind von der staatlichen Kuustfonds-
Kommission abgenommen worden; sie erfreuen sich ungeteilten
Beifalls des Publikums. Zum Abschluß der künstlerischen Aus-
schmückung fehlen noch die bei dem Königlichen Institut für
Glasmalerei in Charlottenburg bestellten Glasfenster. Professor
Prell hat kleinere Aquarelle nach seinen Gemälden angefertigt.
Nachbildungen der Freskomalereien werden demnächst im Handel
erscheinen. lisssj
— München. Professor Gabriel Max hat dem Sekrelär
der Hamburger Kunsthalle, Herrn August W. F. Müller, sein
neuestes Bild zu Gunsten der Hainburger Notleidenden zur Ver
fügung gestellt. Das große Gemälde stellt eine knieende weibliche
Figur als Hammonia dar. l>S42j
Ir. Dresden. Der Maler und Radierer Ernst Moritz
Geyger-Berlin ist unter Ernennung zum Mitglieds des aka-
demischen Rates als Professor an die Akademie der bildenden
Künste Hierselbst berufen worden. Iiszej
tb. Rom. Aus dem italienischen Kunstleben wird uns
geschrieben: Die Jury, die über die auf dem Pincio aufzustellen-
dm die! neuen Büsten zu entscheiden hatte, hat leider nicht viel
mehr Kunstverständnis an den Tag gelegt, als der Impresario
des neu eröffneten „Kolumbus-Museums". Und doch stand an ihrer
Spitze kein Geringerer als Ettore Ferrari, der Mächtigsten einer
unter den Bildhauern des neuen Italiens. Eine wahre Hochflut
von Skizzen — einunddreißig! — war eingegangen und dennoch
wäre es keineswegs so schwer gewesen, eine halbwegs glückliche
Auswahl zu treffen. Natürlich — eine wahre Ironie des Schick-
sals! — natürlich hat die hochweise Jury mit sicherem Blick ge-
rade diejenigen Arbeiten aus der Menge herausgegriffen, die
untergeordneter Natur sind. Für die Büste des Staatsmannes
Cordova wählte man die völlig ausdruckslose und ganz mangel-
haft ausgeführte Skizze Sestilio Rosas; und doch waren
sprechend lebendige Büsten von Boemi und Boncaglia vorhanden!
Für die Büste Mazzinis eine höchst konventionelle Arbeit Pizzi-
chellis, der dem Patriarchen aller Verschwörer ein breites
Ordensband (!) umgelegt hat mit der Aufschrift ,vic> e kopolor.
Warum entschied man sich nicht lieber für die Perrücken- und
zopfgeschmückte Geistererscheinung, die uns der wackere Bistolfi
als angeblichen Mazzini vorsührt? Nur für die Büste Michele
Amaris ist die von der Jury getroffene Wahl zu billigen.
Guastellas Arbeit ist schlicht, ehrlich und natürlich. Im all-
gemeinen aber hat die römische Presse Recht, wenn sie die Ansicht
ausspricht, daß die Römische Jury noch niemals so kritiklos ge-
urteilt hat, als da sie aus. . . berühmten Künstlern zusammen-
gesetzt war! — Mehr Anerkennung, als die Ausstellung der 34
künftigen „Unsterblichen" hat die jüngst in Frascati enthüllte
Statue des Kardinals Maffaia von Cesare Aureli gefunden,
und zwar verdientermaßen. Der greise Kapuziner-Missionär ist
sitzend dargestellt, in der Linken ein Buch, in der Rechten die
Feder, die er eben zu seinem berühmten Werke über Abessinien
ansetzt. Das edle, bescheidene Gesicht ist voll geistigen Ausdruckes,
die ganze Gestalt lebendig und natürlich gehalten. Eine wirk-
lich künstlerische Arbeit. — Religiöser bezw. kirchlicher Natur sind
auch zwei andere eben in Römischen Ateliers fertiggestellte Sta-
tuen. Ter in München wohlbekannte Chiaradia — dem die
Aufgabe zugefallen ist, das Reiterdenkmal Viktor Emanuels für
Rom zu schaffen — hat sein Gewissen dadurch beruhigt, daß er
.eine »dlackonnL ckel Hosario« gemeißelt und der Kirche
seines Vaterstädtchens Caneva zum Geschenke gemacht hat. Viel-
leicht vergiebt ihm so der Himmel die Frevelthat, durch seinen
Meißel zur Verherrlichung des exkommunizierten piemontesischen
Eroberers und Üsurpaters beizutragen. Eher verzeiht man es
übrigens dem so ziemlich im schwarzen Lager stehenden, trefflichen
Lucchetti, wenn er auf seinen in der Kathedrale zu Perugia
aufgestellten Leo X1H, jetzt eine Büste des unlängst verstorbenen
Kardinals Rotelli hat folgen lassen. Lucchetti ist ja — wenn
wir uns nicht täuschen — durch keine früheren Sünden, als
da sind Garibaldi- und Viktor-Emanuels-Statuen — gebunden.
Von projektierten neuen Denkmälern erwähnen wir ein
solches für Giotto in Vicchio di Muyello (die Arbeit ist noch
nicht vergeben; Ehrenpräsident des betreffenden Komitees ist der
große Dichter Carducci); ein Cadorna-Denkmal in Pallanza
(angenommen ist die Allegorie des Mailänders Trubetzkoi's:
eine weibliche Gestalt, der Ruhm, mit Schild und Lorbeerkranz);
endlich eine Sratue des Triestiner Patrioten De Rossetti (aus-
gesetzt sind 60,000 Lire in Gold und zur Preisbewerbung sind
alle Bildhauer italienischer Nationalität eingeladen; Termin 30.
September 1893). — Während so allenthalben in italienischen
Ateliers Leben und Bewegung herrscht, will nur der Staat seinen
Verpflichtungen gegen die Kunst noch immer nicht recht Nach-
kommen. Mit Mühe und Not hat sich die Regierung endlich
zu dem platonischen Beschlüsse aufgerafft, für den Bau der
„Gallerie für Moderne Kunst" (die sogenannte National-Gallerie)