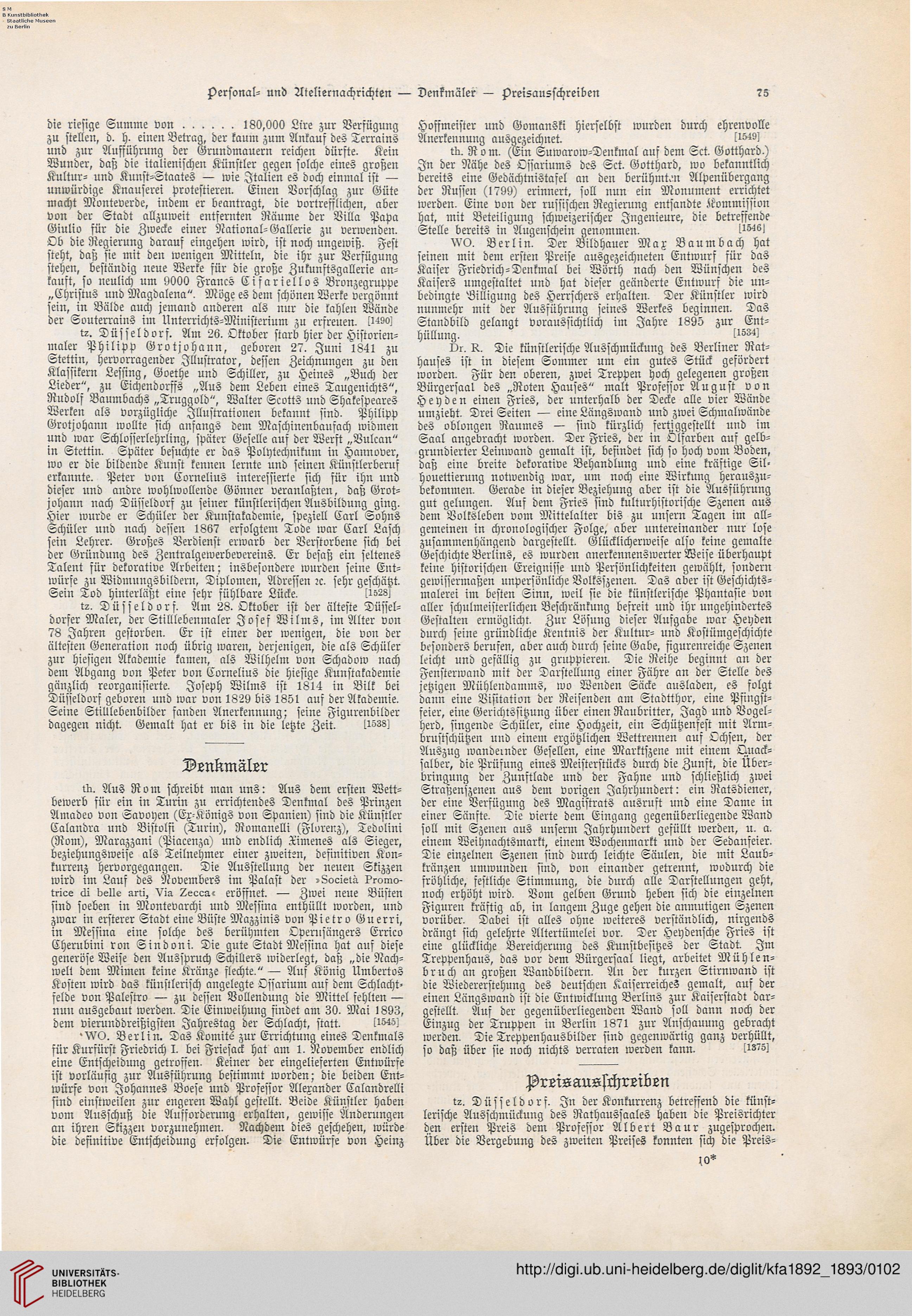Personal- und Ateliernachrichten — Denkmäler — Preisausschreiben
75
die riesige Summe von. 180,000 Lire zur Verfügung
zu stellen, d. h. einen Betrag, der kaum zum Ankauf des Terrains
und zur Aufführung der Grundmauern reichen dürfte. Kein
Wunder, daß die italienischen Künstler gegen solche eines großen
Kultur- und Kunst-Staates — wie Italien es doch einmal ist —
unwürdige Knauserei protestieren. Einen Vorschlag zur Güte
macht Monteverde, indem er beantragt, die vortrefflichen, aber
von der Stadt allzuweit entfernten Räume der Villa Papa
Giulio für die Zwecke einer National-Gallerte zu verwenden.
Ob die Regierung darauf eingehen wird, ist noch ungewiß. Fest
steht, daß sie mit den wenigen Mitteln, die ihr zur Verfügung
stehen, beständig neue Werke für die große Zukunftsgallerie an-
kanft, so neulich um 9000 Francs Cifariellos Bronzegruppe
„Christus und Magdalena". Möge es dem schönen Werke vergönnt
sein, in Bälde auch jemand anderen als nur die kahlen Wände
der Souterrains im Unterrichts-Ministerium zu erfreuen. lMo)
tr. Düsseldorf. Am 26. Oktober starb hier der Historien-
maler Philipp Grotjohann, geboren 27. Juni 1841 zu
Stettin, hervorragender Illustrator, dessen Zeichnungen zu den
Klassikern Lessing, Goethe und Schiller, zu Heines „Buch der
Lieder", zu Eichendorffs „Aus dem Leben eines Taugenichts",
Rudolf Baumbachs „Trugaold", Walter Scotts und Shakespeares
Werken als vorzügliche Illustrationen bekannt sind. Philipp
Grotjohann wollte sich anfangs dem Maschinenbausach widmen
und war Schlosserlehrling, später Geselle auf der Werft „Vulcan"
in Stettin. Später besuchte er das Polytechnikum in Hannover,
wo er die bildende Kunst kennen lernte und seinen Künstlerberuf
erkannte. Peter von Cornelius interessierte sich für ihn und
dieser und andre wohlwollende Gönner veranlagten, daß Grot-
johann nach Düsseldorf zu seiner künstlerischen Ausbildung ging.
Hier wurde er Schüler der Kunstakademie, speziell Carl Sohns
Schüler und nach dessen 1867 erfolgtem Tode war Carl Lasch
sein Lehrer. Großes Verdienst erwarb der Verstorbene sich bei
der Gründung des Zentralgewerbevereins. Er besaß ein seltenes
Talent für dekorative Arbeiten; insbesondere wurden seine Ent-
würfe zu Widmungsbildern, Diplomen, Adressen w. sehr geschätzt.
Sein Tod hinterläht eine sehr fühlbare Lücke. flsWs
tr. Düsseldorf. Am 28. Oktober ist der älteste Düssel-
dorfer Maler, der Stilllebcnmaler Josef Wilms, im Alter von
78 Jahren gestorben. Er ist einer der wenigen, die von der
ältesten Generation noch übrig waren, derjenigen, die als Schüler
zur hiesigen Akademie kamen, als Wilhelm von Schadow nach
dem Abgang von Peter von Cornelius die hiesige Kunstakademie
gänzlich reorganisierte. Joseph Wilms ist 1814 in Bilk bei
Düsseldorf geboren und war von 1829 bis 1851 ans der Akademie.
Seine Stilllebenbilder fanden Anerkennung; seine Figurenbilder
dagegen nicht. Gemalt hat er bis in die letzte Zeit. lisssi
Denkmäler
tb. Aus Rom schreibt man uns: Aus dem ersten Wett-
bewerb für ein in Turin zu errichtendes Denkmal des Prinzen
Amadeo von L-avoyen (Ex-Königs von Spanien) sind die Künstler
Calandra und Bistolfi (Turin), Romanelli (Florenz), Tedolini
(Rom), Marazzani (Piacenza) und endlich st'imenes als Sieger,
beziehungsweise als Teilnehmer einer zweiten, definitiven Kon-
kurrenz hervorgegangen. Die Ausstellung der neuen Skizzen
wird im Laus des Novembers im Palast der »Locietä ?romo-
trice äi belle arü, Via 2ecca« eröffnet. — Zwei neue Büsten
sind soeben in Montevarchi und Messina enthüllt worden, und
zwar in elfterer Stadt eine Büste Mazzinis von Pietro Guerri,
in Messina eine solche des berühmten Opernsängers Errico
Cherubim ton Sindoni. Die gute Stadt Messina hat auf diese
generöse Weise den Ausspruch Schillers widerlegt, daß „die Nach-
welt dem Mimen keine Kränze flechte." — Auf König Umbertos
Kosten wird das künstlerisch angelegte Ossarium auf dem Schlacht-
selde von Palestro — zu dessen Vollendung die Mittel fehlten —
nun ausgebaut werden. Die Einweihung findet am 30. Mai 1893,
dem vierunddreißigsten Jahrestag der Schlacht, statt. Ii54s;
'WO. Berlin. Das Konnte zur Errichtung eines Denkmals
für Kurfürst Friedrich l. bei Friesack hat am 1. November endlich
eine Entscheidung getroffen. Keiner der eingelieferten Entwürfe
ist vorläufig zur Ausführung bestimmt worden; die beiden Ent-
würfe von Johannes Boese und Professor Alexander Calandrelli
sind einstweilen zur engeren Wahl gestellt. Beide Künstler haben
vom Ausschuß die Aufforderung erhalten, gewisse Änderungen
an ihren Skizzen vorzunehmen. Nachdem dies geschehen, würde
die definitive Entscheidung erfolgen. Die Entwürfe von Heinz
Hoffmeister und Gomanski Hierselbst wurden durch ehrenvolle
Anerkennung ausgezeichnet.
tb. Rom. (Ein Suwarow-Denkmal ans dem Sct. Gotthard.)
In der Nähe des Ossariums des Sct. Gotthard, wo bekanntlich
bereits eine Gedächtnistafel an den berühmten Alpenübergang
der Russen (1799) erinnert, soll nun ein Monument errichtet
werden. Eine von der russischen Regierung entsandte Kommission
hat, mit Beteiligung schweizerischer Ingenieure, die betreffende
Stelle bereits in Augenschein genommen.
WO. Berlin. Der Bildhauer Max Baumbach hat
seinen mit dem ersten Preise ausgezeichneten Entwurf für das
Kaiser Friedrich-Denkmal bei Wörth nach den Wünschen des
Kaisers umgestaltet und hat dieser geänderte Entwurf die un-
bedingte Billigung des Herrschers erhalten. Der Künstler wird
nunmehr mit der Ausführung seines Werkes beginnen. Das
Standbild gelangt voraussichtlich im Jahre 1895 zur Ent-
hüllung.
Or. K. Die künstlerische Ausschmückung des Berliner Rat-
hauses ist in diesem Sommer um ein gutes Stück gefördert
worden. Für den oberen, zwei Treppen hoch gelegenen großen
Bürgersaal des „Roten Hauses" malt Professor August von
Heyden einen Fries, der unterhalb der Decke alle vier Wände
umzieht. Drei Seiten — eine Längswand und zwei Schmalwände
des oblongen Raumes — sind kürzlich fertiggestellt und im
Saal angebracht worden. Der Fries, der in Ölfarben auf gelb-
grundierter Leinwand gemalt ist, befindet sich so hoch vom Boden,
daß eine breite dekorative Behandlung und eine kräftige Sil-
houettierung notwendig war, um noch eine Wirkung herauszu-
bekommen. Gerade in dieser Beziehung aber ist die Ausführung
gut gelungen. Auf dem Fries sind kulturhistorische Szenen aus
dem Volksleben vom Mittelalter bis zu unfern Tagen im all-
gemeinen in chronologischer Folge, aber untereinander nur lose
zusammenhängend dargestellt. Glücklicherweise also keine gemalte
Geschichte Berlins, es wurden anerkennenswerter Weise überhaupt
keine historischen Ereignisse und Persönlichkeiten gewählt, sondern
gewissermaßen unpersönliche Volksszenen. Das aber ist Geschichts-
malerei im besten Sinn, weil sie die künstlerische Phantasie von
aller schulmeisterlichen Beschränkung befreit und ihr ungehindertes
Gestalten ermöglicht. Zur Lösung dieser Aufgabe war Heyden
durch seine gründliche Kentnis der Kultur- und Kostümgeschichte
besonders berufen, aber auch durch seine Gabe, figurenreiche Szenen
leicht und gefällig zu gruppieren. Die Reihe beginnt an der
Fensterwand mit der Darstellung einer Fähre an der Stelle des
jetzigen Mühlendamms, wo Wenden Säcke ausladen, es folgt
dann eine Visitation der Reisenden am Stadtthor, eine Pfingst-
feier, eine Gerichtssitzung über einen Raubritter, Jagd und Vogel-
herd. singende Schüler, eine Hochzeit, ein Schützenfest mit Arm-
brustschützen und einem ergötzlichen Wettrennen auf Ochsen, der
Auszug wandeinder Gesellen, eine Marktszene mit einem Quack-
salber, die Prüfung eines Meisterstücks durch die Zunft, die Über-
bringung der Zunftlade und der Fahne und schließlich zwei
Straßenszenen aus dem vorigen Jahrhundert: ein Ratsdiener,
der eine Verfügung des Magistrats ausrust und eine Dame in
einer Sänfte. Die vierte dem Eingang gegenüberliegende Wand
soll mit Szenen aus unserm Jahrhundert gefüllt werden, u. a.
einem Weihnachtsmarkt, einem Wochenmarkt und der Sedanseier.
Die einzelnen Szenen sind durch leichte Säulen, die mit Laub-
kränzen umwunden sind, von einander getrennt, wodurch die
fröhliche, festliche Stimmung, die durch alle Darstellungen geht,
noch erhöht wird. Vom gelben Grund heben sich die einzelnen
Figuren kräftig ab, in langem Zuge gehen die anmutigen Szenen
vorüber. Dabei ist alles ohne weiteres verständlich, nirgends
drängt sich gelehrte Altertümelei vor. Der Heydensche Fries ist
eine glückliche Bereicherung des Kunstbesitzes der Stadt. Im
Treppenhaus, das vor dem Bürgersaal liegt, arbeitet Mühlen-
bruch an großen Wandbildern. An der kurzen Stirnwand ist
die Wiedererstehung des deutschen Kaiserreiches gemalt, auf der
einen Längswand ist die Entwicklung Berlins zur Kaiserstadt dar-
gestellt. Auf der gegenüberliegenden Wand soll dann noch der
Einzug der Truppen in Berlin 1871 zur Anschauung gebracht
werden. Die Treppeuhausbilder sind gegenwärtig ganz verhüllt,
so daß über sie noch nichts verraten werden kann- Nb-sl
Preisausschreiben
tr. Düsseldorf. In der Konkurrenz betreffend die künst-
lerische Ausschmückung des Rathaussaales haben die Preisrichter
den ersten Preis dem Professor Albert Baur zugesprochen.
Über die Vergebung des zweiten Preises konnten sich die Preis-
10*
75
die riesige Summe von. 180,000 Lire zur Verfügung
zu stellen, d. h. einen Betrag, der kaum zum Ankauf des Terrains
und zur Aufführung der Grundmauern reichen dürfte. Kein
Wunder, daß die italienischen Künstler gegen solche eines großen
Kultur- und Kunst-Staates — wie Italien es doch einmal ist —
unwürdige Knauserei protestieren. Einen Vorschlag zur Güte
macht Monteverde, indem er beantragt, die vortrefflichen, aber
von der Stadt allzuweit entfernten Räume der Villa Papa
Giulio für die Zwecke einer National-Gallerte zu verwenden.
Ob die Regierung darauf eingehen wird, ist noch ungewiß. Fest
steht, daß sie mit den wenigen Mitteln, die ihr zur Verfügung
stehen, beständig neue Werke für die große Zukunftsgallerie an-
kanft, so neulich um 9000 Francs Cifariellos Bronzegruppe
„Christus und Magdalena". Möge es dem schönen Werke vergönnt
sein, in Bälde auch jemand anderen als nur die kahlen Wände
der Souterrains im Unterrichts-Ministerium zu erfreuen. lMo)
tr. Düsseldorf. Am 26. Oktober starb hier der Historien-
maler Philipp Grotjohann, geboren 27. Juni 1841 zu
Stettin, hervorragender Illustrator, dessen Zeichnungen zu den
Klassikern Lessing, Goethe und Schiller, zu Heines „Buch der
Lieder", zu Eichendorffs „Aus dem Leben eines Taugenichts",
Rudolf Baumbachs „Trugaold", Walter Scotts und Shakespeares
Werken als vorzügliche Illustrationen bekannt sind. Philipp
Grotjohann wollte sich anfangs dem Maschinenbausach widmen
und war Schlosserlehrling, später Geselle auf der Werft „Vulcan"
in Stettin. Später besuchte er das Polytechnikum in Hannover,
wo er die bildende Kunst kennen lernte und seinen Künstlerberuf
erkannte. Peter von Cornelius interessierte sich für ihn und
dieser und andre wohlwollende Gönner veranlagten, daß Grot-
johann nach Düsseldorf zu seiner künstlerischen Ausbildung ging.
Hier wurde er Schüler der Kunstakademie, speziell Carl Sohns
Schüler und nach dessen 1867 erfolgtem Tode war Carl Lasch
sein Lehrer. Großes Verdienst erwarb der Verstorbene sich bei
der Gründung des Zentralgewerbevereins. Er besaß ein seltenes
Talent für dekorative Arbeiten; insbesondere wurden seine Ent-
würfe zu Widmungsbildern, Diplomen, Adressen w. sehr geschätzt.
Sein Tod hinterläht eine sehr fühlbare Lücke. flsWs
tr. Düsseldorf. Am 28. Oktober ist der älteste Düssel-
dorfer Maler, der Stilllebcnmaler Josef Wilms, im Alter von
78 Jahren gestorben. Er ist einer der wenigen, die von der
ältesten Generation noch übrig waren, derjenigen, die als Schüler
zur hiesigen Akademie kamen, als Wilhelm von Schadow nach
dem Abgang von Peter von Cornelius die hiesige Kunstakademie
gänzlich reorganisierte. Joseph Wilms ist 1814 in Bilk bei
Düsseldorf geboren und war von 1829 bis 1851 ans der Akademie.
Seine Stilllebenbilder fanden Anerkennung; seine Figurenbilder
dagegen nicht. Gemalt hat er bis in die letzte Zeit. lisssi
Denkmäler
tb. Aus Rom schreibt man uns: Aus dem ersten Wett-
bewerb für ein in Turin zu errichtendes Denkmal des Prinzen
Amadeo von L-avoyen (Ex-Königs von Spanien) sind die Künstler
Calandra und Bistolfi (Turin), Romanelli (Florenz), Tedolini
(Rom), Marazzani (Piacenza) und endlich st'imenes als Sieger,
beziehungsweise als Teilnehmer einer zweiten, definitiven Kon-
kurrenz hervorgegangen. Die Ausstellung der neuen Skizzen
wird im Laus des Novembers im Palast der »Locietä ?romo-
trice äi belle arü, Via 2ecca« eröffnet. — Zwei neue Büsten
sind soeben in Montevarchi und Messina enthüllt worden, und
zwar in elfterer Stadt eine Büste Mazzinis von Pietro Guerri,
in Messina eine solche des berühmten Opernsängers Errico
Cherubim ton Sindoni. Die gute Stadt Messina hat auf diese
generöse Weise den Ausspruch Schillers widerlegt, daß „die Nach-
welt dem Mimen keine Kränze flechte." — Auf König Umbertos
Kosten wird das künstlerisch angelegte Ossarium auf dem Schlacht-
selde von Palestro — zu dessen Vollendung die Mittel fehlten —
nun ausgebaut werden. Die Einweihung findet am 30. Mai 1893,
dem vierunddreißigsten Jahrestag der Schlacht, statt. Ii54s;
'WO. Berlin. Das Konnte zur Errichtung eines Denkmals
für Kurfürst Friedrich l. bei Friesack hat am 1. November endlich
eine Entscheidung getroffen. Keiner der eingelieferten Entwürfe
ist vorläufig zur Ausführung bestimmt worden; die beiden Ent-
würfe von Johannes Boese und Professor Alexander Calandrelli
sind einstweilen zur engeren Wahl gestellt. Beide Künstler haben
vom Ausschuß die Aufforderung erhalten, gewisse Änderungen
an ihren Skizzen vorzunehmen. Nachdem dies geschehen, würde
die definitive Entscheidung erfolgen. Die Entwürfe von Heinz
Hoffmeister und Gomanski Hierselbst wurden durch ehrenvolle
Anerkennung ausgezeichnet.
tb. Rom. (Ein Suwarow-Denkmal ans dem Sct. Gotthard.)
In der Nähe des Ossariums des Sct. Gotthard, wo bekanntlich
bereits eine Gedächtnistafel an den berühmten Alpenübergang
der Russen (1799) erinnert, soll nun ein Monument errichtet
werden. Eine von der russischen Regierung entsandte Kommission
hat, mit Beteiligung schweizerischer Ingenieure, die betreffende
Stelle bereits in Augenschein genommen.
WO. Berlin. Der Bildhauer Max Baumbach hat
seinen mit dem ersten Preise ausgezeichneten Entwurf für das
Kaiser Friedrich-Denkmal bei Wörth nach den Wünschen des
Kaisers umgestaltet und hat dieser geänderte Entwurf die un-
bedingte Billigung des Herrschers erhalten. Der Künstler wird
nunmehr mit der Ausführung seines Werkes beginnen. Das
Standbild gelangt voraussichtlich im Jahre 1895 zur Ent-
hüllung.
Or. K. Die künstlerische Ausschmückung des Berliner Rat-
hauses ist in diesem Sommer um ein gutes Stück gefördert
worden. Für den oberen, zwei Treppen hoch gelegenen großen
Bürgersaal des „Roten Hauses" malt Professor August von
Heyden einen Fries, der unterhalb der Decke alle vier Wände
umzieht. Drei Seiten — eine Längswand und zwei Schmalwände
des oblongen Raumes — sind kürzlich fertiggestellt und im
Saal angebracht worden. Der Fries, der in Ölfarben auf gelb-
grundierter Leinwand gemalt ist, befindet sich so hoch vom Boden,
daß eine breite dekorative Behandlung und eine kräftige Sil-
houettierung notwendig war, um noch eine Wirkung herauszu-
bekommen. Gerade in dieser Beziehung aber ist die Ausführung
gut gelungen. Auf dem Fries sind kulturhistorische Szenen aus
dem Volksleben vom Mittelalter bis zu unfern Tagen im all-
gemeinen in chronologischer Folge, aber untereinander nur lose
zusammenhängend dargestellt. Glücklicherweise also keine gemalte
Geschichte Berlins, es wurden anerkennenswerter Weise überhaupt
keine historischen Ereignisse und Persönlichkeiten gewählt, sondern
gewissermaßen unpersönliche Volksszenen. Das aber ist Geschichts-
malerei im besten Sinn, weil sie die künstlerische Phantasie von
aller schulmeisterlichen Beschränkung befreit und ihr ungehindertes
Gestalten ermöglicht. Zur Lösung dieser Aufgabe war Heyden
durch seine gründliche Kentnis der Kultur- und Kostümgeschichte
besonders berufen, aber auch durch seine Gabe, figurenreiche Szenen
leicht und gefällig zu gruppieren. Die Reihe beginnt an der
Fensterwand mit der Darstellung einer Fähre an der Stelle des
jetzigen Mühlendamms, wo Wenden Säcke ausladen, es folgt
dann eine Visitation der Reisenden am Stadtthor, eine Pfingst-
feier, eine Gerichtssitzung über einen Raubritter, Jagd und Vogel-
herd. singende Schüler, eine Hochzeit, ein Schützenfest mit Arm-
brustschützen und einem ergötzlichen Wettrennen auf Ochsen, der
Auszug wandeinder Gesellen, eine Marktszene mit einem Quack-
salber, die Prüfung eines Meisterstücks durch die Zunft, die Über-
bringung der Zunftlade und der Fahne und schließlich zwei
Straßenszenen aus dem vorigen Jahrhundert: ein Ratsdiener,
der eine Verfügung des Magistrats ausrust und eine Dame in
einer Sänfte. Die vierte dem Eingang gegenüberliegende Wand
soll mit Szenen aus unserm Jahrhundert gefüllt werden, u. a.
einem Weihnachtsmarkt, einem Wochenmarkt und der Sedanseier.
Die einzelnen Szenen sind durch leichte Säulen, die mit Laub-
kränzen umwunden sind, von einander getrennt, wodurch die
fröhliche, festliche Stimmung, die durch alle Darstellungen geht,
noch erhöht wird. Vom gelben Grund heben sich die einzelnen
Figuren kräftig ab, in langem Zuge gehen die anmutigen Szenen
vorüber. Dabei ist alles ohne weiteres verständlich, nirgends
drängt sich gelehrte Altertümelei vor. Der Heydensche Fries ist
eine glückliche Bereicherung des Kunstbesitzes der Stadt. Im
Treppenhaus, das vor dem Bürgersaal liegt, arbeitet Mühlen-
bruch an großen Wandbildern. An der kurzen Stirnwand ist
die Wiedererstehung des deutschen Kaiserreiches gemalt, auf der
einen Längswand ist die Entwicklung Berlins zur Kaiserstadt dar-
gestellt. Auf der gegenüberliegenden Wand soll dann noch der
Einzug der Truppen in Berlin 1871 zur Anschauung gebracht
werden. Die Treppeuhausbilder sind gegenwärtig ganz verhüllt,
so daß über sie noch nichts verraten werden kann- Nb-sl
Preisausschreiben
tr. Düsseldorf. In der Konkurrenz betreffend die künst-
lerische Ausschmückung des Rathaussaales haben die Preisrichter
den ersten Preis dem Professor Albert Baur zugesprochen.
Über die Vergebung des zweiten Preises konnten sich die Preis-
10*