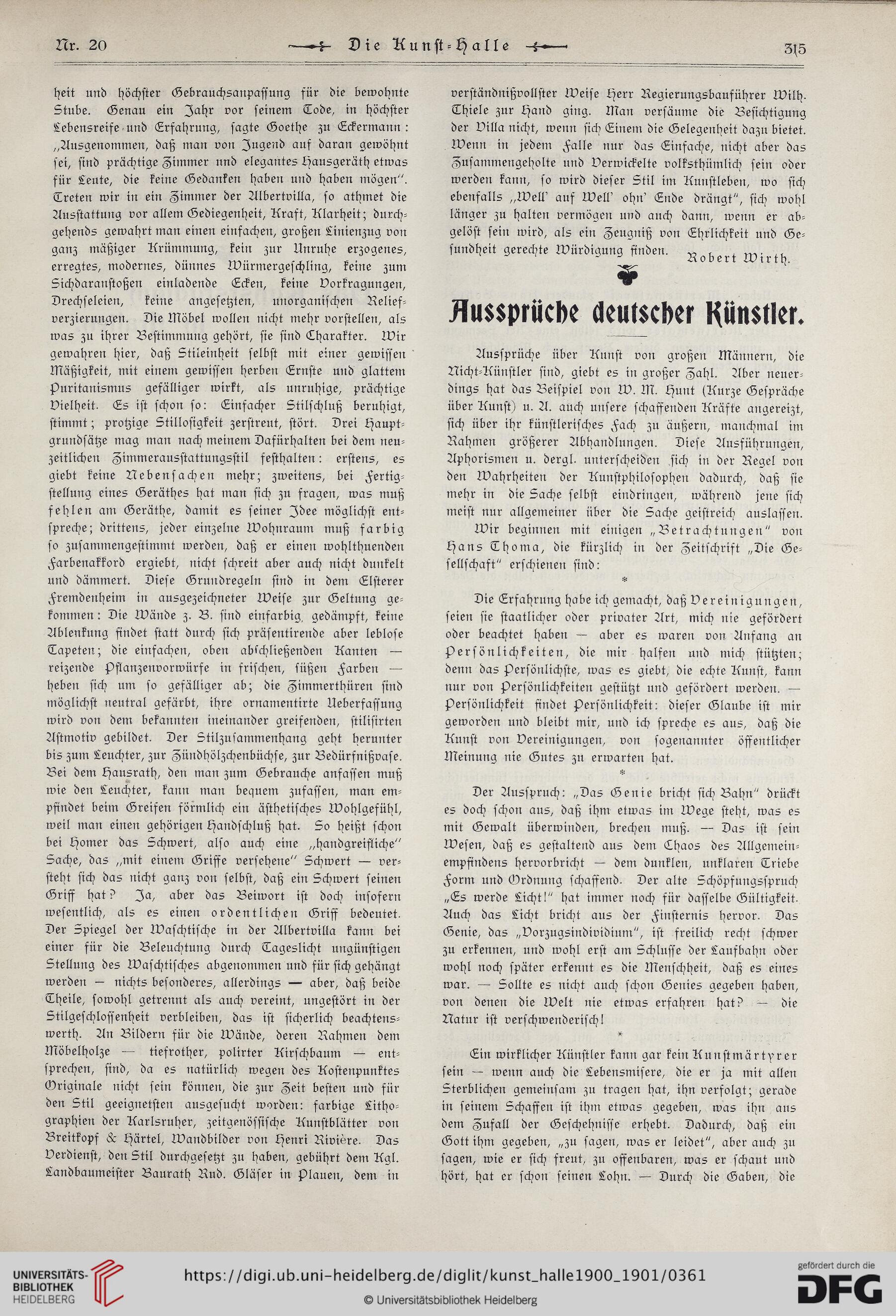Nr. 20
Die Aun st-Halle -L-
3(5
heit und höchster Gebrauchsanpassung sür die bewohnte
Stube. Genau ein Jahr vor seinem Tode, in höchster
Lebensreise und Erfahrung, sagte Goethe zu Eckermann:
„Ausgenommen, daß man von Jugend auf daran gewöhnt
sei, sind prächtige Zimmer und elegantes Hausgeräth etwas
für Leute, die keine Gedanken haben und haben mögen".
Treten wir in ein Zimmer der Albertvilla, so athmet die
Ausstattung vor allem Gediegenheit, Kraft, Klarheit; durch-
gehends gewahrt man einen einfachen, großen Linienzug von
ganz mäßiger Krümmung, kein zur Unruhe erzogenes,
erregtes, modernes, dünnes würmergeschling, keine zum
Sichdaranstoßen einladende Ecken, keine Vorkragungen,
Drechseleien, keine angesetzten, unorganischen Relief-
verzierungen. Die Möbel wollen nicht mehr vorstellen, als
was zu ihrer Bestimmung gehört, sie sind Eharakter. wir
gewahren hier, daß Stileinheit selbst mit einer gewissen
Mäßigkeit, mit einem gewissen herben Ernste und glattem
Puritanismus gefälliger wirkt, als unruhige, prächtige
Vielheit. Es ist schon so: Einfacher Stilschluß beruhigt,
stimmt; protzige Stillosigkeit zerstreut, stört. Drei Haupt-
grundsätze mag man nach meinem Dafürhalten bei dem neu-
zeitlichen Zimmerausstattungsstil festhalten: erstens, es
giebt keine Nebensachen mehr; zweitens, bei Fertig-
stellung eines Geräthes hat man sich zu fragen, was muß
fehlen am Geräthe, damit es seiner Idee möglichst ent-
spreche; drittens, jeder einzelne Wohnraum muß farbig
so zusammengestimmt werden, daß er einen wohlthuenden
Farbenakkord ergiebt, nicht schreit aber auch nicht dunkelt
und dämmert. Diese Grundregeln sind in dem Elfterer
Fremdenheim in ausgezeichneter weise zur Geltung ge-
kommen : Die wände z. B. sind einfarbig, gedämpft, keine
Ablenkung findet statt durch sich präsentirende aber leblose
Tapeten; die einfachen, oben abschließenden Kanten —
reizende Pflanzenvorwürfe in frischen, süßen Farben —
heben sich um so gefälliger ab; die Zimmerthüren sind
möglichst neutral gefärbt, ihre ornamentirte Ueberfassung
wird von dem bekannten ineinander greifenden, stilisirten
Astmotiv gebildet. Der Stilzusammenhang geht herunter
bis zum Leuchter, zur Zündhölzchenbüchse, zur Bedürfnißvase.
Bei dem Hausrath, den man zum Gebrauche anfassen muß
wie den Leuchter, kann man bequem zufassen, man em-
pfindet beim Greifen förmlich ein ästhetisches Wohlgefühl,
weil man einen gehörigen Handschluß hat. So heißt schon
bei Homer das Schwert, also auch eine „handgreifliche"
Sache, das „mit einem Griffe versehene" Schwert — ver-
steht sich das nicht ganz von selbst, daß ein Schwert seinen
Griff hat? Ja, aber das Beiwort ist doch insofern
wesentlich, als es einen ordentlichen Griff bedeutet.
Der Spiegel der Waschtische in der Albertvilla kann bei
einer für die Beleuchtung durch Tageslicht ungünstigen
Stellung des Waschtisches abgenommen und für sich gehängt
werden — nichts besonderes, allerdings — aber, daß beide
Theile, sowohl getrennt als auch vereint, ungestört in der
Stilgeschlossenheit verbleiben, das ist sicherlich beachtens-
werth. An Bildern für die wände, deren Rahmen dem
Möbelholze — tiefrother, polirter Kirschbaum — ent-
sprechen, sind, da es natürlich wegen des Kostenpunktes
Originale nicht sein können, die zur Zeit besten und für
den Stil geeignetsten ausgesucht worden: farbige Litho-
graphien der Karlsruher, zeitgenössische Kunstblätter von
Breitkopf A Härtel, Wandbilder von Henri Rivisre. Das
Verdienst, den Stil durchgesetzt zu haben, gebührt dem Kgl.
Landbaumeister Baurath Rud. Gläser in Plauen, dem in
verständnißvollster weise Herr Regierungsbauführer wilh.
Thiele zur Hand ging. Man versäume die Besichtigung
der Villa nicht, wenn sich Einem die Gelegenheit dazu bietet.
Wenn in jedem Falle nur das Einfache, nicht aber das
Zusammengeholte und verwickelte volksthümlich sein oder
werden kann, so wird dieser Stil im Kunstleben, wo sich
ebenfalls „well' auf well' ohn' Ende drängt", sich wohl
länger zu halten vermögen und auch dann, wenn er ab-
gelöst sein wird, als ein Zeugniß von Ehrlichkeit und Ge-
sundheit gerechte Würdigung finden, ^bert Wirth
G
Himpriicbe aeuttcbel Wnstler.
Aussprüche über Kunst von großen Männern, die
Nicht-Künstler sind, giebt es in großer Zahl. Aber neuer-
dings hat das Beispiel von W. M. Hunt (Kurze Gespräche
über Kunst) u. A. auch unsere schaffenden Kräfte angereizt,
sich über ihr künstlerisches Fach zu äußern, manchmal im
Rahmen größerer Abhandlungen. Diese Ausführungen,
Aphorismen u. dergl. unterscheiden sich in der Regel von
den Wahrheiten der Kunstphilosophen dadurch, daß sie
mehr in die Sache selbst eindringen, während jene sich
meist nur allgemeiner über die Sache geistreich auslassen.
wir beginnen mit einigen „Betrachtungen" von
Hans Thoma, die kürzlich in der Zeitschrift „Die Ge-
sellschaft" erschienen sind:
Die Erfahrung Hobe ich gemacht, daß Vereinigungen,
seien sie staatlicher oder privater Art, mich nie gefördert
oder beachtet haben — aber es waren von Anfang an
Persönlichkeiten, die mir halfen und mich stützten;
denn das persönlichste, was es giebt, die echte Kunst, kann
nur von Persönlichkeiten gestützt und gefördert werden. —
Persönlichkeit findet Persönlichkeit: dieser Glaube ist mir
geworden und bleibt mir, und ich spreche es aus, daß die
Kunst von Vereinigungen, von sogenannter öffentlicher
Meinung nie Gutes zu erwarten hat.
Der Ausspruch: „Das Genie bricht sich Bahn" drückt
es doch schon aus, daß ihm etwas im Wege steht, was es
mit Gewalt überwinden, brechen muß. — Das ist sein
Wesen, daß es gestalteud aus dem Lhaos des Allgemein-
empfindens hervorbricht — dem dunklen, unklaren Triebe
Form und Ordnung schaffend. Der alte Schöpfungssxruch
„Es werde LichtI" hat immer noch für dasselbe Gültigkeit.
Auch das Licht bricht aus der Finsternis hervor. Das
Genie, das „Vorzugsindividium", ist freilich recht schwer
zu erkennen, und wohl erst am Schluffe der Laufbahn oder
wohl noch später erkennt es die Menschheit, daß es eines
war. —- Sollte es nicht auch schon Genies gegeben haben,
von denen die Welt nie etwas erfahren hat? — die
Natur ist verschwenderisch!
Ein wirklicher Künstler kann gar kein Kunstmärtyrer
sein — wenn auch die Lebensmisere, die er ja mit allen
Sterblichen gemeinsam zu tragen hat, ihn verfolgt; gerade
in seinem Schaffen ist ihm etwas gegeben, was ihn aus
dem Zufall der Geschehnisse erhebt. Dadurch, daß ein
Gott ihm gegeben, „zu sagen, was er leidet", aber auch zu
sagen, wie er sich freut, zu offenbaren, was er schaut und
hört, hat er schon seinen Lohn. — Durch die Gaben, die
Die Aun st-Halle -L-
3(5
heit und höchster Gebrauchsanpassung sür die bewohnte
Stube. Genau ein Jahr vor seinem Tode, in höchster
Lebensreise und Erfahrung, sagte Goethe zu Eckermann:
„Ausgenommen, daß man von Jugend auf daran gewöhnt
sei, sind prächtige Zimmer und elegantes Hausgeräth etwas
für Leute, die keine Gedanken haben und haben mögen".
Treten wir in ein Zimmer der Albertvilla, so athmet die
Ausstattung vor allem Gediegenheit, Kraft, Klarheit; durch-
gehends gewahrt man einen einfachen, großen Linienzug von
ganz mäßiger Krümmung, kein zur Unruhe erzogenes,
erregtes, modernes, dünnes würmergeschling, keine zum
Sichdaranstoßen einladende Ecken, keine Vorkragungen,
Drechseleien, keine angesetzten, unorganischen Relief-
verzierungen. Die Möbel wollen nicht mehr vorstellen, als
was zu ihrer Bestimmung gehört, sie sind Eharakter. wir
gewahren hier, daß Stileinheit selbst mit einer gewissen
Mäßigkeit, mit einem gewissen herben Ernste und glattem
Puritanismus gefälliger wirkt, als unruhige, prächtige
Vielheit. Es ist schon so: Einfacher Stilschluß beruhigt,
stimmt; protzige Stillosigkeit zerstreut, stört. Drei Haupt-
grundsätze mag man nach meinem Dafürhalten bei dem neu-
zeitlichen Zimmerausstattungsstil festhalten: erstens, es
giebt keine Nebensachen mehr; zweitens, bei Fertig-
stellung eines Geräthes hat man sich zu fragen, was muß
fehlen am Geräthe, damit es seiner Idee möglichst ent-
spreche; drittens, jeder einzelne Wohnraum muß farbig
so zusammengestimmt werden, daß er einen wohlthuenden
Farbenakkord ergiebt, nicht schreit aber auch nicht dunkelt
und dämmert. Diese Grundregeln sind in dem Elfterer
Fremdenheim in ausgezeichneter weise zur Geltung ge-
kommen : Die wände z. B. sind einfarbig, gedämpft, keine
Ablenkung findet statt durch sich präsentirende aber leblose
Tapeten; die einfachen, oben abschließenden Kanten —
reizende Pflanzenvorwürfe in frischen, süßen Farben —
heben sich um so gefälliger ab; die Zimmerthüren sind
möglichst neutral gefärbt, ihre ornamentirte Ueberfassung
wird von dem bekannten ineinander greifenden, stilisirten
Astmotiv gebildet. Der Stilzusammenhang geht herunter
bis zum Leuchter, zur Zündhölzchenbüchse, zur Bedürfnißvase.
Bei dem Hausrath, den man zum Gebrauche anfassen muß
wie den Leuchter, kann man bequem zufassen, man em-
pfindet beim Greifen förmlich ein ästhetisches Wohlgefühl,
weil man einen gehörigen Handschluß hat. So heißt schon
bei Homer das Schwert, also auch eine „handgreifliche"
Sache, das „mit einem Griffe versehene" Schwert — ver-
steht sich das nicht ganz von selbst, daß ein Schwert seinen
Griff hat? Ja, aber das Beiwort ist doch insofern
wesentlich, als es einen ordentlichen Griff bedeutet.
Der Spiegel der Waschtische in der Albertvilla kann bei
einer für die Beleuchtung durch Tageslicht ungünstigen
Stellung des Waschtisches abgenommen und für sich gehängt
werden — nichts besonderes, allerdings — aber, daß beide
Theile, sowohl getrennt als auch vereint, ungestört in der
Stilgeschlossenheit verbleiben, das ist sicherlich beachtens-
werth. An Bildern für die wände, deren Rahmen dem
Möbelholze — tiefrother, polirter Kirschbaum — ent-
sprechen, sind, da es natürlich wegen des Kostenpunktes
Originale nicht sein können, die zur Zeit besten und für
den Stil geeignetsten ausgesucht worden: farbige Litho-
graphien der Karlsruher, zeitgenössische Kunstblätter von
Breitkopf A Härtel, Wandbilder von Henri Rivisre. Das
Verdienst, den Stil durchgesetzt zu haben, gebührt dem Kgl.
Landbaumeister Baurath Rud. Gläser in Plauen, dem in
verständnißvollster weise Herr Regierungsbauführer wilh.
Thiele zur Hand ging. Man versäume die Besichtigung
der Villa nicht, wenn sich Einem die Gelegenheit dazu bietet.
Wenn in jedem Falle nur das Einfache, nicht aber das
Zusammengeholte und verwickelte volksthümlich sein oder
werden kann, so wird dieser Stil im Kunstleben, wo sich
ebenfalls „well' auf well' ohn' Ende drängt", sich wohl
länger zu halten vermögen und auch dann, wenn er ab-
gelöst sein wird, als ein Zeugniß von Ehrlichkeit und Ge-
sundheit gerechte Würdigung finden, ^bert Wirth
G
Himpriicbe aeuttcbel Wnstler.
Aussprüche über Kunst von großen Männern, die
Nicht-Künstler sind, giebt es in großer Zahl. Aber neuer-
dings hat das Beispiel von W. M. Hunt (Kurze Gespräche
über Kunst) u. A. auch unsere schaffenden Kräfte angereizt,
sich über ihr künstlerisches Fach zu äußern, manchmal im
Rahmen größerer Abhandlungen. Diese Ausführungen,
Aphorismen u. dergl. unterscheiden sich in der Regel von
den Wahrheiten der Kunstphilosophen dadurch, daß sie
mehr in die Sache selbst eindringen, während jene sich
meist nur allgemeiner über die Sache geistreich auslassen.
wir beginnen mit einigen „Betrachtungen" von
Hans Thoma, die kürzlich in der Zeitschrift „Die Ge-
sellschaft" erschienen sind:
Die Erfahrung Hobe ich gemacht, daß Vereinigungen,
seien sie staatlicher oder privater Art, mich nie gefördert
oder beachtet haben — aber es waren von Anfang an
Persönlichkeiten, die mir halfen und mich stützten;
denn das persönlichste, was es giebt, die echte Kunst, kann
nur von Persönlichkeiten gestützt und gefördert werden. —
Persönlichkeit findet Persönlichkeit: dieser Glaube ist mir
geworden und bleibt mir, und ich spreche es aus, daß die
Kunst von Vereinigungen, von sogenannter öffentlicher
Meinung nie Gutes zu erwarten hat.
Der Ausspruch: „Das Genie bricht sich Bahn" drückt
es doch schon aus, daß ihm etwas im Wege steht, was es
mit Gewalt überwinden, brechen muß. — Das ist sein
Wesen, daß es gestalteud aus dem Lhaos des Allgemein-
empfindens hervorbricht — dem dunklen, unklaren Triebe
Form und Ordnung schaffend. Der alte Schöpfungssxruch
„Es werde LichtI" hat immer noch für dasselbe Gültigkeit.
Auch das Licht bricht aus der Finsternis hervor. Das
Genie, das „Vorzugsindividium", ist freilich recht schwer
zu erkennen, und wohl erst am Schluffe der Laufbahn oder
wohl noch später erkennt es die Menschheit, daß es eines
war. —- Sollte es nicht auch schon Genies gegeben haben,
von denen die Welt nie etwas erfahren hat? — die
Natur ist verschwenderisch!
Ein wirklicher Künstler kann gar kein Kunstmärtyrer
sein — wenn auch die Lebensmisere, die er ja mit allen
Sterblichen gemeinsam zu tragen hat, ihn verfolgt; gerade
in seinem Schaffen ist ihm etwas gegeben, was ihn aus
dem Zufall der Geschehnisse erhebt. Dadurch, daß ein
Gott ihm gegeben, „zu sagen, was er leidet", aber auch zu
sagen, wie er sich freut, zu offenbaren, was er schaut und
hört, hat er schon seinen Lohn. — Durch die Gaben, die