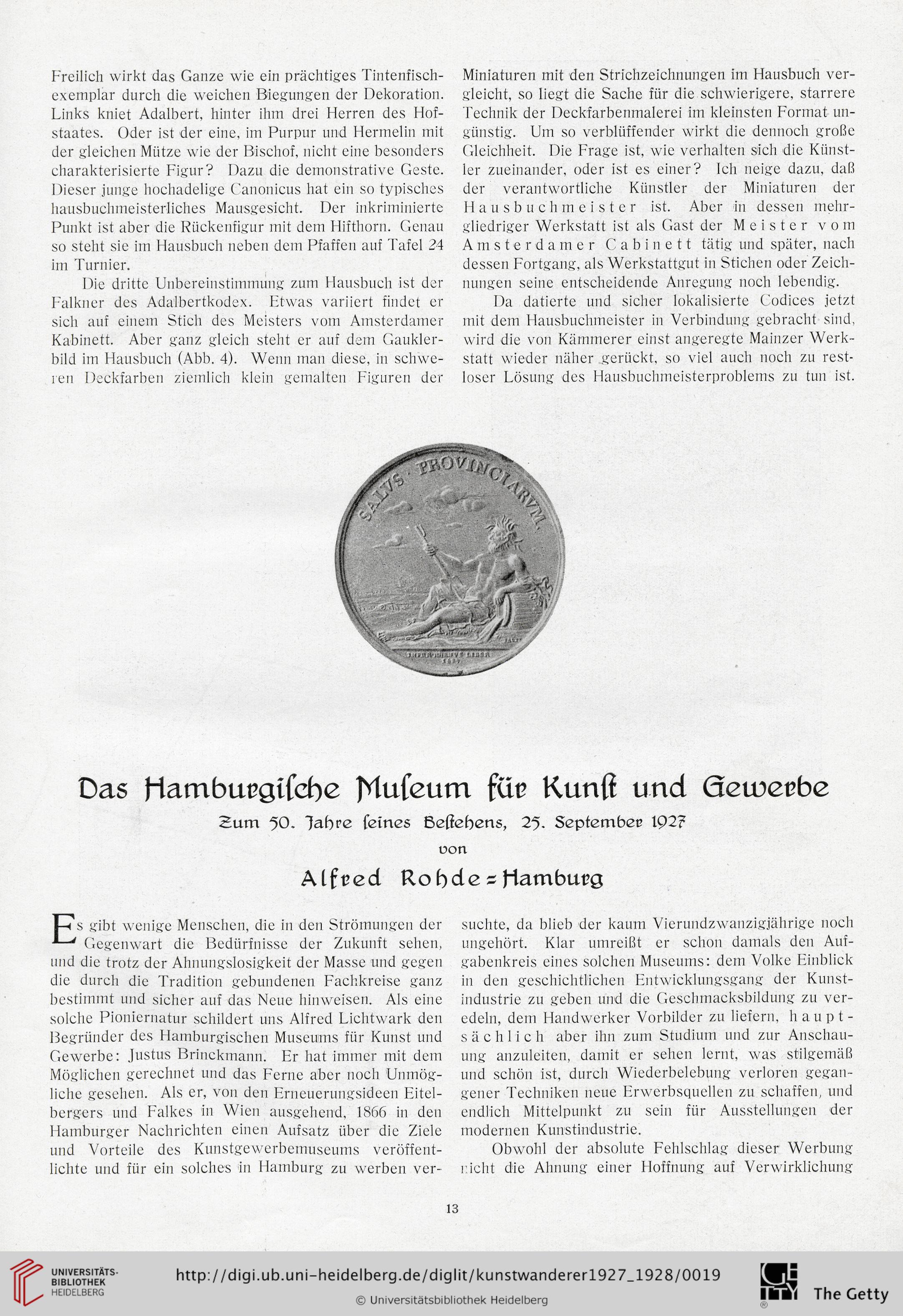Freilich wirkt das Ganze wie ein prächtiges Tintenfisch-
exemplar durch die weichen Biegungen der Dekoration.
Links kniet Adalbert, hinter ihm drei Herren des Hof-
staates. Oder ist der eine, im Purpur und Hermelin mit
der gleichen Mütze wie der Bischof, nicht eine besonders
charakterisierte Figur? Dazu die demonstrative Geste.
Dieser junge hochadelige Canonicus hat ein so typisches
hausbuchmeisterliches Mausgesicht. Der inkriminierte
Punkt ist aber die Rückenfigur mit dem Hifthorn. Genau
so steht sie im Hausbuch neben dem Pfaffen auf Tafel 24
im Turnier.
Die dritte Unbereinstimmung zum Hausbuch ist der
Falkner des Adalbertkodex. Etwas variicrt findet er
sich auf einem Stich des Meisters vom Amsterdamer
Kabinett. Aber ganz gleich steht er auf dem Gaukler-
bild im Hausbuch (Abb. 4). Wenn man diese, in schwe-
ren Deckfarben ziemlich klein gemalten Figuren der
Miniaturen mit den Strichzeichnungen im Hausbuch ver-
gleicht, so liegt die Sache für die schwierigere, starrere
Technik der Deckfarbenmalerei im kleinsten Format un-
günstig. Um so verbliiffender wirkt die dennoch großc
Gleichheit. Die Frage ist, wic verhalten sich die Kiinst-
ler zueinander, oder ist es einer? Ich neige dazu, daß
der verantwortliche Kiinstler der Miniaturen der
Hausbuchmeister ist. Aber in dessen mehr-
gliedriger Werkstatt ist als Gast der M e i s t e r v o m
Amsterdamer Cabinett tätig und später, nach
dessen Fortgang, als Werkstattgut in Stichen oder Zeicli-
nungen seine entscheidende Anregung noch lebendig.
Da datierte und sicher lokalisierte Codices jetzt
mit dem Hausbuchmeister in Verbindung gebracht sind,
wird die von Kämmerer einst angeregte Mainzer Werk-
statt wieder näher gerückt, so viel auch noch zu rest-
loser Lösung des Hausbuchmeisterproblems zu tun ist.
Das Hambucgtfebe Nufeum füt? Kun(f und Qetuerbe
2um 50. labfc feincs Bcßcbcns, 25- Scptcmbcc 192?
üon
Alft?ed Robde s Jiambut?g
l-t s gibt wenige Menschen, die in den Strömungen der
Gegenwart die Bedürfnisse der Zukunft sehen,
und die trotz der Ahnungslosigkeit der Masse und gegen
die durch die Tradition gebundenen Fachkreise ganz
bestimmt und sicher auf das Neue hinweisen. Als eine
solche Pioniernatur schildert uns Alfred Lichtwark den
Begründer des Hamburgischen Museums für Kunst und
Gewerbe: Justus Brinckmann. Er hat immer mit dem
Möglichen gerechnet und das Ferne aber noch Unmög-
liclie geschen. Als er, von den Erneuerungsideen Eitel-
bcrgers und Falkes in Wien ausgehend, 1866 in dcn
Hamburger Nachrichten einen Aufsatz über die Ziele
und Vorteile des Kunstgewerbemuseums veröffent-
lichte und für ein solches in Hamburg zu werben ver-
suchte, da blieb der kaum Vierundzwanzigjährige noch
ungehört. Klar umreißt er schon damals den Auf-
gabenkreis eines solchen Museums: dem Volke Einblick
in den geschichtlichen Entwicklungsgang der Kunst-
industrie zu geben und die Geschmacksbildung zu ver-
cdeln, dem Handwerker Vorbilder zu liefern, h a u p t -
s ä c h 1 i c h aber ihn zum Studium und zur Anschau-
ung anzuleiten, damit er sehen lernt, was stilgemäß
und schön ist, durch Wiederbelebung verloren gegan-
gener Techniken neue Erwerbsquellen zu schaffen, und
endlich Mittelpuukt zu scin für Ausstellungen der
modernen Kunstindustrie.
Obwohl der absolute Fehlschlag dieser Werbung
r.icht die Ahnung einer Hoffnung auf Verwirklichung
13
exemplar durch die weichen Biegungen der Dekoration.
Links kniet Adalbert, hinter ihm drei Herren des Hof-
staates. Oder ist der eine, im Purpur und Hermelin mit
der gleichen Mütze wie der Bischof, nicht eine besonders
charakterisierte Figur? Dazu die demonstrative Geste.
Dieser junge hochadelige Canonicus hat ein so typisches
hausbuchmeisterliches Mausgesicht. Der inkriminierte
Punkt ist aber die Rückenfigur mit dem Hifthorn. Genau
so steht sie im Hausbuch neben dem Pfaffen auf Tafel 24
im Turnier.
Die dritte Unbereinstimmung zum Hausbuch ist der
Falkner des Adalbertkodex. Etwas variicrt findet er
sich auf einem Stich des Meisters vom Amsterdamer
Kabinett. Aber ganz gleich steht er auf dem Gaukler-
bild im Hausbuch (Abb. 4). Wenn man diese, in schwe-
ren Deckfarben ziemlich klein gemalten Figuren der
Miniaturen mit den Strichzeichnungen im Hausbuch ver-
gleicht, so liegt die Sache für die schwierigere, starrere
Technik der Deckfarbenmalerei im kleinsten Format un-
günstig. Um so verbliiffender wirkt die dennoch großc
Gleichheit. Die Frage ist, wic verhalten sich die Kiinst-
ler zueinander, oder ist es einer? Ich neige dazu, daß
der verantwortliche Kiinstler der Miniaturen der
Hausbuchmeister ist. Aber in dessen mehr-
gliedriger Werkstatt ist als Gast der M e i s t e r v o m
Amsterdamer Cabinett tätig und später, nach
dessen Fortgang, als Werkstattgut in Stichen oder Zeicli-
nungen seine entscheidende Anregung noch lebendig.
Da datierte und sicher lokalisierte Codices jetzt
mit dem Hausbuchmeister in Verbindung gebracht sind,
wird die von Kämmerer einst angeregte Mainzer Werk-
statt wieder näher gerückt, so viel auch noch zu rest-
loser Lösung des Hausbuchmeisterproblems zu tun ist.
Das Hambucgtfebe Nufeum füt? Kun(f und Qetuerbe
2um 50. labfc feincs Bcßcbcns, 25- Scptcmbcc 192?
üon
Alft?ed Robde s Jiambut?g
l-t s gibt wenige Menschen, die in den Strömungen der
Gegenwart die Bedürfnisse der Zukunft sehen,
und die trotz der Ahnungslosigkeit der Masse und gegen
die durch die Tradition gebundenen Fachkreise ganz
bestimmt und sicher auf das Neue hinweisen. Als eine
solche Pioniernatur schildert uns Alfred Lichtwark den
Begründer des Hamburgischen Museums für Kunst und
Gewerbe: Justus Brinckmann. Er hat immer mit dem
Möglichen gerechnet und das Ferne aber noch Unmög-
liclie geschen. Als er, von den Erneuerungsideen Eitel-
bcrgers und Falkes in Wien ausgehend, 1866 in dcn
Hamburger Nachrichten einen Aufsatz über die Ziele
und Vorteile des Kunstgewerbemuseums veröffent-
lichte und für ein solches in Hamburg zu werben ver-
suchte, da blieb der kaum Vierundzwanzigjährige noch
ungehört. Klar umreißt er schon damals den Auf-
gabenkreis eines solchen Museums: dem Volke Einblick
in den geschichtlichen Entwicklungsgang der Kunst-
industrie zu geben und die Geschmacksbildung zu ver-
cdeln, dem Handwerker Vorbilder zu liefern, h a u p t -
s ä c h 1 i c h aber ihn zum Studium und zur Anschau-
ung anzuleiten, damit er sehen lernt, was stilgemäß
und schön ist, durch Wiederbelebung verloren gegan-
gener Techniken neue Erwerbsquellen zu schaffen, und
endlich Mittelpuukt zu scin für Ausstellungen der
modernen Kunstindustrie.
Obwohl der absolute Fehlschlag dieser Werbung
r.icht die Ahnung einer Hoffnung auf Verwirklichung
13