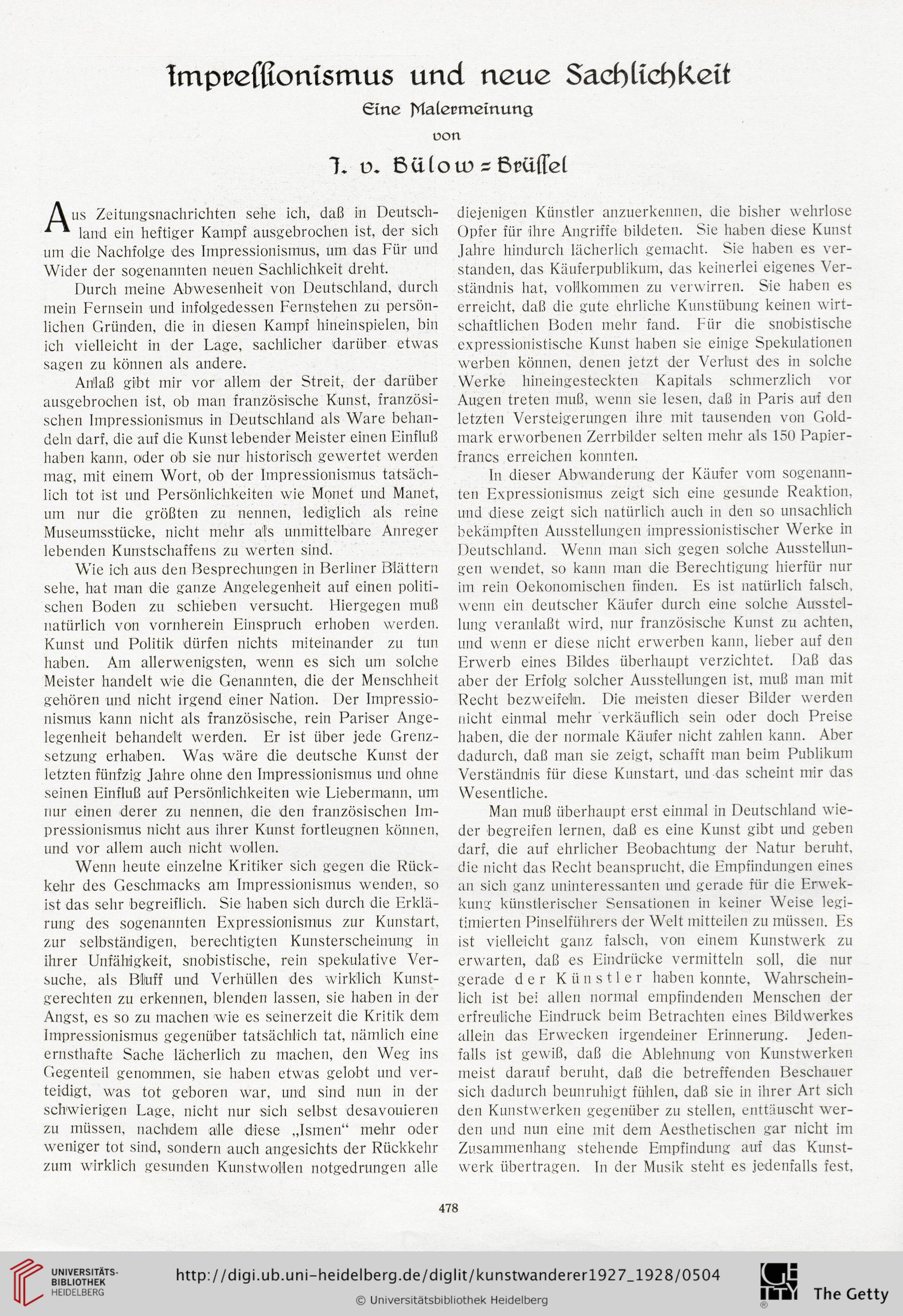tmpt?efßomsmus und neue SacbUcbkett
6ine Jvlalet’memung
oon
7. v, Bülotü s Bt?ü(rct
Aus Zeitungsnachrichten sehe ich, daß in Deutsch-
** land ein heftiger Kampf ausgebrochen ist, der sich
um die Nachfolge des Impressionismus, um das Für und
Wider der sogenannten neuen Sachlichkeit dreht.
Durch meine Abwesenheit von Deutschland, durch
mein Fernsein und infolgedessen Fernstehen zu persön-
lichen Gründen, die in diesen Kampf hineinspielen, bin
ich vielleicht in der Lage, sachlicher darüber etwas
sagen zu können als andere.
An'Iaß gi'bt mir vor allem der Streit, der darüber
ausgebrochen ist, ob man französische Kunst, französi-
schen Impressionismus in Deutschland als Ware behan-
deln darf, die auf die Kunst lebender Meister einen Einfluß
haben kann, oder ob sie nur historisch gewertet werden
mag, mit einem Wort, ob der Impressionismus tatsäch-
lich tot ist und Persönlichkeiten wie Monet und Manet,
um nur die größten zu nennen, lediglich als reine
Museumsstücke, nicht mehr afs unmittelbare Anreger
lebenden Kunstschaffens zu werten sind.
Wie ich aus den Besprechungen in Berliner Blättern
sehe, hat man die ganze Angelegenheit auf einen politi-
schen Boden zu schieben versucht. Hiergegen tnuß
natürlich von vornherein Einspruch erhoben werden.
Kunst und Politik dürfen nichts miteinander zu tun
haben. Am allerwenigsten, wenn es sich um solche
Meister handelt wie die Genannten, die der Menschheit
gehören und nicht irgend einer Nation. Der Impressio-
nismu's kann nicht als französische, rein Pariser Ange-
legenheit behandett werden. Er ist über jede Grenz-
setzung erhaben. Was wäre die deutsche Kunst der
letzten fünfzig Jahre ohne den Impressionismus und ohne
seinen Einfluß auf Persönlichkeiten wie Liebermann, um
riur einen derer zu nennen, die den französischen 1m-
pressionismus nicht aus ihrer Kunst fortleugnen können,
und vor allem auch nicht wollen.
Wenn lieute einzelne Kritiker sicli gegen die Rück-
kehr des Geschmacks am Impressionismus wenden, so
ist das sehr begreiflich. Sie haben sich durch die Erklä-
rung des sogenannteu Expressionismus zur Kunstart,
zur selbständigen, berechtigten Kunsterscheinung in
ihrer Unfäh'igkeit, snobistische, rein spekulative Ver-
suche, als B'ltuff und Verhüllen des wirklich Kunst-
gerechten zu erkennen, blenden lassen, sie haben in der
Angst, es so zu machen wie es seinerzeit die Kritik dem
Impressionismus gegenüber tatsächlich tat, nämlich eine
ernsthafte Sache lächerlich zu machen, den Weg ins
Gegenteil genommen, sie haben etwas gelobt und ver-
teidigt, was tot geboren war, und sind nun in der
schwierigen Lage, niclit nur sich selbst desavouieren
zu müssen, nachdem alle diese „Ismen“ mehr oder
weniger tot sind, sondern auch angesichts der Rtickkehr
zum wirklich gesunden Kunstwollen notgedrungen alle
diejenigen Künstler anzuerkennen, die bisher wehrlose
Opfer für ihre Angriffe bildeten. Sie haben diese Kunst
Jahre hindurch lächerlich gemacht. Sie haben es ver-
standen, das Käuferpublikum, das keinerlei eigenes Ver-
ständnis hat, vollkommen zu verwirren. Sie haben es
erreicht, daß die gute ehrliche Kunstübung keinen wirt-
schaftlichen Boden mehr fand. Fiir die snobistische
expressionistische Kunst haben sie einige Spekulationen
werben können, denen jetzt der Verlüst des in solche
Werke hineingesteckten Kapitals schmerzlich vor
Augen treten muß, wenn sie lesen, daß in Paris auf den
letzten Versteigerungen ihre mit tausenden von Gold-
mark erworbenen Zerrbilder selten mehr als 150 Papier-
francs erreichen konnten.
In dieser Abwanderung der Käufer vom sogenann-
ten Expressionismus zeigt sich eine gesunde Reaktion,
und diese zeigt sich natürlich auch in den so unsachlich
bekämpften Ausstellungen impressionistischer Werke in
Deutschland. Wenn man sich gegen solche Ausstellun-
gen wendet, so kann man die Berechtigung hierfür nur
im rein Oekonomischen finden. Es ist natürlich falsch,
wenn ein deutscher Käufer durch eine solche Au’sstel-
lung veranlaßt wird, nur französische Kunst zu achten,
Lind wenn er diese nicht erwerben kann, lieber auf den
Erwerb eines Bildes überhaupt verzichtet. Daß das
aber der Erfolg solcher Ausstellungen ist, muß man mit
Recht bezweifehi. Die meisten dieser Bilder werden
nicht einmal mehr verkäuflich sein oder doch Preise
haben, die der normale Käufer nicht zahlen kann. Aber
dadurch, daß man sie zeigt, schafft man beim Publikum
Verständnis für diese Kunstart, und das scheint mir das
Wesentliche.
Man muß überhaupt erst einmal in Deutschland wie-
der begreifen lernen, daß es eine Kunst gibt und geben
darf, die auf ehrlicher Beobachtung der Natur beruht,
die nicht das Recht beansprucht, die Empfindungen eines
an sicli ganz uninteressanten und gerade für die Erwek-
kung künstlerischer Sensationen in keiner Weise legi-
timierten Pinselführers dcr Welt mitteilen zu müssen. Es
ist vielleicht ganz falsch, von einem Kunstwerk zu
erwarten, daß es Eindrücke vermitteln soll, die nur
gerade der Künstler haben konnte, Wahrschein-
lich ist bei allen normal empfindenden Menschen der
erfreulliche Eindruck beim Betrachten eines Bildwerkes
allein das Erwecken irgendeiner Erinnerung. Jeden-
falls ist gewiß, daß die Ablehnung von Kunstwerken
meist darauf beruht, daß die betreffenden Beschauer
sich dadurch beunruhigt fühlen, daß sie in ihrer Art sich
den Kunstwerken gegenüber zu stellen, enttäuscht wer-
den und nun eine mit dem Aesthetischen gar nicht im
Zusammenhang stehende Empfindung auf das Kunst-
werk übertragen. In der Musik steht es jedenfalls fest,
478
6ine Jvlalet’memung
oon
7. v, Bülotü s Bt?ü(rct
Aus Zeitungsnachrichten sehe ich, daß in Deutsch-
** land ein heftiger Kampf ausgebrochen ist, der sich
um die Nachfolge des Impressionismus, um das Für und
Wider der sogenannten neuen Sachlichkeit dreht.
Durch meine Abwesenheit von Deutschland, durch
mein Fernsein und infolgedessen Fernstehen zu persön-
lichen Gründen, die in diesen Kampf hineinspielen, bin
ich vielleicht in der Lage, sachlicher darüber etwas
sagen zu können als andere.
An'Iaß gi'bt mir vor allem der Streit, der darüber
ausgebrochen ist, ob man französische Kunst, französi-
schen Impressionismus in Deutschland als Ware behan-
deln darf, die auf die Kunst lebender Meister einen Einfluß
haben kann, oder ob sie nur historisch gewertet werden
mag, mit einem Wort, ob der Impressionismus tatsäch-
lich tot ist und Persönlichkeiten wie Monet und Manet,
um nur die größten zu nennen, lediglich als reine
Museumsstücke, nicht mehr afs unmittelbare Anreger
lebenden Kunstschaffens zu werten sind.
Wie ich aus den Besprechungen in Berliner Blättern
sehe, hat man die ganze Angelegenheit auf einen politi-
schen Boden zu schieben versucht. Hiergegen tnuß
natürlich von vornherein Einspruch erhoben werden.
Kunst und Politik dürfen nichts miteinander zu tun
haben. Am allerwenigsten, wenn es sich um solche
Meister handelt wie die Genannten, die der Menschheit
gehören und nicht irgend einer Nation. Der Impressio-
nismu's kann nicht als französische, rein Pariser Ange-
legenheit behandett werden. Er ist über jede Grenz-
setzung erhaben. Was wäre die deutsche Kunst der
letzten fünfzig Jahre ohne den Impressionismus und ohne
seinen Einfluß auf Persönlichkeiten wie Liebermann, um
riur einen derer zu nennen, die den französischen 1m-
pressionismus nicht aus ihrer Kunst fortleugnen können,
und vor allem auch nicht wollen.
Wenn lieute einzelne Kritiker sicli gegen die Rück-
kehr des Geschmacks am Impressionismus wenden, so
ist das sehr begreiflich. Sie haben sich durch die Erklä-
rung des sogenannteu Expressionismus zur Kunstart,
zur selbständigen, berechtigten Kunsterscheinung in
ihrer Unfäh'igkeit, snobistische, rein spekulative Ver-
suche, als B'ltuff und Verhüllen des wirklich Kunst-
gerechten zu erkennen, blenden lassen, sie haben in der
Angst, es so zu machen wie es seinerzeit die Kritik dem
Impressionismus gegenüber tatsächlich tat, nämlich eine
ernsthafte Sache lächerlich zu machen, den Weg ins
Gegenteil genommen, sie haben etwas gelobt und ver-
teidigt, was tot geboren war, und sind nun in der
schwierigen Lage, niclit nur sich selbst desavouieren
zu müssen, nachdem alle diese „Ismen“ mehr oder
weniger tot sind, sondern auch angesichts der Rtickkehr
zum wirklich gesunden Kunstwollen notgedrungen alle
diejenigen Künstler anzuerkennen, die bisher wehrlose
Opfer für ihre Angriffe bildeten. Sie haben diese Kunst
Jahre hindurch lächerlich gemacht. Sie haben es ver-
standen, das Käuferpublikum, das keinerlei eigenes Ver-
ständnis hat, vollkommen zu verwirren. Sie haben es
erreicht, daß die gute ehrliche Kunstübung keinen wirt-
schaftlichen Boden mehr fand. Fiir die snobistische
expressionistische Kunst haben sie einige Spekulationen
werben können, denen jetzt der Verlüst des in solche
Werke hineingesteckten Kapitals schmerzlich vor
Augen treten muß, wenn sie lesen, daß in Paris auf den
letzten Versteigerungen ihre mit tausenden von Gold-
mark erworbenen Zerrbilder selten mehr als 150 Papier-
francs erreichen konnten.
In dieser Abwanderung der Käufer vom sogenann-
ten Expressionismus zeigt sich eine gesunde Reaktion,
und diese zeigt sich natürlich auch in den so unsachlich
bekämpften Ausstellungen impressionistischer Werke in
Deutschland. Wenn man sich gegen solche Ausstellun-
gen wendet, so kann man die Berechtigung hierfür nur
im rein Oekonomischen finden. Es ist natürlich falsch,
wenn ein deutscher Käufer durch eine solche Au’sstel-
lung veranlaßt wird, nur französische Kunst zu achten,
Lind wenn er diese nicht erwerben kann, lieber auf den
Erwerb eines Bildes überhaupt verzichtet. Daß das
aber der Erfolg solcher Ausstellungen ist, muß man mit
Recht bezweifehi. Die meisten dieser Bilder werden
nicht einmal mehr verkäuflich sein oder doch Preise
haben, die der normale Käufer nicht zahlen kann. Aber
dadurch, daß man sie zeigt, schafft man beim Publikum
Verständnis für diese Kunstart, und das scheint mir das
Wesentliche.
Man muß überhaupt erst einmal in Deutschland wie-
der begreifen lernen, daß es eine Kunst gibt und geben
darf, die auf ehrlicher Beobachtung der Natur beruht,
die nicht das Recht beansprucht, die Empfindungen eines
an sicli ganz uninteressanten und gerade für die Erwek-
kung künstlerischer Sensationen in keiner Weise legi-
timierten Pinselführers dcr Welt mitteilen zu müssen. Es
ist vielleicht ganz falsch, von einem Kunstwerk zu
erwarten, daß es Eindrücke vermitteln soll, die nur
gerade der Künstler haben konnte, Wahrschein-
lich ist bei allen normal empfindenden Menschen der
erfreulliche Eindruck beim Betrachten eines Bildwerkes
allein das Erwecken irgendeiner Erinnerung. Jeden-
falls ist gewiß, daß die Ablehnung von Kunstwerken
meist darauf beruht, daß die betreffenden Beschauer
sich dadurch beunruhigt fühlen, daß sie in ihrer Art sich
den Kunstwerken gegenüber zu stellen, enttäuscht wer-
den und nun eine mit dem Aesthetischen gar nicht im
Zusammenhang stehende Empfindung auf das Kunst-
werk übertragen. In der Musik steht es jedenfalls fest,
478