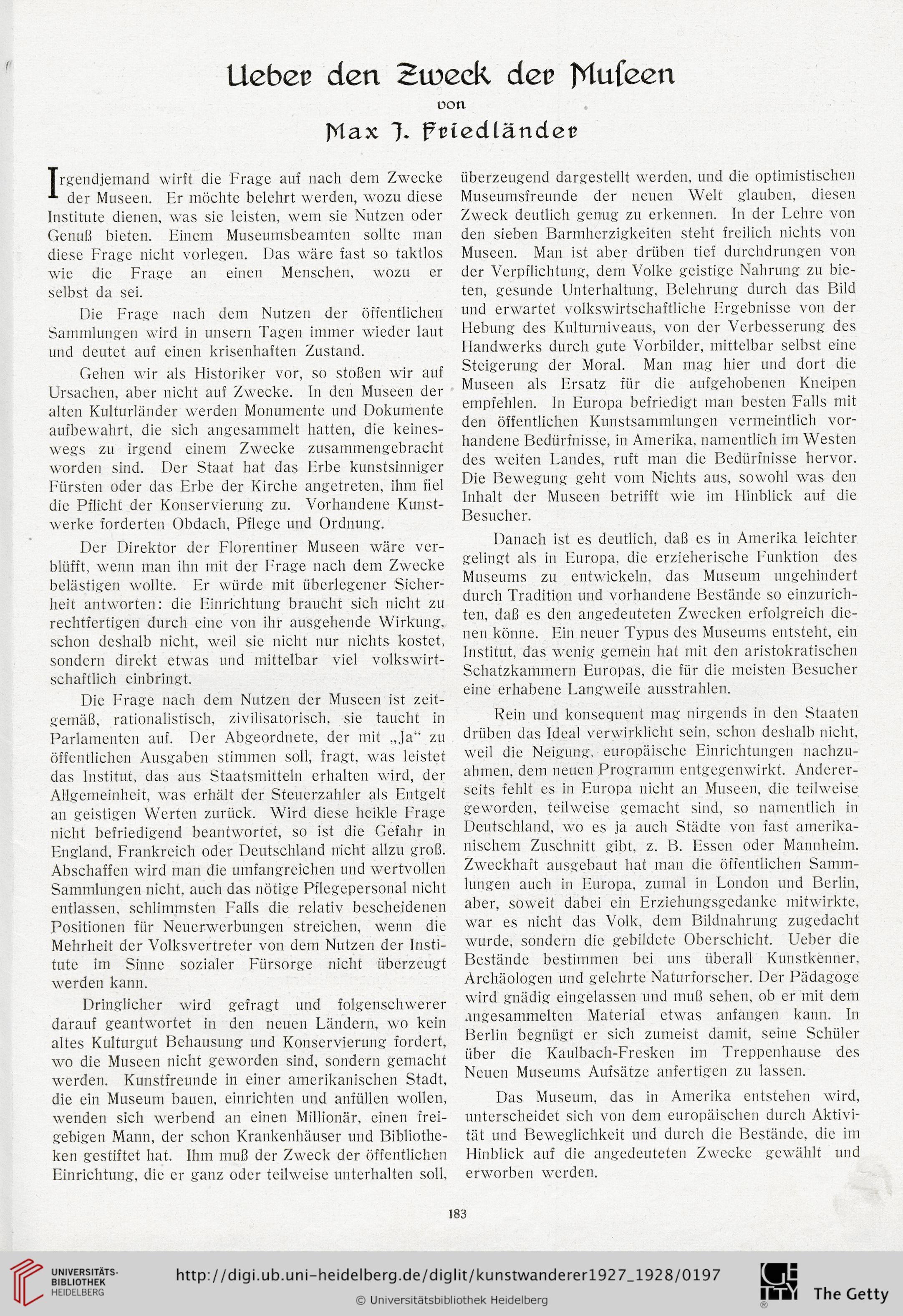Uebet? den Stneek det? fvlufeeti
oon
Hax 1. fviedländev
Trgendjemand wirft die Frage auf nach dem Zwecke
der Museen. Er möchte belehrt werden, wozu diese
Institute dienen, was sie leisten, wem sie Nutzen oder
Genuß bieten. Einein Museumsbeamten sollte man
diese Frage nicht vorlegen. Das wäre fast so taktlos
wie die Frage an einen Menschen, wozu er
selbst da sei.
Die Frage nacli dem Nutzen der öffentlichen
Sammlungen wird in unsern Tagen immer wieder laut
und deutet auf einen krisenhaften Zustand.
Gehen wir als Historiker vor, so stoßen wir auf
Ursachen, aber nicht auf Zwecke. In den Museen der
alten Kulturländer werden Monumente und Dokumente
aufbewahrt, die sich angesammelt hatten, die keities-
wegs zu irgend einem Zwecke zusammengebracht
worden sind. Der Staat hat das Erbe kunstsinniger
Fürsten oder das Erbe der Kirche angetreten, ihm fiel
die Pflicht der Konservierung zu. Vorhandene Kunst-
werke forderten Obdach, Pflege und Ordnung.
Der Direktor der Fiorentiner Museen wäre ver-
blüfft, wenn man ihn mit der Frage nach dem Zwecke
belästigen wollte. Er würde mit überlegener Sicher-
lieit antwortcn: die Einrichtung braucht sich nicht zu
rechtfertigen durch eine von ihr ausgehende Wirkung,
schon deshalb nicht, weil sie nicht nur nichts kostet,
sondern direkt etwas und mittelbar viel volkswirt-
schaftlich einbringt.
Die Frage nach dem Nutzen der Museen ist zeit-
gemäß, rationalistisch, zivilisatorisch, sie taucht in
Parlamenten auf. Der Abgeordnete, dcr mit „Ja“ zu
öffentlichen Ausgaben stimmen soll, fragt, was leistet
das Institut, das aus Staatsmitteln erhalten wird, der
Ailgemeinheit, was erhält der Steuerzahler als Entgelt
an geistigen Werten zurück. Wird diese heiklc Frage
nicht befriedigend beantwortet, so ist die Gefahr in
England, Frankreich oder Deutschland nicht allzu groß.
Abschaffen wird man die umfangreichen und wertvollen
Sammlungen nicht, auch das nötige Pflegepersonal nicht
entlassen, schlimmsten Falls die relativ bescheidenen
Positionen für Neuerwerbungen streichen, wenn die
Mehrheit der Volksvertreter von dem Nutzen der Insti-
tute im Sinne sozialer Fürsorge nicht iiberzeugt
werden kann.
Dringlicher wird gefragt und folgenschwerer
darauf geantwortet in den neuen Ländern, wo kein
altes Kulturgut Behausung und Konservierung fordert,
wo die Museen nicht geworden sind, sondern gemacht
werden. Kunstfreunde in einer amerikanischen Stadt,
die ein Museum bauen, einrichten und anftillen wollen,
wenden sich werbend an einen Millionär, einen frei-
gebigen Mann, der schon Krankenhäuser und Bibliothe-
ken gestiftet hat. Ihm muß der Zweck der öffentlichen
Einrichtung, die er ganz oder teilweise unterhalten soll,
überzeugend dargestellt werden, und die optimistischen
Museumsfreunde der neuen Welt glauben, diesen
Zweck deutlich genug zu erkennen. In der Lehre von
den sieben Barmherzigkeiten steht freilich nichts von
Museen. Man ist aber driiben tief durchdrungen von
der Verpflichtung, dem Volke geistige Nahrung zu bie-
ten, gesunde Unterhaltung, Belehrung durch das Bild
und erwartet volkswirtschaftliche Ergebnisse von der
Hebung des Kulturniveaus, von der Verbesserung des
Handwerks durch gute Vorbilder, mittelbar selbst eine
Steigerung der Moral. Man mag hier und dort die
Museen als Ersatz fiir dic aufgehobenen Kneipen
empfehlen. In Europa befriedigt man bcsten Falls mit
den öffentlichen Kunstsammlungen vermeintlich vor-
handene Bediirfnisse, in Amerika, namentlich im Westen
des weiten Landes, ruft man die Bediirfnisse hervor.
Die Bewegung geht vom Nichts aus, sowohl was den
Inhalt der Museen betrifft wie im Hinblick auf die
Besucher.
Danach ist es deutlich, daß es in Amerika leichter
gelingt als in Europa, die erzieherische Funktion des
Museums zu entwickeln, das Museum ungehindert
durch Tradition und vorhandene Bestände so einzurich-
ten, daß es dcn angedeuteten Zwecken erfolgreich die-
nen könne. Ein neuer Typus des Museums entsteht, ein
Institut, das wenig gemein liat mit den aristokratischen
Schatzkammern Europas, die für die meisten Besucher
eine erhabene Langweile ausstrahlen.
Rein und konsequent mag nirgends in den Staaten
drüben das Ideal verwirklicht sein, schon deshalb nicht,
weil die Neigung, europäische Einrichtungen nachzu-
ahmen, dem neuen Programm entgegenwirkt. Anderer-
seits fehlt es in Europa nicht an Museen, die teilweise
geworden, teilweise gemacht sind, so namcntlich in
Deutschland, wo es ja aucli Städte von fast amerika-
nischem Zuschnitt gibt, z. B. Essen oder Mannheim.
Zweckhaft ausgebaut hat man die öffentlichen Samm-
lungen aucli in Europa, zumal in London und Berlin,
aber, soweit dabei ein Erziehungsgedanke mitwirkte,
war es nicht das Volk, dem Bildnahrung zugedacht
wurde, sondern die gebildete Oberschicht. Ueber die
Bestände bestimmen bei uns überall Kunstkenner,
Archäologen und gelehrte Naturforscher. Der Pädagoge
wird gnädig eingelassen und muß sehen, ob er mit dem
angesammelten Material etwas anfängen kann. In
Berlin begnügt cr sich zumeist damit, seine Schiiler
über die Kaulbach-Fresken im Treppenhause des
Neuen Museums Aufsätze anfertigen zu lassen.
Das Museum, das in Amerika entstehen wird,
unterscheidet sich von dem europäischen durch Aktivi-
tät und Beweglichkeit und durch die Bestände, die im
Hinblick auf die angedeuteten Zwecke gewählt und
erworben werden.
183
oon
Hax 1. fviedländev
Trgendjemand wirft die Frage auf nach dem Zwecke
der Museen. Er möchte belehrt werden, wozu diese
Institute dienen, was sie leisten, wem sie Nutzen oder
Genuß bieten. Einein Museumsbeamten sollte man
diese Frage nicht vorlegen. Das wäre fast so taktlos
wie die Frage an einen Menschen, wozu er
selbst da sei.
Die Frage nacli dem Nutzen der öffentlichen
Sammlungen wird in unsern Tagen immer wieder laut
und deutet auf einen krisenhaften Zustand.
Gehen wir als Historiker vor, so stoßen wir auf
Ursachen, aber nicht auf Zwecke. In den Museen der
alten Kulturländer werden Monumente und Dokumente
aufbewahrt, die sich angesammelt hatten, die keities-
wegs zu irgend einem Zwecke zusammengebracht
worden sind. Der Staat hat das Erbe kunstsinniger
Fürsten oder das Erbe der Kirche angetreten, ihm fiel
die Pflicht der Konservierung zu. Vorhandene Kunst-
werke forderten Obdach, Pflege und Ordnung.
Der Direktor der Fiorentiner Museen wäre ver-
blüfft, wenn man ihn mit der Frage nach dem Zwecke
belästigen wollte. Er würde mit überlegener Sicher-
lieit antwortcn: die Einrichtung braucht sich nicht zu
rechtfertigen durch eine von ihr ausgehende Wirkung,
schon deshalb nicht, weil sie nicht nur nichts kostet,
sondern direkt etwas und mittelbar viel volkswirt-
schaftlich einbringt.
Die Frage nach dem Nutzen der Museen ist zeit-
gemäß, rationalistisch, zivilisatorisch, sie taucht in
Parlamenten auf. Der Abgeordnete, dcr mit „Ja“ zu
öffentlichen Ausgaben stimmen soll, fragt, was leistet
das Institut, das aus Staatsmitteln erhalten wird, der
Ailgemeinheit, was erhält der Steuerzahler als Entgelt
an geistigen Werten zurück. Wird diese heiklc Frage
nicht befriedigend beantwortet, so ist die Gefahr in
England, Frankreich oder Deutschland nicht allzu groß.
Abschaffen wird man die umfangreichen und wertvollen
Sammlungen nicht, auch das nötige Pflegepersonal nicht
entlassen, schlimmsten Falls die relativ bescheidenen
Positionen für Neuerwerbungen streichen, wenn die
Mehrheit der Volksvertreter von dem Nutzen der Insti-
tute im Sinne sozialer Fürsorge nicht iiberzeugt
werden kann.
Dringlicher wird gefragt und folgenschwerer
darauf geantwortet in den neuen Ländern, wo kein
altes Kulturgut Behausung und Konservierung fordert,
wo die Museen nicht geworden sind, sondern gemacht
werden. Kunstfreunde in einer amerikanischen Stadt,
die ein Museum bauen, einrichten und anftillen wollen,
wenden sich werbend an einen Millionär, einen frei-
gebigen Mann, der schon Krankenhäuser und Bibliothe-
ken gestiftet hat. Ihm muß der Zweck der öffentlichen
Einrichtung, die er ganz oder teilweise unterhalten soll,
überzeugend dargestellt werden, und die optimistischen
Museumsfreunde der neuen Welt glauben, diesen
Zweck deutlich genug zu erkennen. In der Lehre von
den sieben Barmherzigkeiten steht freilich nichts von
Museen. Man ist aber driiben tief durchdrungen von
der Verpflichtung, dem Volke geistige Nahrung zu bie-
ten, gesunde Unterhaltung, Belehrung durch das Bild
und erwartet volkswirtschaftliche Ergebnisse von der
Hebung des Kulturniveaus, von der Verbesserung des
Handwerks durch gute Vorbilder, mittelbar selbst eine
Steigerung der Moral. Man mag hier und dort die
Museen als Ersatz fiir dic aufgehobenen Kneipen
empfehlen. In Europa befriedigt man bcsten Falls mit
den öffentlichen Kunstsammlungen vermeintlich vor-
handene Bediirfnisse, in Amerika, namentlich im Westen
des weiten Landes, ruft man die Bediirfnisse hervor.
Die Bewegung geht vom Nichts aus, sowohl was den
Inhalt der Museen betrifft wie im Hinblick auf die
Besucher.
Danach ist es deutlich, daß es in Amerika leichter
gelingt als in Europa, die erzieherische Funktion des
Museums zu entwickeln, das Museum ungehindert
durch Tradition und vorhandene Bestände so einzurich-
ten, daß es dcn angedeuteten Zwecken erfolgreich die-
nen könne. Ein neuer Typus des Museums entsteht, ein
Institut, das wenig gemein liat mit den aristokratischen
Schatzkammern Europas, die für die meisten Besucher
eine erhabene Langweile ausstrahlen.
Rein und konsequent mag nirgends in den Staaten
drüben das Ideal verwirklicht sein, schon deshalb nicht,
weil die Neigung, europäische Einrichtungen nachzu-
ahmen, dem neuen Programm entgegenwirkt. Anderer-
seits fehlt es in Europa nicht an Museen, die teilweise
geworden, teilweise gemacht sind, so namcntlich in
Deutschland, wo es ja aucli Städte von fast amerika-
nischem Zuschnitt gibt, z. B. Essen oder Mannheim.
Zweckhaft ausgebaut hat man die öffentlichen Samm-
lungen aucli in Europa, zumal in London und Berlin,
aber, soweit dabei ein Erziehungsgedanke mitwirkte,
war es nicht das Volk, dem Bildnahrung zugedacht
wurde, sondern die gebildete Oberschicht. Ueber die
Bestände bestimmen bei uns überall Kunstkenner,
Archäologen und gelehrte Naturforscher. Der Pädagoge
wird gnädig eingelassen und muß sehen, ob er mit dem
angesammelten Material etwas anfängen kann. In
Berlin begnügt cr sich zumeist damit, seine Schiiler
über die Kaulbach-Fresken im Treppenhause des
Neuen Museums Aufsätze anfertigen zu lassen.
Das Museum, das in Amerika entstehen wird,
unterscheidet sich von dem europäischen durch Aktivi-
tät und Beweglichkeit und durch die Bestände, die im
Hinblick auf die angedeuteten Zwecke gewählt und
erworben werden.
183