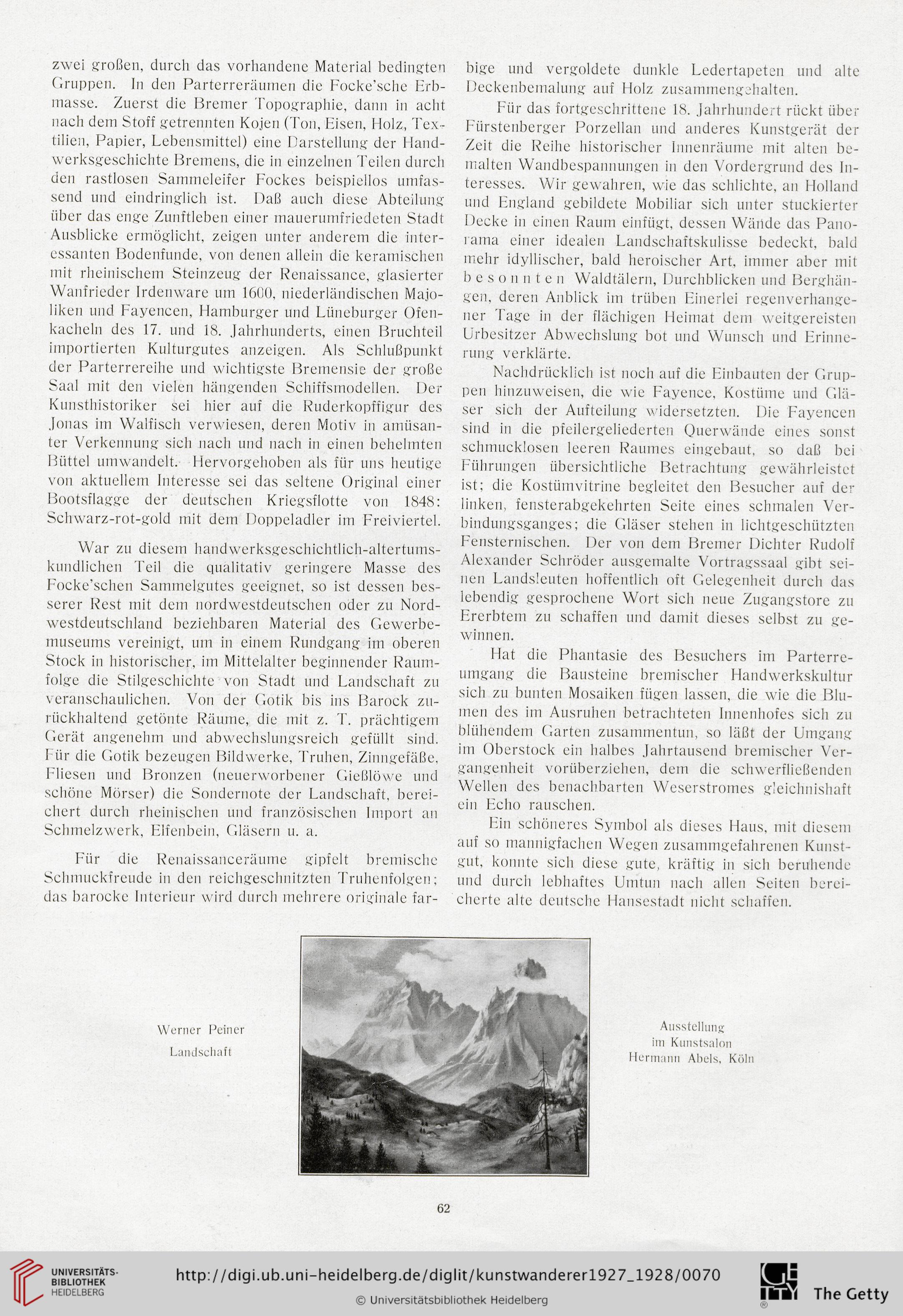zwei großen, durch das vorhandene Material bedingten
Gruppen. In den Parterreräumen die Focke’sche Erb-
masse. Zuerst die Bremcr Topographie, dann in acht
nach dem Stoff getrennten Kojen (Ton, Eisen, Holz, Tex-
tilien, Papier, Lebensmittel) eine Darstellung der Hand-
werksgeschichte Bremens, die in einzelnen Teilen durch
den rastlosen Sammeleifer Fockes beispieilos umfas-
send und eindringlich ist. Daß auch diese Abteilung
iiber das enge Zunftleben einer mauerumfriedeten Stadt
Ausblicke ermöglicht, zeigen unter anderem die inter-
essanten Bodenfunde, von denen allein die keramischen
mit rheinischem Steinzeug der Renaissance, glasierter
Wanfrieder Irdenware um 1600, niederlätidischen Majo-
liken und Fayencen, Hamburger und Lüneburger Ofen-
kacheln des 17. und 18. Jahrhunderts, einen Bruchteil
importierten Kulturgutes anzeigen. Als Schlußpunkt
der Parterrereihe und wichtigste Bremensie der große
Saal mit den vielen hängenden Schiffsrnodellen. Der
Kunsthistoriker sei hier auf die Ruderkopffigur des
Jonas im Walfisch verwiesen, deren Motiv in amüsan-
ter Verkennung sich nach und nach in einen behelmten
Büttel umwandelt. Hervorgehoben als für uns heutige
von aktuellem Interesse sei das seltene Original einer
Bootsflagge der deutschen Kriegsflotte von 1848:
Schwarz-rot-gold mit dem Doppeladler im Freiviertel.
War zu diesem handwerksgeschichtlich-altertums-
kundlichen Teil die quaiitativ geringcre Masse des
Focke’schen Sammelgutes geeignet, so ist dessen bes-
serer Rest mit dem nordwestdeutschen oder zu Nord-
westdeutschland beziehbaren Material des Gewerbe-
museums vereinigt, urn in einetn Rundgang im oberen
Stock in historischer, im Mittelalter beginnender Raum-
folge die Stilgeschichte von Stadt und Landschaft zu
veranschaulichen. Von dcr Gotik bis ins Barock zu-
rückhaltend getönte Räume, die mit z. T. prächtigem
Gerät angenehm und abwechslungsreich gefüllt sind.
Für die Gotik bezeugen Bildwerke, Truhen, Zinngefäße,
Fliesen und Bronzen (neuerworbener Gießlöwe und
schöne Mörser) die Sondernote der Landschaft, berei-
cliert durch rheinischen und französischen Import an
Schmelzwerk, Elfenbein, Gläsern u. a.
Für die Renaissanceräume gipfelt bremische
Schmuckfreude in den reichgeschnitzten Truhenfolgen;
das barocke Interieur wird durch mehrere originale far-
bige und vergoldete dunkle Ledertapeten und alte
Deckenbemalung auf Holz zusammengehalten.
Für das fortgeschrittene 18. Jahrhundert rückt über
Fürstenberger Porzellan und anderes Kunstgerät der
Zeit die Reihe historischer Innenräume mit alten be-
malten Wandbespannungen in den Vordergrund des In-
teresses. Wir gewahren, wie das schlichte, an Holland
und England gebildete Mobiliar sich unter stuckierter
Decke in einen Raum einfügt, dessen Wähde das Pano-
rama einer idealen Landschaftskulisse bedeckt, bald
mehr idyllischer, bald heroischer Art, immer aber mit
besonnte n Waldtälern, Durchblicken und Berghän-
gen, deren Anblick im trüben Einerlei regenverhange-
ner Tage in der flächigen Heimat dem weitgereisten
Urbesitzer Abwechslung bot und Wunsch und Erinne-
rung verklärte.
Nachdrücklich ist noch auf die Einbauten der Grup-
pen hinzuweisen, die wie Fayence, Kostüme und Glä-
ser sich der Aufteilung widersetzten. Die Fayencen
sind in die pfeilergeliederten Querwäude eines sonst
schmucklosen leeren Raumes eingebaut, so daß bei
Führungen übersichtliche Betrachtung gewährleistet
ist; die Kostümvitrine begleitet den Besucher auf der
linken, fensterabgekehrten Seite eities schmalen Ver-
bindungsganges; die Gläser stehen in lichtgeschützten
Fensternischen. Der von dem Bremer Dichter Rudolf
Alexander Scltröder ausgemalte Vortragssaal gibt sei-
nen Landsleuten hoffentlich oft Gelegenheit durch das
lebendig gesprochene Wort siclt neue Zugangstore zu
Ererbtem zu schaffen und damit dieses selbst zu ge-
winnen.
Hat die Phantasie des Besuchers im Parterre-
umgang die Bausteine bremischer Handwerkskultur
sich zu bunten Mosaiken fügen lassen, die wie die Blu-
men des im Ausruhen betrachteten Innenhofes sicli zu
blühendem Garten zusammentun, so läßt der Umgang
im Oberstock ein halbes Jahrtausend bremischer Ver-
gangenheit vorüberziehen, dem die schwerfließenden
Wellen des benachbarten Weserstromes gleichnlshaft
ein Echo rauschen.
Ein schöneres Symbol als dieses Haus, mit diesern
auf so mannigfachen Wegen zusammgefahrenen Kunst-
gut, konnte sicli diese gute, kräftig in sich berühende
und durch lebhaftes Umtun nach allen Seiten berei-
cherte alte deutsche Hansestadt nicht schaffen.
62
Gruppen. In den Parterreräumen die Focke’sche Erb-
masse. Zuerst die Bremcr Topographie, dann in acht
nach dem Stoff getrennten Kojen (Ton, Eisen, Holz, Tex-
tilien, Papier, Lebensmittel) eine Darstellung der Hand-
werksgeschichte Bremens, die in einzelnen Teilen durch
den rastlosen Sammeleifer Fockes beispieilos umfas-
send und eindringlich ist. Daß auch diese Abteilung
iiber das enge Zunftleben einer mauerumfriedeten Stadt
Ausblicke ermöglicht, zeigen unter anderem die inter-
essanten Bodenfunde, von denen allein die keramischen
mit rheinischem Steinzeug der Renaissance, glasierter
Wanfrieder Irdenware um 1600, niederlätidischen Majo-
liken und Fayencen, Hamburger und Lüneburger Ofen-
kacheln des 17. und 18. Jahrhunderts, einen Bruchteil
importierten Kulturgutes anzeigen. Als Schlußpunkt
der Parterrereihe und wichtigste Bremensie der große
Saal mit den vielen hängenden Schiffsrnodellen. Der
Kunsthistoriker sei hier auf die Ruderkopffigur des
Jonas im Walfisch verwiesen, deren Motiv in amüsan-
ter Verkennung sich nach und nach in einen behelmten
Büttel umwandelt. Hervorgehoben als für uns heutige
von aktuellem Interesse sei das seltene Original einer
Bootsflagge der deutschen Kriegsflotte von 1848:
Schwarz-rot-gold mit dem Doppeladler im Freiviertel.
War zu diesem handwerksgeschichtlich-altertums-
kundlichen Teil die quaiitativ geringcre Masse des
Focke’schen Sammelgutes geeignet, so ist dessen bes-
serer Rest mit dem nordwestdeutschen oder zu Nord-
westdeutschland beziehbaren Material des Gewerbe-
museums vereinigt, urn in einetn Rundgang im oberen
Stock in historischer, im Mittelalter beginnender Raum-
folge die Stilgeschichte von Stadt und Landschaft zu
veranschaulichen. Von dcr Gotik bis ins Barock zu-
rückhaltend getönte Räume, die mit z. T. prächtigem
Gerät angenehm und abwechslungsreich gefüllt sind.
Für die Gotik bezeugen Bildwerke, Truhen, Zinngefäße,
Fliesen und Bronzen (neuerworbener Gießlöwe und
schöne Mörser) die Sondernote der Landschaft, berei-
cliert durch rheinischen und französischen Import an
Schmelzwerk, Elfenbein, Gläsern u. a.
Für die Renaissanceräume gipfelt bremische
Schmuckfreude in den reichgeschnitzten Truhenfolgen;
das barocke Interieur wird durch mehrere originale far-
bige und vergoldete dunkle Ledertapeten und alte
Deckenbemalung auf Holz zusammengehalten.
Für das fortgeschrittene 18. Jahrhundert rückt über
Fürstenberger Porzellan und anderes Kunstgerät der
Zeit die Reihe historischer Innenräume mit alten be-
malten Wandbespannungen in den Vordergrund des In-
teresses. Wir gewahren, wie das schlichte, an Holland
und England gebildete Mobiliar sich unter stuckierter
Decke in einen Raum einfügt, dessen Wähde das Pano-
rama einer idealen Landschaftskulisse bedeckt, bald
mehr idyllischer, bald heroischer Art, immer aber mit
besonnte n Waldtälern, Durchblicken und Berghän-
gen, deren Anblick im trüben Einerlei regenverhange-
ner Tage in der flächigen Heimat dem weitgereisten
Urbesitzer Abwechslung bot und Wunsch und Erinne-
rung verklärte.
Nachdrücklich ist noch auf die Einbauten der Grup-
pen hinzuweisen, die wie Fayence, Kostüme und Glä-
ser sich der Aufteilung widersetzten. Die Fayencen
sind in die pfeilergeliederten Querwäude eines sonst
schmucklosen leeren Raumes eingebaut, so daß bei
Führungen übersichtliche Betrachtung gewährleistet
ist; die Kostümvitrine begleitet den Besucher auf der
linken, fensterabgekehrten Seite eities schmalen Ver-
bindungsganges; die Gläser stehen in lichtgeschützten
Fensternischen. Der von dem Bremer Dichter Rudolf
Alexander Scltröder ausgemalte Vortragssaal gibt sei-
nen Landsleuten hoffentlich oft Gelegenheit durch das
lebendig gesprochene Wort siclt neue Zugangstore zu
Ererbtem zu schaffen und damit dieses selbst zu ge-
winnen.
Hat die Phantasie des Besuchers im Parterre-
umgang die Bausteine bremischer Handwerkskultur
sich zu bunten Mosaiken fügen lassen, die wie die Blu-
men des im Ausruhen betrachteten Innenhofes sicli zu
blühendem Garten zusammentun, so läßt der Umgang
im Oberstock ein halbes Jahrtausend bremischer Ver-
gangenheit vorüberziehen, dem die schwerfließenden
Wellen des benachbarten Weserstromes gleichnlshaft
ein Echo rauschen.
Ein schöneres Symbol als dieses Haus, mit diesern
auf so mannigfachen Wegen zusammgefahrenen Kunst-
gut, konnte sicli diese gute, kräftig in sich berühende
und durch lebhaftes Umtun nach allen Seiten berei-
cherte alte deutsche Hansestadt nicht schaffen.
62