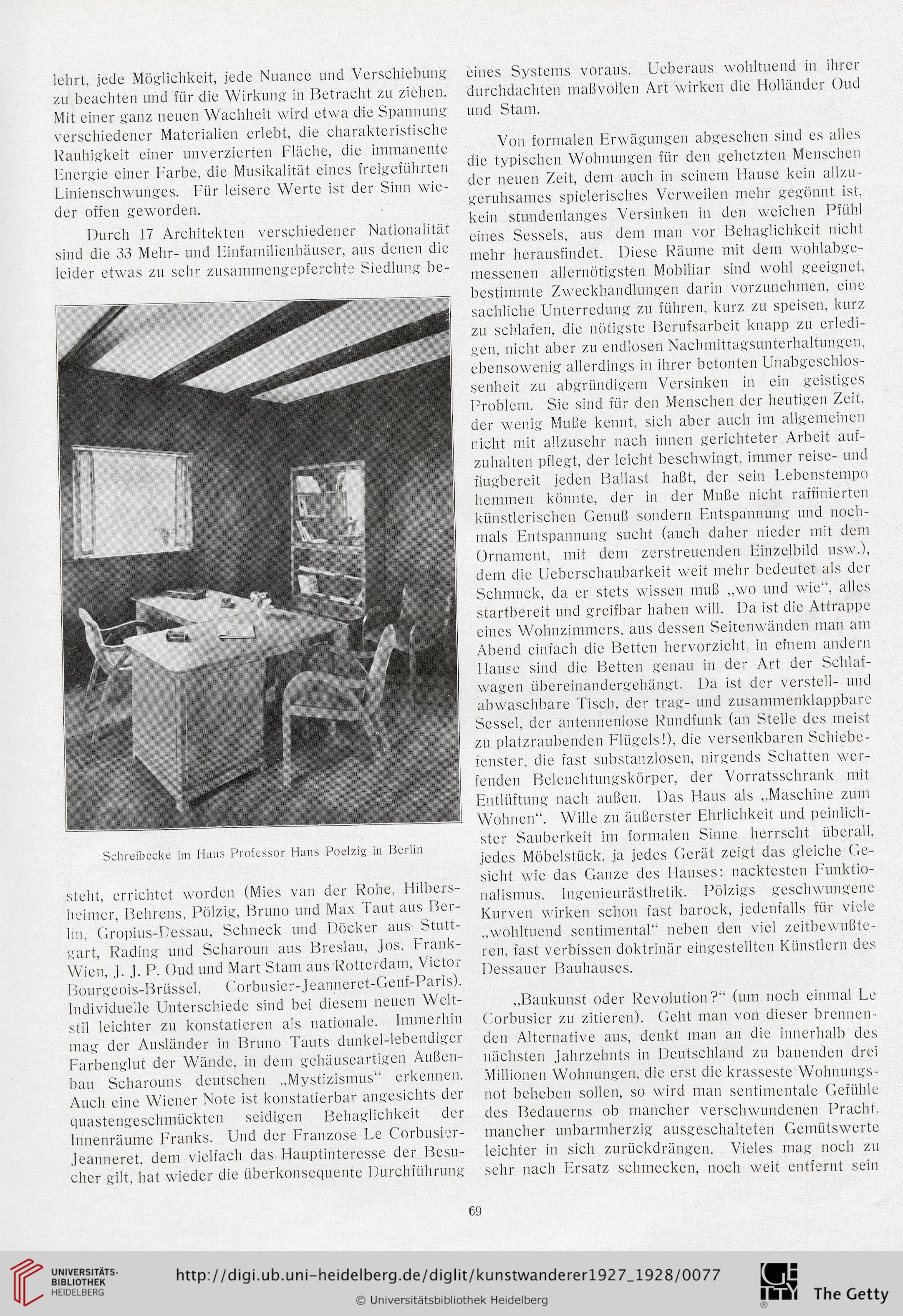lehrt, jede Möglichkeit, jede Nuance und Verschiebung
zu beachten und für die Wirkung in Betracht zu ziehen.
Mit einer ganz neuen Wachheit wird ctwa die Spannung
verschiedener Materialien erlebt, die charakteristische
Rauhigkeit eincr unverzierten Fläche, die immanente
Energie einer Farbe, die Musikalität eiues freigeführten
Linienschwunges. Für leisere Werte ist der Sinn wie-
der offen geworden.
Durch 17 Architekten verschiedener Nationalität
sind die 33 Mehr- und Einfamilienhäuser, aus denen die
leider etwas zu sehr zusammengepferchte Siedlung be-
Schreibecke im Haus Professor Hans Poelzig in Berlin
steht, errichtet worden (Mies van der Rohe, Hilbers-
heirner, Behrens, Pölzig, Bruno und Max Taut aus Ber-
hn, Gropius-Dessau, Schneck und Döcker aus Stutt-
gart, Rading und Scharoun aus Breslau, Jos. Frank-
Wien, J. J. P. Oud und Mart Stam aus Rotterdam, Victor
Bourgeois-Brüssel, Corbusier-Jeanneret-Genf-Paris).
Individuelle Unterschiede sind bei diesetn neuen Welt-
stil leichter zu konstatieren als nationale. Immerhiu
mag dcr Ausländer in Bruno J'auts dunkel-lebendiger
Farbenglut der Wände, in dem gehäuseartigen Außen-
bau Scharouns deutschen „Mystizismus“ erkeunen.
Auch eine Wiener Note ist konstatierbar angesichts der
quastengeschmückten seidigen Behaglichkeit dcr
Innenräume Franks. Und der Franzose Le Corbusier-
Jeanneret, dem vielfach das Hauptinteresse der Besu-
cher gilt, hat wieder die überkonsequente Durchfiihrung
eines Systems voraus. Ueberaus wohltuend in ihrer
durchdachten maßvollen Art wirken die Holländer Oud
und Stam.
Von formalen Erwägungen abgesehen sind es alles
die typischen Wohnungen für den gehetzten Menschen
der neuen Zeit, dem auch in seinem Hause kein allzu-
geruhsames spielerisches Verweilen mehr gegönnt ist,
kein stundenlanges Versinken in den weichen Pfühl
eines Sessels, aus dem man vor Behaglichkeit nicht
mehr herausfindet. Diese Räume mit dem wohlabge-
messenen allernötigsten Mobiliar sind wohl geeignet,
bestimmte Zweckhandlungen darin vorzunehmen, eine
sachliche Unterredung zu fiihren, kurz zu speisen, kurz
zu schlafen, die nötigste Berufsarbeit knapp zu crledi-
gen, nicht aber zu endlosen Nachmittagsunterhaltungen,
ebensowenig allerdings in ihrer betonten Unäbgeschlos-
senheit zu abgründigem Versinken in ein geistiges
Problem. Sie sind für den Menschen der heutigen Zeit,
der wenig Muße kennt, sich aber auch im allgemeinen
nicht mit allzusehr nach innen gerichteter Arbeit auf-
zuhalten pflegt, der leicht beschwingt, immer reise- und
flugbereit jeden Ballast haßt, der sein Lebenstempo
hemmen könnte, der in der Muße nicht raffinierten
künstlerischen Genuß sondern Entspannung und noch-
mals Entspannung sucht (aucli daher nieder mit dem
Ornament, mit dem zerstreuenden Einzelbild usw.),
dem die Ueberschaubarkeit weit mehr bedeutct als dcr
Schmuck, da er stets wissen muß „wo und wie“, allcs
startbereit und greifbar haben will. Da ist die Attrappe
eines Wohnzimmers, aus dessen Seitenwänden man am
Abend einfach die Betten hervorzieht, in einem andern
Hause sind die Betten genau in der Art der Schlaf-
wagen übereinandergehängt. Da ist der verstell- und
abwaschbare Tisch, dcr trag- und zusammenklappbare
Sessel. der antennenlose Rundfunk (an Stclle des meist
zu platzraubenden Flügels!), die versenkbaren Schiebe-
fenster, die fast substanzlosen, nirgends Schatten wer-
fenden Beleuchtungskörper, der Vorratsschrank mit
Entlüftung nach außen. Das Haus als „Maschine zum
Wohnen“. Wille zu äußerster Ehrlichkeit und peinlich-
ster Sauberkeit im formalen Sinne herrscht überall,
jedes Möbelstück, ja jedes Gerät zeigt das gleiche Ge-
sicht wie das Ganze des Hauses: nacktesten Funktio-
naiismus, Ingenieurästhetik. Pölzigs geschwungene
Kurven wirken schon fast barock, jedenfalls für viele
„wohltuend sentimental“ neben den viel zeitbewußte-
ren, fast verbissen doktrinär eingestellten Künstlern des
Dessauer Bauhauses.
„Baukunst oder Revolution?“ (um noch einmal Le
Corbusier zu zitieren). Geht man von dieser brennen-
den Alternative aus, denkt man an die innerhalb dcs
nächsten Jahrzehnts in Deutschland zu bauenden drci
Millionen Wohnungen, die erst die krasseste Wohnungs-
not beheben sollen, so wird man sentimentale Gefiihle
des Bedauerns ob mancher verschwundenen Pracht,
mancher unbarmherzig ausgeschalteten Gemütswerte
leichter in sich zurückdrängen. Vieles mag noch zu
sehr nach Ersatz schmecken, noch weit entfernt sein
69
zu beachten und für die Wirkung in Betracht zu ziehen.
Mit einer ganz neuen Wachheit wird ctwa die Spannung
verschiedener Materialien erlebt, die charakteristische
Rauhigkeit eincr unverzierten Fläche, die immanente
Energie einer Farbe, die Musikalität eiues freigeführten
Linienschwunges. Für leisere Werte ist der Sinn wie-
der offen geworden.
Durch 17 Architekten verschiedener Nationalität
sind die 33 Mehr- und Einfamilienhäuser, aus denen die
leider etwas zu sehr zusammengepferchte Siedlung be-
Schreibecke im Haus Professor Hans Poelzig in Berlin
steht, errichtet worden (Mies van der Rohe, Hilbers-
heirner, Behrens, Pölzig, Bruno und Max Taut aus Ber-
hn, Gropius-Dessau, Schneck und Döcker aus Stutt-
gart, Rading und Scharoun aus Breslau, Jos. Frank-
Wien, J. J. P. Oud und Mart Stam aus Rotterdam, Victor
Bourgeois-Brüssel, Corbusier-Jeanneret-Genf-Paris).
Individuelle Unterschiede sind bei diesetn neuen Welt-
stil leichter zu konstatieren als nationale. Immerhiu
mag dcr Ausländer in Bruno J'auts dunkel-lebendiger
Farbenglut der Wände, in dem gehäuseartigen Außen-
bau Scharouns deutschen „Mystizismus“ erkeunen.
Auch eine Wiener Note ist konstatierbar angesichts der
quastengeschmückten seidigen Behaglichkeit dcr
Innenräume Franks. Und der Franzose Le Corbusier-
Jeanneret, dem vielfach das Hauptinteresse der Besu-
cher gilt, hat wieder die überkonsequente Durchfiihrung
eines Systems voraus. Ueberaus wohltuend in ihrer
durchdachten maßvollen Art wirken die Holländer Oud
und Stam.
Von formalen Erwägungen abgesehen sind es alles
die typischen Wohnungen für den gehetzten Menschen
der neuen Zeit, dem auch in seinem Hause kein allzu-
geruhsames spielerisches Verweilen mehr gegönnt ist,
kein stundenlanges Versinken in den weichen Pfühl
eines Sessels, aus dem man vor Behaglichkeit nicht
mehr herausfindet. Diese Räume mit dem wohlabge-
messenen allernötigsten Mobiliar sind wohl geeignet,
bestimmte Zweckhandlungen darin vorzunehmen, eine
sachliche Unterredung zu fiihren, kurz zu speisen, kurz
zu schlafen, die nötigste Berufsarbeit knapp zu crledi-
gen, nicht aber zu endlosen Nachmittagsunterhaltungen,
ebensowenig allerdings in ihrer betonten Unäbgeschlos-
senheit zu abgründigem Versinken in ein geistiges
Problem. Sie sind für den Menschen der heutigen Zeit,
der wenig Muße kennt, sich aber auch im allgemeinen
nicht mit allzusehr nach innen gerichteter Arbeit auf-
zuhalten pflegt, der leicht beschwingt, immer reise- und
flugbereit jeden Ballast haßt, der sein Lebenstempo
hemmen könnte, der in der Muße nicht raffinierten
künstlerischen Genuß sondern Entspannung und noch-
mals Entspannung sucht (aucli daher nieder mit dem
Ornament, mit dem zerstreuenden Einzelbild usw.),
dem die Ueberschaubarkeit weit mehr bedeutct als dcr
Schmuck, da er stets wissen muß „wo und wie“, allcs
startbereit und greifbar haben will. Da ist die Attrappe
eines Wohnzimmers, aus dessen Seitenwänden man am
Abend einfach die Betten hervorzieht, in einem andern
Hause sind die Betten genau in der Art der Schlaf-
wagen übereinandergehängt. Da ist der verstell- und
abwaschbare Tisch, dcr trag- und zusammenklappbare
Sessel. der antennenlose Rundfunk (an Stclle des meist
zu platzraubenden Flügels!), die versenkbaren Schiebe-
fenster, die fast substanzlosen, nirgends Schatten wer-
fenden Beleuchtungskörper, der Vorratsschrank mit
Entlüftung nach außen. Das Haus als „Maschine zum
Wohnen“. Wille zu äußerster Ehrlichkeit und peinlich-
ster Sauberkeit im formalen Sinne herrscht überall,
jedes Möbelstück, ja jedes Gerät zeigt das gleiche Ge-
sicht wie das Ganze des Hauses: nacktesten Funktio-
naiismus, Ingenieurästhetik. Pölzigs geschwungene
Kurven wirken schon fast barock, jedenfalls für viele
„wohltuend sentimental“ neben den viel zeitbewußte-
ren, fast verbissen doktrinär eingestellten Künstlern des
Dessauer Bauhauses.
„Baukunst oder Revolution?“ (um noch einmal Le
Corbusier zu zitieren). Geht man von dieser brennen-
den Alternative aus, denkt man an die innerhalb dcs
nächsten Jahrzehnts in Deutschland zu bauenden drci
Millionen Wohnungen, die erst die krasseste Wohnungs-
not beheben sollen, so wird man sentimentale Gefiihle
des Bedauerns ob mancher verschwundenen Pracht,
mancher unbarmherzig ausgeschalteten Gemütswerte
leichter in sich zurückdrängen. Vieles mag noch zu
sehr nach Ersatz schmecken, noch weit entfernt sein
69