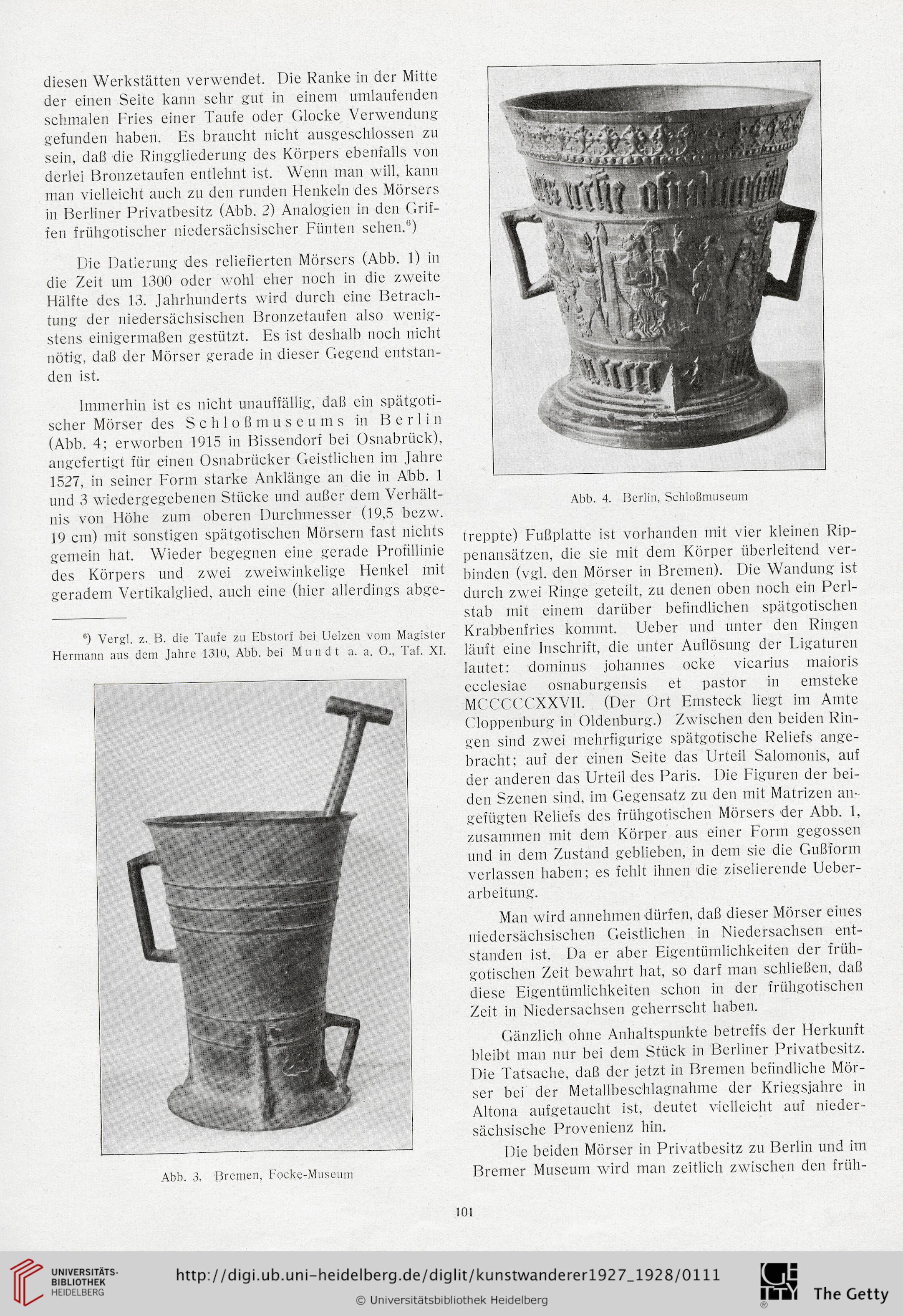diesen Werkstätten verwendet. Die Ranke in der Mitte
der einen Seite kann sehr gut in einem umlaufenden
schmalen Fries einer Taufe oder Glocke Verwendung
gefunden haben. Es braucht nicht ausgeschlossen zu
sein, daß die Ringgliederung des Körpers ebenfalls von
derlei Bronzetaufen entlehnt ist. Wenn man will, kann
man vielleicht auch zu den runden Henkeln des Mörsers
in Berliner Privatbesitz (Abb. 2) Analogien in den Grif-
fen frühgotischer niedersächsischer Fünten sehen.6)
Die Datierung des reliefierten Mörsers (Abb. 1) in
die Zeit um 1300 oder wohl eher noch in die zweite
Hälfte des 13. Jahrhunderts wird durch eine Betracli-
tung der niedersächsischen Bronzetaufen also wenig-
stens einigermaßen gestiitzt. Es ist deshalb noch nicht
nötig, daß der Mörser gerade in dieser Gegend entstan-
den ist.
Immerhin ist es nicht unauffällig, daß ein spätgoti-
scher Mörser des Schloßmuseums in B e r 1 i n
(Abb. 4; erworben 1915 in Bissendorf bei Osnabriick),
angefertigt fiir einen Osnabrücker Geistlichen im Jahre
1527, in seiner Form starke Anklänge an die in Abb. 1
und 3 wiedergegebenen Stücke und außer dem Verhält-
nis von Höhe zum oberen Durchmesser (19,5 bezw.
19 cm) mit sonstigen spätgotischen Mörsern fast nichts
gemein hat. Wieder begegnen eine gerade Profillinie
des Körpers und zwci zweiwinkelige Henkel mit
geradem Vertikalglied, auch eine (hier allerdings abge-
6) Vergl. z. B. die Taufe zu Ebstorf bei Uelzen vom Magister
Hermann aus dem Jahre 1310, Abb. bei Mundt a. a. O., Taf. XI.
Abb. 3, Bremen, Focke-Museum
Abb. 4. Berlin, Schloßmuseum
treppte) Fußplatte ist vorhanden mit vier kleinen Rip-
penansätzen, die sie mit dem Körper überleitend ver-
binden (vgl. den Mörser in Bremen). Die Wandung ist
durch zwei Ringe geteiit, zu denen oben noch ein Perl-
stab mit eincm darüber befindlichen spätgotischen
Krabbenfries kommt. Ueber und unter den Ringen
läuft eiue Inschrift, die unter Auflösung der Ligaturen
iautet: dominus johannes ocke vicarius maioris
ecclesiae osnaburgensis et pastor1 in emsteke
MCCCCCXXVII. (Der Ort Emsteck liegt im Amte
Cloppenburg in Oldenburg.) Zwischen den beiden Rin-
gen sind zwei mehrfigurige spätgotische Reliefs ange-
bracht; auf der elnen Seite das Urteil Salomonis, auf
der anderen das Urteil des Paris. Die Figuren der bei-
den Szenen sind, irn Gegensatz zu den mit Matrizen an-
gefügten Reliefs des frühgotischen Mörsers der Abb. 1,
zusammen mit dem Körper aus einer Form gegossen
und in dem Zustand geblieben, in dem sie die Gußform
verlassen iiaben; es felilt ihnen die ziselierende Ueber-
arbeitung.
Man wird annehmen dürfen, daß dieser Mörser eines
niedersächsischen Geistliclien in Niedersachsen ent-
standen ist. Da er aber Eigentümlichkeiten der früh-
gotischen Zeit bewahrt hat, so darf man schließen, daß
diese Eigentümlichkeiten schon in der frühgotischen
Zeit in Niedersachsen geherrscht haben.
Gänzlich ohne Anhaltspunkte betreffs der Herkunft
bleibt man nur bei dem Stück in Berliner Privatbesitz.
Die Tatsache, daß der jetzt in Bremen befindliche Mör-
ser bei der Metallbeschlagnahme der Kriegsjahre in
Altona aufgetaucht ist, deutet vielleicht auf nieder-
sächsische Provenienz hin.
Die bciden Mörser in Privatbesitz zu Berlin und im
Bremer Museum wird man zeitlich zwischen den früh-
101
der einen Seite kann sehr gut in einem umlaufenden
schmalen Fries einer Taufe oder Glocke Verwendung
gefunden haben. Es braucht nicht ausgeschlossen zu
sein, daß die Ringgliederung des Körpers ebenfalls von
derlei Bronzetaufen entlehnt ist. Wenn man will, kann
man vielleicht auch zu den runden Henkeln des Mörsers
in Berliner Privatbesitz (Abb. 2) Analogien in den Grif-
fen frühgotischer niedersächsischer Fünten sehen.6)
Die Datierung des reliefierten Mörsers (Abb. 1) in
die Zeit um 1300 oder wohl eher noch in die zweite
Hälfte des 13. Jahrhunderts wird durch eine Betracli-
tung der niedersächsischen Bronzetaufen also wenig-
stens einigermaßen gestiitzt. Es ist deshalb noch nicht
nötig, daß der Mörser gerade in dieser Gegend entstan-
den ist.
Immerhin ist es nicht unauffällig, daß ein spätgoti-
scher Mörser des Schloßmuseums in B e r 1 i n
(Abb. 4; erworben 1915 in Bissendorf bei Osnabriick),
angefertigt fiir einen Osnabrücker Geistlichen im Jahre
1527, in seiner Form starke Anklänge an die in Abb. 1
und 3 wiedergegebenen Stücke und außer dem Verhält-
nis von Höhe zum oberen Durchmesser (19,5 bezw.
19 cm) mit sonstigen spätgotischen Mörsern fast nichts
gemein hat. Wieder begegnen eine gerade Profillinie
des Körpers und zwci zweiwinkelige Henkel mit
geradem Vertikalglied, auch eine (hier allerdings abge-
6) Vergl. z. B. die Taufe zu Ebstorf bei Uelzen vom Magister
Hermann aus dem Jahre 1310, Abb. bei Mundt a. a. O., Taf. XI.
Abb. 3, Bremen, Focke-Museum
Abb. 4. Berlin, Schloßmuseum
treppte) Fußplatte ist vorhanden mit vier kleinen Rip-
penansätzen, die sie mit dem Körper überleitend ver-
binden (vgl. den Mörser in Bremen). Die Wandung ist
durch zwei Ringe geteiit, zu denen oben noch ein Perl-
stab mit eincm darüber befindlichen spätgotischen
Krabbenfries kommt. Ueber und unter den Ringen
läuft eiue Inschrift, die unter Auflösung der Ligaturen
iautet: dominus johannes ocke vicarius maioris
ecclesiae osnaburgensis et pastor1 in emsteke
MCCCCCXXVII. (Der Ort Emsteck liegt im Amte
Cloppenburg in Oldenburg.) Zwischen den beiden Rin-
gen sind zwei mehrfigurige spätgotische Reliefs ange-
bracht; auf der elnen Seite das Urteil Salomonis, auf
der anderen das Urteil des Paris. Die Figuren der bei-
den Szenen sind, irn Gegensatz zu den mit Matrizen an-
gefügten Reliefs des frühgotischen Mörsers der Abb. 1,
zusammen mit dem Körper aus einer Form gegossen
und in dem Zustand geblieben, in dem sie die Gußform
verlassen iiaben; es felilt ihnen die ziselierende Ueber-
arbeitung.
Man wird annehmen dürfen, daß dieser Mörser eines
niedersächsischen Geistliclien in Niedersachsen ent-
standen ist. Da er aber Eigentümlichkeiten der früh-
gotischen Zeit bewahrt hat, so darf man schließen, daß
diese Eigentümlichkeiten schon in der frühgotischen
Zeit in Niedersachsen geherrscht haben.
Gänzlich ohne Anhaltspunkte betreffs der Herkunft
bleibt man nur bei dem Stück in Berliner Privatbesitz.
Die Tatsache, daß der jetzt in Bremen befindliche Mör-
ser bei der Metallbeschlagnahme der Kriegsjahre in
Altona aufgetaucht ist, deutet vielleicht auf nieder-
sächsische Provenienz hin.
Die bciden Mörser in Privatbesitz zu Berlin und im
Bremer Museum wird man zeitlich zwischen den früh-
101