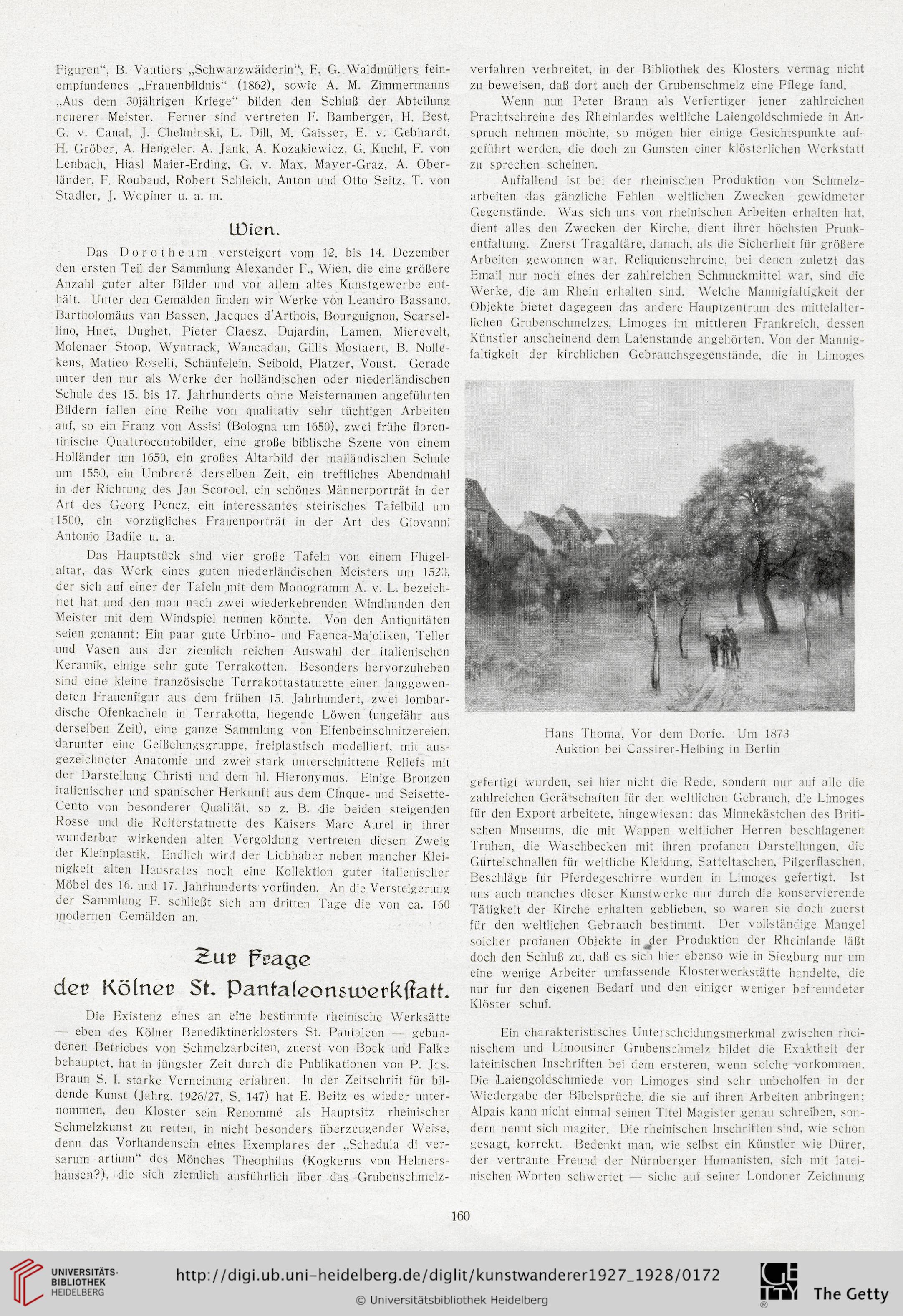Figuren“, B. Vautiers „Schwarzwälderin“, F, G. WaldmüllerS fein-
empfundenes „Frauenbildnis“ (1862), sowie A. M. Zimmermanns
„Aus dem 30jährigen Kriege“ bilden den Schluß der Abteilung
neuerer Meister. Ferner sind vertreten F. Bamberger, H. Best,
G. v. Canal, J. Chelminski, L. Dill, M. Gaisser, E. v. Gebhardt,
H. Gröber, A. Hengeier, A. Jank, A. Kozakiewicz, G. Kuehl, F. von
Lenbach, Hiasl Maier-Erding, G. v. Max, Mayer-Graz, A. Ober-
länder, F. Roubaud, Robert Schleich, Anton und Otto Seitz, T. von
Stadler, J. Wopfner u. a. m.
lOten.
Das Dorotheum . versteigert vom 12. bis 14. Dezember
den ersten Teil der Sammlung Alexander F„ Wien, die eine größere
Anzahl guter alter Bilder und vor allem altes Kunstgewerbe ent-
hält. Unter den Gemälden finden wir Werke von Leandro Bassano,
Bartholomäus van Bassen, Jacques d’Arthois, Bourguignon, Scarsel-
lino, Huet, Dughet, Pieter Claesz, Dujardin, Lamen, Mierevelt,
Molenaer Stoop, Wyntrack, Wancadan, Gillis Mostaert, B. Nolle-
kens, Matieo Röselli, Schäufelein, Seibold, Platzer, Voust. Gerade
unter den nur als Werke der holländischen oder niederländischen
Schule des 15. bis 17. Jahrhunderts ohne Meisternamen angeführten
Bildern fallen eine Reihe von qualitativ sehr tüchtigen Arbeiten
auf, so ein Franz von Assisi (Bologna um 1650), zwei frühe floren-
tinische Quattrocentobilder, eine große biblische Szene von einem
Holländer um 1650, ein großes Altarbild der mailändischen Schule
um 1550, ein Umbrere derselben Zeit, ein treffliches Abendmahl
in der Richtung des Jan Scoroel, ein schönes Männerporträt in der
Art des Georg Pencz, ein interessantes steirisches Tafelbild um
1500, ein vorzügliches Frauenporträt in der Art des Giovanni
Antonio Badile u. a.
Das Hauptstück sind vier große Tafeln von einem Flügel-
altar, das Werk eines guten niederländischen Meisters um 1520,
der sich auf einer der Tafeln ,mit dem Monogramm A. v. L. bezeich-
net hat und den man nach zwei wiederkehrenden Windhunden den
Meister mit dem Windspiel nennen könnte. Von den Antiquitäten
seien genannt: Ein paar gute Urbino- und Faenca-Majoliken, Teller
und Vasen aus der ziemlich reichen Auswahl der italienisclien
Keramik, einige sehr gute Terrakotten. Besonders hervorzuheben
sind eine kleine französische Terrakottastatuette einer langgewen-
deten Frauenfigur aus dem frühen 15. Jahrhundert, zwei lombar-
dische Ofenkacheln in Terrakotta, liegende Löwen (ungefähr aus
derselben Zeit), eine ganze Sammlung von Elfenbeinschnitzereien,
darunter eine Geißelungsgruppe, freiplastisch modelliert, mit aus-
gezeichneter Anatornie und zwei: stark unterschnittene Reiiefs mit
der Darstellung Christi und dem hl. Hieronymus. Einige Bronzen
italienischer und spanischer Herkunft aus dem Cinque- und Seisette-
Cento von besonderer Qualität, so z. B. die beiden steigenden
Rosse und die Reiterstatuette des Kaisers Marc Aurel in ihrcr
wunderbar wirkenden alten Vergoldung vertreten diesen Zweig
der Kleinplastik. Endlich wird der Liebhaber ncben mancher Klei-
nigkeit alten Hausrates noch eine Kollektion guter italienischer
Möbel des 16. und 17. Jahrhunderts vorfinden. An die Versteigerung
der Sammlung F. scliließt sich am dritten Tage die von ca. 160
modernen Gemälden an.
2-uü feage
dcü Kölnec SL Panfalconsinerkffath
Die Existenz eines an eine bestimmte rheinische Werksätte
- eben des Kölner Benediktinerklosters St. Pantaiepn — gebun-
denen Betriebes von Schmelzarbeiten, zuerst von Bock und Falke
behauptet, hat in jüngster Zeit durch die Publikationen von P. Jos.
Braun S. I. starke Verneinung erfahren. In der Zeitschrift für bil-
dende Kunst (Jahrg. 1926/27, S. 147) hat E. Beitz es wieder unter-
nommen, den Kloster sein Renomme als Hauptsitz rheinischer
Schmelzkunst zu retten, in nicht besonders überzeugender Weise,
denn das Vorhandensein eines Exemplares der „Schedula di ver-
sarum artium“ des Mönches Theophilus (Kogkerus von Helmers-
hausen?), die sich zicmlich ausführlich über das Grubenschmclz-
verfahren verbreitet, in der Bibliothek des Klosters vermag nicht
zu beweisen, daß dort auch der Grubenschmelz eine Pflege fand.
Wenn nun Peter Braun als Verfertiger jener zahlreichen
Prachtschreine des Rheinlandes weltliche Laiengoldschmiede in An-
spruch nehmen möchte, so mögen hier einige Gesichtspunkte auf-
geführt werden, die doch zu Gunsten einer klösterlichen Werkstatt
zu sprechen scheinen.
Auffallend ist bei der rheinischen Produktion von Schmelz-
arbeiten das gänzliche Fehlen weltlichen Zwecken gewidmeter
Gegenstände. Was sich uns von rheinischen Arbeiten erhalten hat,
dient alies den Zwecken der Kirche, dient ihrer höchsten Prunk-
entfaltung. Zuerst Tragaltäre, danach, als die Sicherheit für größere
Arbeiten gewonnen war, Reliquienschreine, bei denen zuletzt das
Email nur noch eines der zahlreichen Schmuckmittel war, sind die
Werke, die am Rhein erhalten sind. Welche Mannigfaltigkeit der
Objekte bietet dagegeen das andere Hauptzentrum des mittelalter-
lichen Grubenschmelzes, Limoges im mittleren Frankreich, dessen
Künstler anscheinend dem Laienstande angehörten. Von der Mannig-
faltigkeit der kirchlichen Gebrauchsgegenstände, die in Limoges
Hans 'i’homa, Vor dem Dorfe. Um 1873
Auktion bci Cassirer-Helbing iu Berliu
gefertigt wurden, sei liier nicht die Rede, sondern nur auf alle die
zahlreichen Gerätschaften für den weltlichen Gebrauch, die Limoges
für den Export arbeitete, hingewiesen: das Minnekästchen des Briti-
schen Museums, die mit Wappen weltlicher Herren beschlagenen
Truhen, die Waschbecken mit ihren profanen Darstellungen, die
Gürtelschnallen fiir weltliche Kleidung, Satteltaschen, Pilgerflaschen,
Beschläge für Pferdegeschirre wurden in Limoges gefertigt. Ist
uns auch manches dieser Kunstwerke imr durch die konservierer.de
Tätigkeit der Kirche erhalten geblieben, so waren sie doeh zuerst
für den weltlichen Gebrauch bestimmt. Der vollstänc ige Mangel
solcher profanen Objekte in^ier Produktion der Rheinlande läßt
doch den Schluß zu, daß es sich hier ebenso wie in Siegburg nur um
eine wenige Arbeiter umfassende Klosterwerkstätte handelte, die
nur für den eigenen Bedarf und den einiger weniger befreundeter
Klöster schuf.
Ein charakteristisches Unterscheidungsmerkmal zwischen rhei-
nischem und Limousiner Grubenschmelz bildet die Exaktheit der
lateinischen Inschriften bei dem ersteren, wenn solche vorkommen.
Die Laiengoldschmiede von Limoges sind sehr unbeholfen in der
Wiedergabe der Bibelsprüche, die sie auf ihren Arbeiten anbringen;
Alpais kann nicht einmal seinen Titel Magister genau schreiben, son-
dern nennt sich magiter. Die rheinischen Inschriften sind, wie schon
gesagt, korrekt. Bedenkt man, wie selbst ein Künstler wie Dürer,
der vertraute Freund der Niirnberger Humanisten, sich mit latei-
nischen Worten schwertet — siehe auf seiner Londoner Zeichnung
160
empfundenes „Frauenbildnis“ (1862), sowie A. M. Zimmermanns
„Aus dem 30jährigen Kriege“ bilden den Schluß der Abteilung
neuerer Meister. Ferner sind vertreten F. Bamberger, H. Best,
G. v. Canal, J. Chelminski, L. Dill, M. Gaisser, E. v. Gebhardt,
H. Gröber, A. Hengeier, A. Jank, A. Kozakiewicz, G. Kuehl, F. von
Lenbach, Hiasl Maier-Erding, G. v. Max, Mayer-Graz, A. Ober-
länder, F. Roubaud, Robert Schleich, Anton und Otto Seitz, T. von
Stadler, J. Wopfner u. a. m.
lOten.
Das Dorotheum . versteigert vom 12. bis 14. Dezember
den ersten Teil der Sammlung Alexander F„ Wien, die eine größere
Anzahl guter alter Bilder und vor allem altes Kunstgewerbe ent-
hält. Unter den Gemälden finden wir Werke von Leandro Bassano,
Bartholomäus van Bassen, Jacques d’Arthois, Bourguignon, Scarsel-
lino, Huet, Dughet, Pieter Claesz, Dujardin, Lamen, Mierevelt,
Molenaer Stoop, Wyntrack, Wancadan, Gillis Mostaert, B. Nolle-
kens, Matieo Röselli, Schäufelein, Seibold, Platzer, Voust. Gerade
unter den nur als Werke der holländischen oder niederländischen
Schule des 15. bis 17. Jahrhunderts ohne Meisternamen angeführten
Bildern fallen eine Reihe von qualitativ sehr tüchtigen Arbeiten
auf, so ein Franz von Assisi (Bologna um 1650), zwei frühe floren-
tinische Quattrocentobilder, eine große biblische Szene von einem
Holländer um 1650, ein großes Altarbild der mailändischen Schule
um 1550, ein Umbrere derselben Zeit, ein treffliches Abendmahl
in der Richtung des Jan Scoroel, ein schönes Männerporträt in der
Art des Georg Pencz, ein interessantes steirisches Tafelbild um
1500, ein vorzügliches Frauenporträt in der Art des Giovanni
Antonio Badile u. a.
Das Hauptstück sind vier große Tafeln von einem Flügel-
altar, das Werk eines guten niederländischen Meisters um 1520,
der sich auf einer der Tafeln ,mit dem Monogramm A. v. L. bezeich-
net hat und den man nach zwei wiederkehrenden Windhunden den
Meister mit dem Windspiel nennen könnte. Von den Antiquitäten
seien genannt: Ein paar gute Urbino- und Faenca-Majoliken, Teller
und Vasen aus der ziemlich reichen Auswahl der italienisclien
Keramik, einige sehr gute Terrakotten. Besonders hervorzuheben
sind eine kleine französische Terrakottastatuette einer langgewen-
deten Frauenfigur aus dem frühen 15. Jahrhundert, zwei lombar-
dische Ofenkacheln in Terrakotta, liegende Löwen (ungefähr aus
derselben Zeit), eine ganze Sammlung von Elfenbeinschnitzereien,
darunter eine Geißelungsgruppe, freiplastisch modelliert, mit aus-
gezeichneter Anatornie und zwei: stark unterschnittene Reiiefs mit
der Darstellung Christi und dem hl. Hieronymus. Einige Bronzen
italienischer und spanischer Herkunft aus dem Cinque- und Seisette-
Cento von besonderer Qualität, so z. B. die beiden steigenden
Rosse und die Reiterstatuette des Kaisers Marc Aurel in ihrcr
wunderbar wirkenden alten Vergoldung vertreten diesen Zweig
der Kleinplastik. Endlich wird der Liebhaber ncben mancher Klei-
nigkeit alten Hausrates noch eine Kollektion guter italienischer
Möbel des 16. und 17. Jahrhunderts vorfinden. An die Versteigerung
der Sammlung F. scliließt sich am dritten Tage die von ca. 160
modernen Gemälden an.
2-uü feage
dcü Kölnec SL Panfalconsinerkffath
Die Existenz eines an eine bestimmte rheinische Werksätte
- eben des Kölner Benediktinerklosters St. Pantaiepn — gebun-
denen Betriebes von Schmelzarbeiten, zuerst von Bock und Falke
behauptet, hat in jüngster Zeit durch die Publikationen von P. Jos.
Braun S. I. starke Verneinung erfahren. In der Zeitschrift für bil-
dende Kunst (Jahrg. 1926/27, S. 147) hat E. Beitz es wieder unter-
nommen, den Kloster sein Renomme als Hauptsitz rheinischer
Schmelzkunst zu retten, in nicht besonders überzeugender Weise,
denn das Vorhandensein eines Exemplares der „Schedula di ver-
sarum artium“ des Mönches Theophilus (Kogkerus von Helmers-
hausen?), die sich zicmlich ausführlich über das Grubenschmclz-
verfahren verbreitet, in der Bibliothek des Klosters vermag nicht
zu beweisen, daß dort auch der Grubenschmelz eine Pflege fand.
Wenn nun Peter Braun als Verfertiger jener zahlreichen
Prachtschreine des Rheinlandes weltliche Laiengoldschmiede in An-
spruch nehmen möchte, so mögen hier einige Gesichtspunkte auf-
geführt werden, die doch zu Gunsten einer klösterlichen Werkstatt
zu sprechen scheinen.
Auffallend ist bei der rheinischen Produktion von Schmelz-
arbeiten das gänzliche Fehlen weltlichen Zwecken gewidmeter
Gegenstände. Was sich uns von rheinischen Arbeiten erhalten hat,
dient alies den Zwecken der Kirche, dient ihrer höchsten Prunk-
entfaltung. Zuerst Tragaltäre, danach, als die Sicherheit für größere
Arbeiten gewonnen war, Reliquienschreine, bei denen zuletzt das
Email nur noch eines der zahlreichen Schmuckmittel war, sind die
Werke, die am Rhein erhalten sind. Welche Mannigfaltigkeit der
Objekte bietet dagegeen das andere Hauptzentrum des mittelalter-
lichen Grubenschmelzes, Limoges im mittleren Frankreich, dessen
Künstler anscheinend dem Laienstande angehörten. Von der Mannig-
faltigkeit der kirchlichen Gebrauchsgegenstände, die in Limoges
Hans 'i’homa, Vor dem Dorfe. Um 1873
Auktion bci Cassirer-Helbing iu Berliu
gefertigt wurden, sei liier nicht die Rede, sondern nur auf alle die
zahlreichen Gerätschaften für den weltlichen Gebrauch, die Limoges
für den Export arbeitete, hingewiesen: das Minnekästchen des Briti-
schen Museums, die mit Wappen weltlicher Herren beschlagenen
Truhen, die Waschbecken mit ihren profanen Darstellungen, die
Gürtelschnallen fiir weltliche Kleidung, Satteltaschen, Pilgerflaschen,
Beschläge für Pferdegeschirre wurden in Limoges gefertigt. Ist
uns auch manches dieser Kunstwerke imr durch die konservierer.de
Tätigkeit der Kirche erhalten geblieben, so waren sie doeh zuerst
für den weltlichen Gebrauch bestimmt. Der vollstänc ige Mangel
solcher profanen Objekte in^ier Produktion der Rheinlande läßt
doch den Schluß zu, daß es sich hier ebenso wie in Siegburg nur um
eine wenige Arbeiter umfassende Klosterwerkstätte handelte, die
nur für den eigenen Bedarf und den einiger weniger befreundeter
Klöster schuf.
Ein charakteristisches Unterscheidungsmerkmal zwischen rhei-
nischem und Limousiner Grubenschmelz bildet die Exaktheit der
lateinischen Inschriften bei dem ersteren, wenn solche vorkommen.
Die Laiengoldschmiede von Limoges sind sehr unbeholfen in der
Wiedergabe der Bibelsprüche, die sie auf ihren Arbeiten anbringen;
Alpais kann nicht einmal seinen Titel Magister genau schreiben, son-
dern nennt sich magiter. Die rheinischen Inschriften sind, wie schon
gesagt, korrekt. Bedenkt man, wie selbst ein Künstler wie Dürer,
der vertraute Freund der Niirnberger Humanisten, sich mit latei-
nischen Worten schwertet — siehe auf seiner Londoner Zeichnung
160