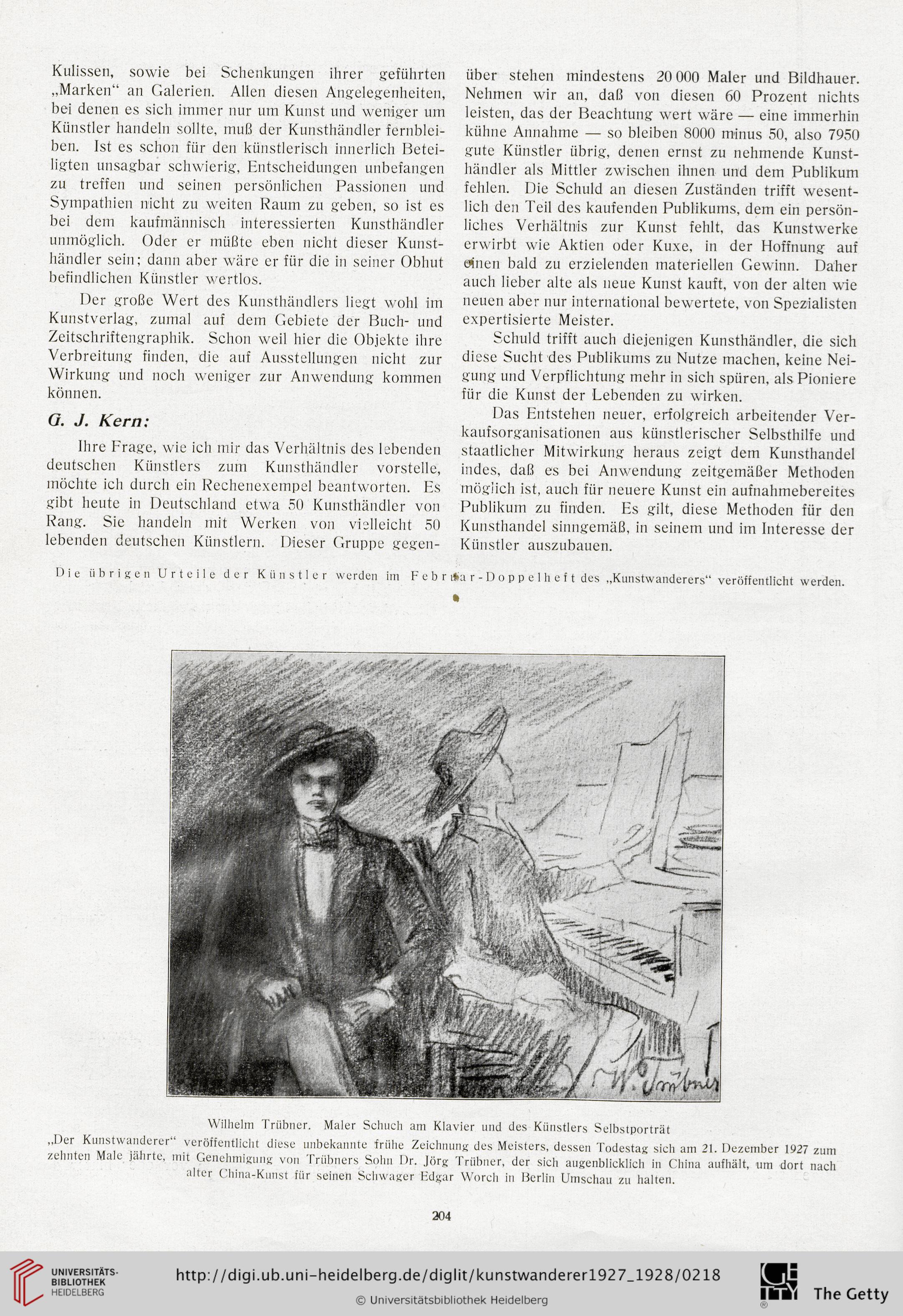Kulissen, sowie bei Schenkungen ihrer geführten
„Marken“ an Galerien. Allen diesen Angelegenheiten,
bei denen es sich immer nur um Kunst und weniger um
Kiinstler handeln sollte, muß der Kunsthändler fernblei-
ben. Ist es schon für den kiinstlerisch innerlich Betei-
ligten unsagbar schwierig, Entscheidungen unbefangen
zu trcffen und seinen persönl'ichen Passionen und
Sympathien nicht zu weiten Raum zu geben, so ist es
bei dem kaufmännisch interessierten Kunsthändler
unmöglich. Oder cr miißte eben niclit dieser Kunst-
händler sein; dann aber wäre er für die in seincr Obhut
befindlichen Künstler wertlos.
Der große Wert des Kunsthändlers liegt wohl im
Kunstverlag, zumal auf dem Gebiete der Buch- und
Zeitschriftengraphik. Sclion weil liier die Objekte ihre
Verbreitung finden, die auf Ausstellungen nicht zur
Wirkung und noch weniger zur Anwendung kommen
können.
G. J. Kern:
Ihre Frage, wie ich mir das Verhältnis des lebenden
deutschen Kiinstlers zum Kunsthändler vorstelle,
möchte ich durch ein Rechenexempel beantworten. Es
gibt heute in Deutschland etwa 50 Kunsthändler von
Rang. Sie handeln mit Werken von vielleicht 50
lebenden deutschen Kiinstlern. D'ieser Gruppe gegen-
Die übrigen Urteile der Künstler werden im Febr
tiber stehen mindestens 20 000 Maler und Bildhauer.
Nehmen wir an, daß von diesen 60 Prozent nichts
leisten, das der Beachtung wert wäre — eine immerhin
kiihne Annahme — so bleiben 8000 minus 50, also 7950
gute Künstler übrig, denen ernst zu nehmende Kunst-
händler als Mittler zwischen ihnen und dem Publikum
fehlen. Die Schuld an dieseti Zuständen trifft wesent-
lich den Teil des kaufenden Publikums, dem ein persön-
liches Verhältnis zur Kunst fehlt, das Kunstwerke
erwirbt wie Aktien oder Kuxe, in der Hoffnung auf
eJinen bald zu erzielenden materiellen Gewinn. Daher
auclt lieber alte als neue Kunst kauft, von der alten wie
neuen aber nur international bewertete, von Spezialisten
expertisierte Meister.
Schuld trifft auch diejenigen Kunsthändler, die sich
diese Sucht des Publikums zu Nutze machen, keine Nei-
gung und Verpflichtung mehr in sich spüren, als Pioniere
für die Kunst der Lebenden zu wirken.
Das Entstehen neuer, erfolgreich arbeitender Ver-
kaufsorgauisationen aus künstlerischer Selbsthilfe und
staatlicher Mitwirkung heraus zeigt dem Kunsthandel
indes, daß es bei Anwendung zeitgemäßer Methoden
möglich ist, auch für neuere Kunst ein aufnahmebereites
Publikum zu finden. Es gilt, diese Methoden für den
Kunsthandel sinngemäß, in seinem und im Interesse der
Künstler auszubaucn.
tor-Doppelheft des „Kunstwanderers“ veröffentlicht werden.
Wilhelm Trübner. Maler Schuch am Klavier und des Künstlers Selbstporträt
„Der Kunstwanderer“ veröffentlicht diese unbekannte frühe Zeichnung des Meisters, dessen Todestag sich am 21. Dezember 1927 zum
zehnten Male jährte, mit Genehmigung von Trtibners Solin I)r. Jörg Trübner, der sich augenblicklich in China aufhält, nm dort nach
alter China-Kunst für seinen Schwager Edgar Worch in Berlin Umschau zu halten.
204
„Marken“ an Galerien. Allen diesen Angelegenheiten,
bei denen es sich immer nur um Kunst und weniger um
Kiinstler handeln sollte, muß der Kunsthändler fernblei-
ben. Ist es schon für den kiinstlerisch innerlich Betei-
ligten unsagbar schwierig, Entscheidungen unbefangen
zu trcffen und seinen persönl'ichen Passionen und
Sympathien nicht zu weiten Raum zu geben, so ist es
bei dem kaufmännisch interessierten Kunsthändler
unmöglich. Oder cr miißte eben niclit dieser Kunst-
händler sein; dann aber wäre er für die in seincr Obhut
befindlichen Künstler wertlos.
Der große Wert des Kunsthändlers liegt wohl im
Kunstverlag, zumal auf dem Gebiete der Buch- und
Zeitschriftengraphik. Sclion weil liier die Objekte ihre
Verbreitung finden, die auf Ausstellungen nicht zur
Wirkung und noch weniger zur Anwendung kommen
können.
G. J. Kern:
Ihre Frage, wie ich mir das Verhältnis des lebenden
deutschen Kiinstlers zum Kunsthändler vorstelle,
möchte ich durch ein Rechenexempel beantworten. Es
gibt heute in Deutschland etwa 50 Kunsthändler von
Rang. Sie handeln mit Werken von vielleicht 50
lebenden deutschen Kiinstlern. D'ieser Gruppe gegen-
Die übrigen Urteile der Künstler werden im Febr
tiber stehen mindestens 20 000 Maler und Bildhauer.
Nehmen wir an, daß von diesen 60 Prozent nichts
leisten, das der Beachtung wert wäre — eine immerhin
kiihne Annahme — so bleiben 8000 minus 50, also 7950
gute Künstler übrig, denen ernst zu nehmende Kunst-
händler als Mittler zwischen ihnen und dem Publikum
fehlen. Die Schuld an dieseti Zuständen trifft wesent-
lich den Teil des kaufenden Publikums, dem ein persön-
liches Verhältnis zur Kunst fehlt, das Kunstwerke
erwirbt wie Aktien oder Kuxe, in der Hoffnung auf
eJinen bald zu erzielenden materiellen Gewinn. Daher
auclt lieber alte als neue Kunst kauft, von der alten wie
neuen aber nur international bewertete, von Spezialisten
expertisierte Meister.
Schuld trifft auch diejenigen Kunsthändler, die sich
diese Sucht des Publikums zu Nutze machen, keine Nei-
gung und Verpflichtung mehr in sich spüren, als Pioniere
für die Kunst der Lebenden zu wirken.
Das Entstehen neuer, erfolgreich arbeitender Ver-
kaufsorgauisationen aus künstlerischer Selbsthilfe und
staatlicher Mitwirkung heraus zeigt dem Kunsthandel
indes, daß es bei Anwendung zeitgemäßer Methoden
möglich ist, auch für neuere Kunst ein aufnahmebereites
Publikum zu finden. Es gilt, diese Methoden für den
Kunsthandel sinngemäß, in seinem und im Interesse der
Künstler auszubaucn.
tor-Doppelheft des „Kunstwanderers“ veröffentlicht werden.
Wilhelm Trübner. Maler Schuch am Klavier und des Künstlers Selbstporträt
„Der Kunstwanderer“ veröffentlicht diese unbekannte frühe Zeichnung des Meisters, dessen Todestag sich am 21. Dezember 1927 zum
zehnten Male jährte, mit Genehmigung von Trtibners Solin I)r. Jörg Trübner, der sich augenblicklich in China aufhält, nm dort nach
alter China-Kunst für seinen Schwager Edgar Worch in Berlin Umschau zu halten.
204