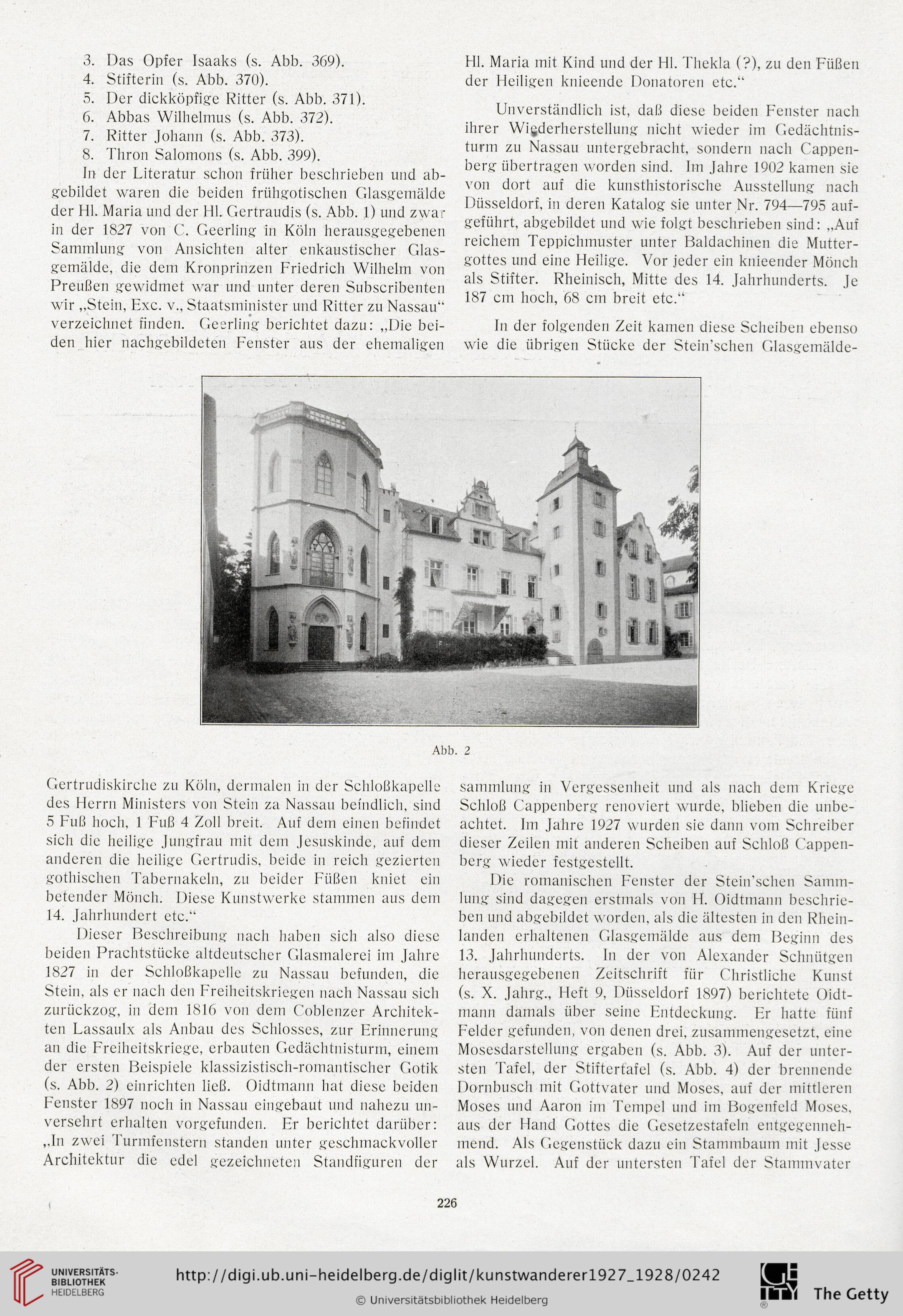3. Das Opfer Isaaks (s. Abb. 369).
4. Stifterin (s. Abb. 370).
5. Der dickköpfige Ritter (s. Abb. 371).
6. Abbas Wilhelmus (s. Abb. 372).
7. Ritter Johann (s. Abb. 373).
8. Thron Salomons (s. Abb. 399).
In der Literatur schon früher beschrieben und ab-
gebildet waren die beiden friihgotischen C.lasgemälde
der Hl. Mariaund der Hl. Gertraudis (s. Abb. 1) und zwar
in der 1827 von C. Geerling in Köln herausgegebenen
Sammlung von Ansichten alter enkaustischer Glas-
gemälde, die dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm von
Preußen gewidmet war und unter deren Subscribenten
wir „Stein, Exc. v., Staatsminister und Ritter zu Nassau“
verzeichnet finden. Geerling berichtet dazu: „Die bei-
den hier nachgebildeten Fenster aus der ehemaligen
Gertrudiskirche zu Köln, dermalen in der Schloßkapelle
des Herrn Ministers von Stein za Nassau beindlich, sind
5 Fuß hoch, 1 Fuß 4 Zoll breit. Auf dem einen befindet
sich die heilige Jungfrau mit dein Jesuskinde, auf dem
anderen die heilige Gertrudis, beide in rcich gezierten
gothischen Tabernakeln, zu beider Füßen kniet ein
betender Mönch. Diese Kunstwerke stammen aus dem
14. Jahrhundert etc.“
Iäiescr Beschreibung nach haben sich also diese
beiden Prachtstücke altdeutsclier Glasmalerei im Jahre
1827 in der Schloßkapelle zu Nassau befunden, die
Stein, als er nach den Freiheitskriegen nach Nassau sich
zurückzog, in dem 1816 von dem Coblenzer Architek-
ten Lassaulx als Anbau des Schlosses, zur Erinnerung
an dic Freiheitskriege, erbauten Gedächtnisturm, einem
der ersten Beispiele klassizistisch-romantischer Gotik
(s, Abb. 2) einrichtcn ließ. Oidtmann hat diese beiden
Fenster 1897 nocli in Nassau eingebaut und nahezu un-
versehrt erhalten vorgcfunden. Er bcriclitet darüber:
„In zwei Turmfenstern standen unter geschmackvoller
Architektur die edel gezeichneten Standfiguren der
Hl. Maria mit Kind und der Hl. Thekla (?), zu den Füßen
der Heiligen knieende Donatoren etc.“
Unverständlich ist, daß diese beiden Fenster nach
ilircr Wigderhcrstellung nicht wieder im Gedächtnis-
turm zu Nassau untergebracht, sondern nacli Cappen-
berg übertragen worden sind. Im Jahre 1902 kamen sie
von dort auf die kunsthistorisclie Ausstellung nach
Düsseldorf, in dcren Katalog sie unter Nr. 794—795 auf-
geführt, abgebildet und wie folgt beschrieben sind: „Auf
reichem Teppiclnnuster unter Baldachinen die Mutter-
gottes und eine Heilige. Vor jeder ein knieender Mönch
als Stifter. Rheinisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Je
187 cm hoch, 68 cm breit etc.“
In der folgenden Zeit kamen diese Scheiben ebenso
wie die übrigen Stücke der Stein’schen Glasgemälde-
sammlung in Vergessenheit und als nach dem Kriege
Schloß Cappenberg renoviert wurde, blieben die unbe-
achtet. Im Jahre 1927 wurden sie dann vom Schreiber
dieser Zeilen mit anderen Scheiben auf Schloß Cappen-
berg wiedcr festgestellt.
Die romanischen Fenster der Stein’schen Satnm-
lung sind dagegen erstmals von H. Oidtmann beschrie-
ben und abgebildet worden, als die ältesten in den Rhein-
landen erhaltenen Glasgemälde aus dem Beginn des
13. Jahrhunderts. In der von Alexander Schnütgen
herausgegebenen Zeitsclirift für Christliche Kunst
(s. X. Jahrg., Hcft 9, Düsseldorf 1897) berichtete Oidt-
mann damals über seine Entdeckung. Er hatte fünf
Felder gefunden, von denen drei, zusammengesetzt, eine
Mosesdarstellung ergaben (s. Abb. 3). Auf der unter-
sten Tafel, der Stiftertafel (s. Abb. 4) der brennende
Dornbusch mit Gottvatcr und Moses, auf der mittleren
Moses und Aaron im Tempel und im Bogenfeld Moses,
aus der Hand Gottes die Gesetzestafeln entgegenneh-
mend. Als Gegenstück dazu ein Stammbaum mit Jesse
als Wurzel. Auf der untersten Tafel der Stammvater
Abb. 2
I
226
4. Stifterin (s. Abb. 370).
5. Der dickköpfige Ritter (s. Abb. 371).
6. Abbas Wilhelmus (s. Abb. 372).
7. Ritter Johann (s. Abb. 373).
8. Thron Salomons (s. Abb. 399).
In der Literatur schon früher beschrieben und ab-
gebildet waren die beiden friihgotischen C.lasgemälde
der Hl. Mariaund der Hl. Gertraudis (s. Abb. 1) und zwar
in der 1827 von C. Geerling in Köln herausgegebenen
Sammlung von Ansichten alter enkaustischer Glas-
gemälde, die dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm von
Preußen gewidmet war und unter deren Subscribenten
wir „Stein, Exc. v., Staatsminister und Ritter zu Nassau“
verzeichnet finden. Geerling berichtet dazu: „Die bei-
den hier nachgebildeten Fenster aus der ehemaligen
Gertrudiskirche zu Köln, dermalen in der Schloßkapelle
des Herrn Ministers von Stein za Nassau beindlich, sind
5 Fuß hoch, 1 Fuß 4 Zoll breit. Auf dem einen befindet
sich die heilige Jungfrau mit dein Jesuskinde, auf dem
anderen die heilige Gertrudis, beide in rcich gezierten
gothischen Tabernakeln, zu beider Füßen kniet ein
betender Mönch. Diese Kunstwerke stammen aus dem
14. Jahrhundert etc.“
Iäiescr Beschreibung nach haben sich also diese
beiden Prachtstücke altdeutsclier Glasmalerei im Jahre
1827 in der Schloßkapelle zu Nassau befunden, die
Stein, als er nach den Freiheitskriegen nach Nassau sich
zurückzog, in dem 1816 von dem Coblenzer Architek-
ten Lassaulx als Anbau des Schlosses, zur Erinnerung
an dic Freiheitskriege, erbauten Gedächtnisturm, einem
der ersten Beispiele klassizistisch-romantischer Gotik
(s, Abb. 2) einrichtcn ließ. Oidtmann hat diese beiden
Fenster 1897 nocli in Nassau eingebaut und nahezu un-
versehrt erhalten vorgcfunden. Er bcriclitet darüber:
„In zwei Turmfenstern standen unter geschmackvoller
Architektur die edel gezeichneten Standfiguren der
Hl. Maria mit Kind und der Hl. Thekla (?), zu den Füßen
der Heiligen knieende Donatoren etc.“
Unverständlich ist, daß diese beiden Fenster nach
ilircr Wigderhcrstellung nicht wieder im Gedächtnis-
turm zu Nassau untergebracht, sondern nacli Cappen-
berg übertragen worden sind. Im Jahre 1902 kamen sie
von dort auf die kunsthistorisclie Ausstellung nach
Düsseldorf, in dcren Katalog sie unter Nr. 794—795 auf-
geführt, abgebildet und wie folgt beschrieben sind: „Auf
reichem Teppiclnnuster unter Baldachinen die Mutter-
gottes und eine Heilige. Vor jeder ein knieender Mönch
als Stifter. Rheinisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Je
187 cm hoch, 68 cm breit etc.“
In der folgenden Zeit kamen diese Scheiben ebenso
wie die übrigen Stücke der Stein’schen Glasgemälde-
sammlung in Vergessenheit und als nach dem Kriege
Schloß Cappenberg renoviert wurde, blieben die unbe-
achtet. Im Jahre 1927 wurden sie dann vom Schreiber
dieser Zeilen mit anderen Scheiben auf Schloß Cappen-
berg wiedcr festgestellt.
Die romanischen Fenster der Stein’schen Satnm-
lung sind dagegen erstmals von H. Oidtmann beschrie-
ben und abgebildet worden, als die ältesten in den Rhein-
landen erhaltenen Glasgemälde aus dem Beginn des
13. Jahrhunderts. In der von Alexander Schnütgen
herausgegebenen Zeitsclirift für Christliche Kunst
(s. X. Jahrg., Hcft 9, Düsseldorf 1897) berichtete Oidt-
mann damals über seine Entdeckung. Er hatte fünf
Felder gefunden, von denen drei, zusammengesetzt, eine
Mosesdarstellung ergaben (s. Abb. 3). Auf der unter-
sten Tafel, der Stiftertafel (s. Abb. 4) der brennende
Dornbusch mit Gottvatcr und Moses, auf der mittleren
Moses und Aaron im Tempel und im Bogenfeld Moses,
aus der Hand Gottes die Gesetzestafeln entgegenneh-
mend. Als Gegenstück dazu ein Stammbaum mit Jesse
als Wurzel. Auf der untersten Tafel der Stammvater
Abb. 2
I
226