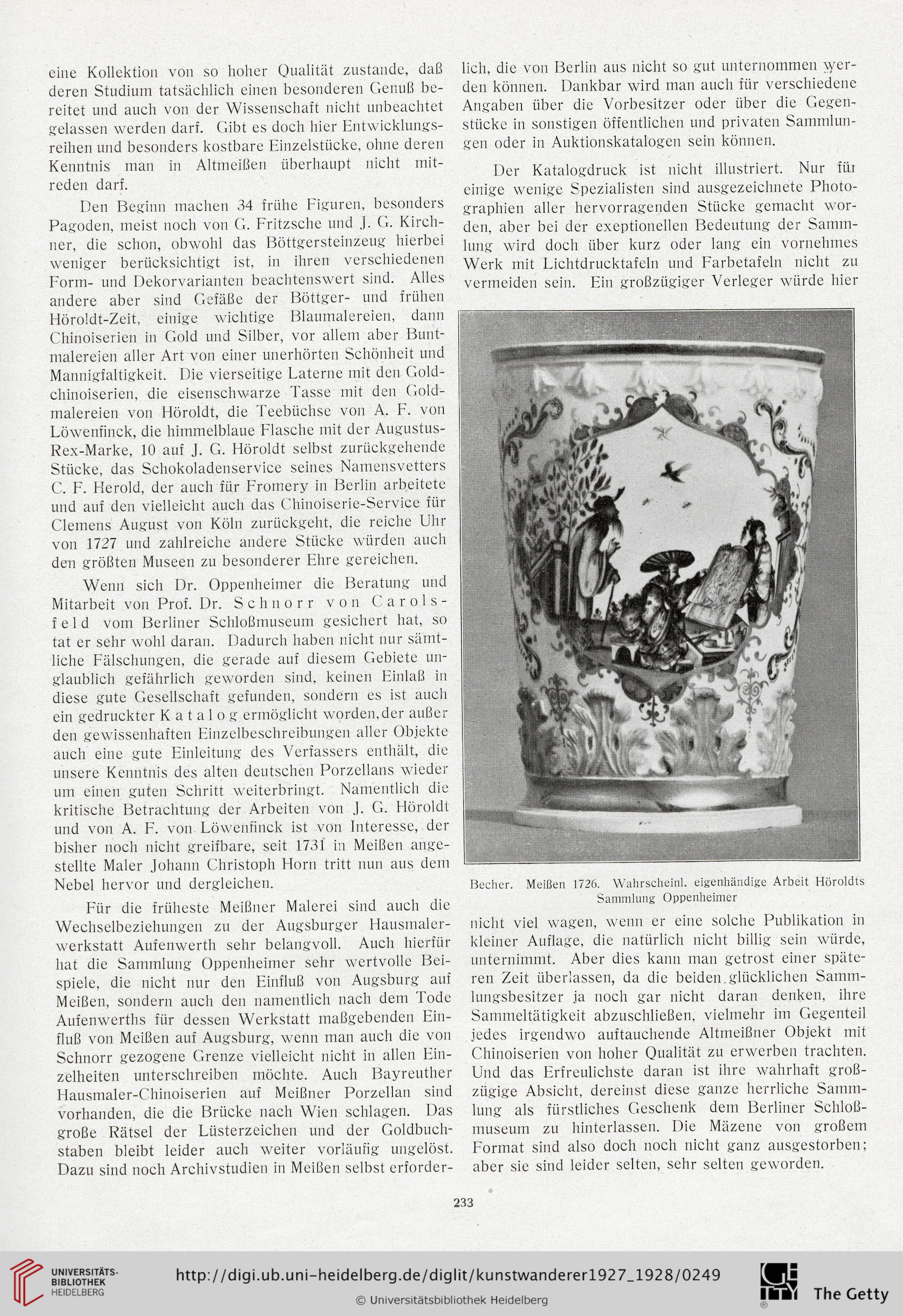eine Kollektion von so hoher Qualität zustande, daß
deren Studium tatsächlich einen besonderen Genuß be-
reitet und auch von der Wissenschaft nicht unbeachtet
gelassen werden darf. Gibt es doch liier Entwicklungs-
reihen und besonders kostbare Einzelstücke, ohne deren
Kenntnis man in Altmeißen überhaupt nicht mit-
reden darf.
Den Beginn machen 34 frühe Eiguren, besönders
Pagoden, meist noch von G. Fritzsche und J. G. Kirch-
ner, die schon, obwohl das Böttgersteinzeug hierbei
weniger berücksichtigt ist, in iliren verschiedenen
Form- und Dekorvarianten beachtenswert sind. Alles
andere aber sind Gefäße der Böttger- und frühen
Höroldt-Zeit, einige wichtige Blaumalereien, dann
Chinoiserien in Gold und Silber, vor allem aber Bunt-
malereien aller Art von einer unerhörten Schönheit und
Mannigfaltigkeit. Die vierseitige Laterne mit den Gold-
chinoiserien, die eisenschwarze Tasse mit den Gold-
malereien von Höroldt, die Teebüchse von A. F. von
Löwenfinck, die himmelblaue Flasche mit der Augustus-
Rex-Marke, 10 auf J. G. Höroldt selbst zurückgehende
Stücke, das Schokoladenservice seines Namensvetters
C. F. Herold, der auch für Fromery in Berlin arbeitcte
und auf den vielleicht auch das Chinoiserie-Service fiir
Clemens August von Köln zurückgeht, die reiche Uhr
von 1727 und zahlreiche andere Stücke würden auch
den größten Museen zu besonderer Ehre gereichen.
Wenn sich Dr. Oppenheimer die Beratung und
Mitarbeit von Prof. Dr. Schnorr von Carols-
f e 1 d vom Berliner Schloßmuseum gesichert hat, so
tat er sehr wöhl daran. Dadurch haben nicht nur sämt-
liche Fälschungen, die gerade auf diesem Gebiete un-
glaublich gefährlich geworden sind, keinen Einlaß in
diese gute Gesellschaft gefunden, sondern es ist auch
ein gedruckter K a t a 1 o g ermöglicht worden,der außer
den gewissenhaften Einzelbeschreibungen aller Objekte
auch eine gute Einleitung des Yerfassers enthält, die
unsere Kenntnis des alten deutschen Porzellans wieder
um einen gufen Schritt weiterbringt. Namentlich die
kritische Betrachtung der Arbeiten von J. G. Höroldt
und von A. F. von Löwenfinck ist von Interesse, der
bisher noch nicht greifbare, seit 1731 in Meißen ange-
stellte Maler Johann Christoph Horn tritt nun aus dem
Nebel hervor und dergleichen.
Für die früheste Meißner Malerei sind auch die
Wechselbeziehungen zu der Augsburger Hausmaler-
werkstatt Aufenwerth sehr belangvoll. Aucli hierfür
liat die Sammlung Oppenheimer sehr wertvolle Bei-
spiele, die nicht nur den Einfluß von Augsburg auf
Meißen, sondern auch den namentlich nach dem Tode
Aufenwerths für dessen Werkstatt maßgebenden Ein-
fluß von Meißen auf Augsburg, wenn man auch die von
Schnorr gezogene Grenze vielleicht nich't in allen Ein-
zelheiten unterschreibcn möchte. Aucli Bayreuther
Hausmaler-Chinoiserien auf Meißner Porzellan sind
vorhanden, die die Brücke nach Wien schlagen. Das
große Rätsel der Lüsterzeichen und der Goldbuch-
staben bleibt leider auch weiter vorläufig ungelöst.
Dazu sind noch Archivstudien in Meißen selbst erforder-
lich, die von Berlin aus nicht so gut unternommen wer-
den können. Dankbar wird man auch für verschiedene
Angaben über die Vorbesitzer oder über die Gegen-
stücke in sonstigen öffentlichen und privaten Sammlun-
gen oder in Auktionskatalogen sein können.
Der Katalogdruck ist nicht illustriert. Nur füi
einige wenige Spezialisten sind ausgezeichnete Photo-
graphien aller hervorragenden Stücke gemacht wor-
den, aber bei der exeptionellen Bedeutung der Samm-
lung wird docli iiber kurz oder lang ein vornehmes
Werk mit Lichtdrucktafeln und Farbetafeln nicht zu
vermeiden sein. Ein großzügiger Verleger würde hier
Becher. Meißen 1726. Wahrscheinl. eigenhändige Arbeit Höroldts
Sammlung Oppenheimer
niclit viel wagen, wenn er eine solche Publikation in
kleiner Auflage, die natürlich nicht billig sein würde,
unternimmt. Aber dies kann man getrost einer späte-
ren Zeit überiassen, da die beiden glücklichen Samm-
lungsbesitzer ja noch gar nicht daran denken, ilire
Sammeltätigkeit abzuschließen. vielmehr im Gegenteil
jedes irgendwo auftauchende Altmeißner Objekt mit
Chinoiserien von hoher Qualität zu erwerben trachten.
Und das Erfreulichste daran ist ilire wahrhaft groß-
zügige Absieht, dereinst diese ganze herrliche Samm-
lung als fürstliches Geschenk dem Berliner Schloß-
museum zu hinterlassen. Die Mäzene von großem
Format sind also docli noch nicht ganz ausgestorben;
aber sie sind leider selten, sehr selten geworden.
233
deren Studium tatsächlich einen besonderen Genuß be-
reitet und auch von der Wissenschaft nicht unbeachtet
gelassen werden darf. Gibt es doch liier Entwicklungs-
reihen und besonders kostbare Einzelstücke, ohne deren
Kenntnis man in Altmeißen überhaupt nicht mit-
reden darf.
Den Beginn machen 34 frühe Eiguren, besönders
Pagoden, meist noch von G. Fritzsche und J. G. Kirch-
ner, die schon, obwohl das Böttgersteinzeug hierbei
weniger berücksichtigt ist, in iliren verschiedenen
Form- und Dekorvarianten beachtenswert sind. Alles
andere aber sind Gefäße der Böttger- und frühen
Höroldt-Zeit, einige wichtige Blaumalereien, dann
Chinoiserien in Gold und Silber, vor allem aber Bunt-
malereien aller Art von einer unerhörten Schönheit und
Mannigfaltigkeit. Die vierseitige Laterne mit den Gold-
chinoiserien, die eisenschwarze Tasse mit den Gold-
malereien von Höroldt, die Teebüchse von A. F. von
Löwenfinck, die himmelblaue Flasche mit der Augustus-
Rex-Marke, 10 auf J. G. Höroldt selbst zurückgehende
Stücke, das Schokoladenservice seines Namensvetters
C. F. Herold, der auch für Fromery in Berlin arbeitcte
und auf den vielleicht auch das Chinoiserie-Service fiir
Clemens August von Köln zurückgeht, die reiche Uhr
von 1727 und zahlreiche andere Stücke würden auch
den größten Museen zu besonderer Ehre gereichen.
Wenn sich Dr. Oppenheimer die Beratung und
Mitarbeit von Prof. Dr. Schnorr von Carols-
f e 1 d vom Berliner Schloßmuseum gesichert hat, so
tat er sehr wöhl daran. Dadurch haben nicht nur sämt-
liche Fälschungen, die gerade auf diesem Gebiete un-
glaublich gefährlich geworden sind, keinen Einlaß in
diese gute Gesellschaft gefunden, sondern es ist auch
ein gedruckter K a t a 1 o g ermöglicht worden,der außer
den gewissenhaften Einzelbeschreibungen aller Objekte
auch eine gute Einleitung des Yerfassers enthält, die
unsere Kenntnis des alten deutschen Porzellans wieder
um einen gufen Schritt weiterbringt. Namentlich die
kritische Betrachtung der Arbeiten von J. G. Höroldt
und von A. F. von Löwenfinck ist von Interesse, der
bisher noch nicht greifbare, seit 1731 in Meißen ange-
stellte Maler Johann Christoph Horn tritt nun aus dem
Nebel hervor und dergleichen.
Für die früheste Meißner Malerei sind auch die
Wechselbeziehungen zu der Augsburger Hausmaler-
werkstatt Aufenwerth sehr belangvoll. Aucli hierfür
liat die Sammlung Oppenheimer sehr wertvolle Bei-
spiele, die nicht nur den Einfluß von Augsburg auf
Meißen, sondern auch den namentlich nach dem Tode
Aufenwerths für dessen Werkstatt maßgebenden Ein-
fluß von Meißen auf Augsburg, wenn man auch die von
Schnorr gezogene Grenze vielleicht nich't in allen Ein-
zelheiten unterschreibcn möchte. Aucli Bayreuther
Hausmaler-Chinoiserien auf Meißner Porzellan sind
vorhanden, die die Brücke nach Wien schlagen. Das
große Rätsel der Lüsterzeichen und der Goldbuch-
staben bleibt leider auch weiter vorläufig ungelöst.
Dazu sind noch Archivstudien in Meißen selbst erforder-
lich, die von Berlin aus nicht so gut unternommen wer-
den können. Dankbar wird man auch für verschiedene
Angaben über die Vorbesitzer oder über die Gegen-
stücke in sonstigen öffentlichen und privaten Sammlun-
gen oder in Auktionskatalogen sein können.
Der Katalogdruck ist nicht illustriert. Nur füi
einige wenige Spezialisten sind ausgezeichnete Photo-
graphien aller hervorragenden Stücke gemacht wor-
den, aber bei der exeptionellen Bedeutung der Samm-
lung wird docli iiber kurz oder lang ein vornehmes
Werk mit Lichtdrucktafeln und Farbetafeln nicht zu
vermeiden sein. Ein großzügiger Verleger würde hier
Becher. Meißen 1726. Wahrscheinl. eigenhändige Arbeit Höroldts
Sammlung Oppenheimer
niclit viel wagen, wenn er eine solche Publikation in
kleiner Auflage, die natürlich nicht billig sein würde,
unternimmt. Aber dies kann man getrost einer späte-
ren Zeit überiassen, da die beiden glücklichen Samm-
lungsbesitzer ja noch gar nicht daran denken, ilire
Sammeltätigkeit abzuschließen. vielmehr im Gegenteil
jedes irgendwo auftauchende Altmeißner Objekt mit
Chinoiserien von hoher Qualität zu erwerben trachten.
Und das Erfreulichste daran ist ilire wahrhaft groß-
zügige Absieht, dereinst diese ganze herrliche Samm-
lung als fürstliches Geschenk dem Berliner Schloß-
museum zu hinterlassen. Die Mäzene von großem
Format sind also docli noch nicht ganz ausgestorben;
aber sie sind leider selten, sehr selten geworden.
233