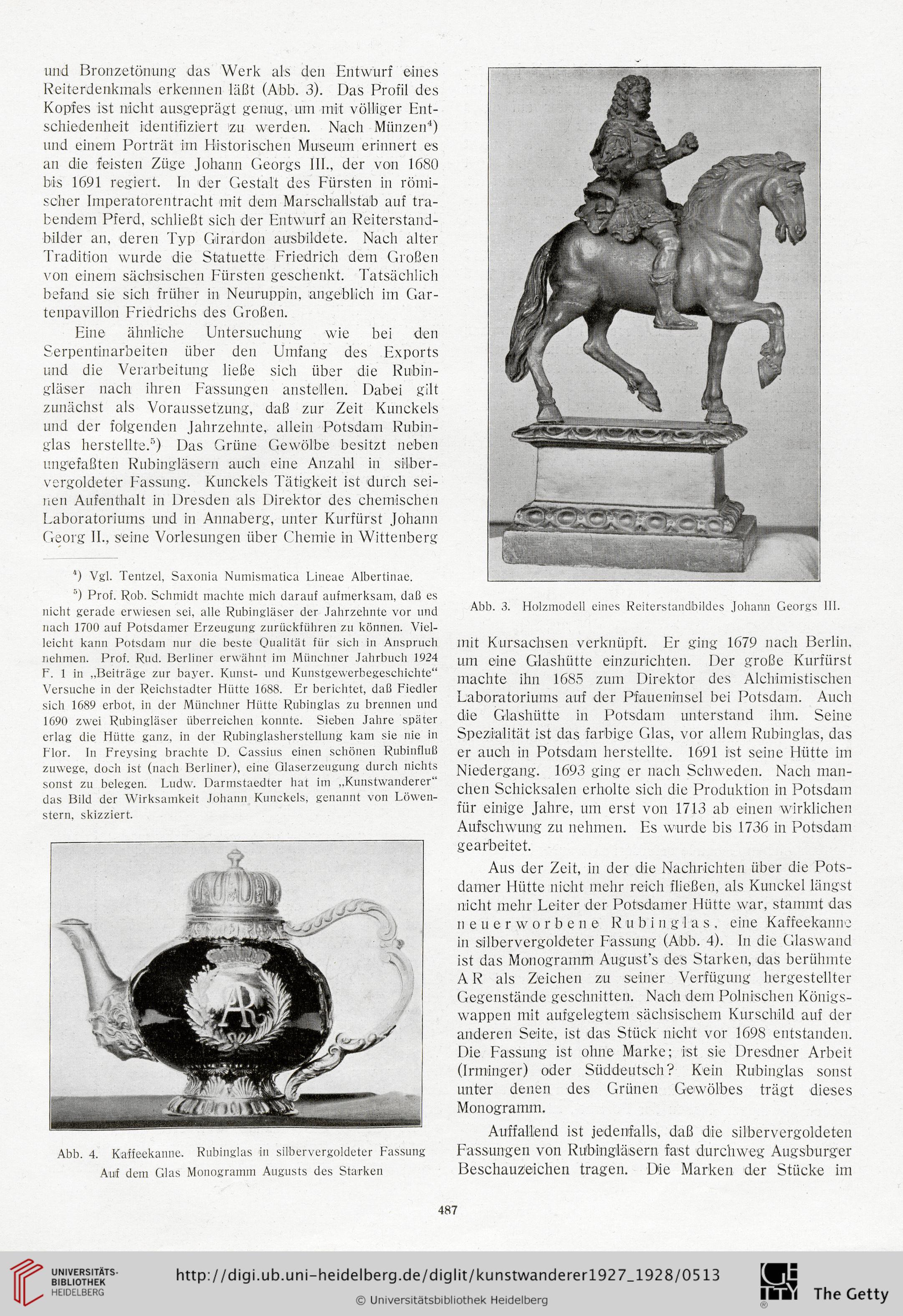und Bronzetönung das Werk als den Entwurf eines
Reiterdenkmals erkennen läßt (Abb. 3). Das Profil des
Kopfes ist nicht ausgeprägt genug, um mit völliger Ent-
schiedenheit identifiziert zu werden. Nach Münzen4)
und einem Porträt im Historischen Museum erinnert es
an die feisten Züge Johann Georgs III., der von 1680
bi'S 1691 regiert. In der Gestalt des Fürsten in römi-
scher Imperatorentracht mit dem Marschallstab auf tra-
bendem Pferd, schließt sich der Entwurf an Reiterstand-
bilder an, deren Typ G'irardon au'sbildete. Nach alter
Tradition wurde die Statuette Friedrich dem Großen
von einem sächsischen Fürsten geschenkt. Tatsächlich
befand sie sich früher in Neuruppin, angeblich im Gar-
tenpavillon Friedrichs des Großen.
Eine ähnliche Untersuchung wie bei den
Serpentinarbeiten über den Umfang des Exports
und die Verarbeitung ließe sich iiber die Rubin-
gläser nach ihren Fassungen ansteilen. Dabei gilt
zunächst als Voraussetzung, daß zur Zeit Kunckels
und der folgenden Jahrzehnte, allein Potsdam Rubin-
glas herstellte.6) Das Grüne Gewölbe besitzt neben
ungefaßten Rubingläsern auch eine Anzahl iu silber-
vergoldeter Fassung. Kunckels Tätigkeit ist durch sei-
nen Aufenthalt in Dresden als Direktor des chemischen
Laboratoriurns und in Annaberg, unter Kurfürst Johann
Georg II., seine Vorlesungen über Chemte in Wittenberg
ä) Vgl. Tentzel, Saxonia Numismatica Lineae Albertinae.
ö) Prof. Rob. Schmidt machte mich darauf aufmerksam, daß es
nicht gerade erwiesen sei, alle Rubingläser der Jahrzehnte vor und
nach 1700 auf Potsdamer Erzeugung zurückführen zu können. Viel-
leicht kann Potsdam nur die beste Qualität für sicli in Anspruch
nehmen. Prof. Rud. Berliner erwähnt im Münchner Jahrbuch 1924
F. 1 in „Beiträge zur bayer. Kunst- und Kunstgewerbegeschichte“
Versuche in der Reichstadter Hütte 1688. Er berichtet, daß Fiedler
sich 1689 erbot, in der Münchner Hütte Rubinglas zu brennen und
1690 zwei Rubingläser überreichen konnte. Sieben Jahre später
erlag die Hütte ganz, in der Rubinglasherstellung kam sie nie in
Flor. In Freysing brachte D. Cassius einen schönen Rubinfluß
zuwege, doch ist (nach Berliner), eine Qlaserzeugung durch nichts
sonst zu belegen. Ludw. Darmstaedter hat im „Kunstwanderer“
das Bild der Wirksamkeit Johann Kunckels, genannt von Löwen-
stern, skizziert.
Abb. 4. Käffeekanne, Rubinglas in silbervergoldeter Fassung
Auif dem Glas Monogramm Augusts des Starken
Abb. 3. Holzmodell eines Reiterstandbildes Johann Georgs III.
mit Kursachscii verknüpft. Er ging 1679 nach Berlin,
um eine Glashütte einzurichten. Der große Kurfürst
machte ihn 1685 zum Direktor des Alchimistischen
Laboratoriums auf der Pfiaueninsel bei Potsdam. Auch
die Glashütte in Potsdarn unterstand ihm. Seine
Spezialität ist das farbige Glas, vor allem Rubinglas, das
er auch in Potsdam herstellte. 1691 ist seine Hütte im
Niedergang. 1693 ging er nach Schweden. Nach man-
chen Schicksalen erholte sich die Produktion in Potsdam
für einige Jahre, um erst von 1713 ab einen wirklichen
Aufschwung zu nehmen. Es wurde bis 1736 in Potsdam
gearbeitet.
Aus der Zeit, in der die Nachrichten über die Pots-
damer Htitte nicht rnehr reich fließen, als Kunckel längst
nicht mehr Leiter der Potsdamer Hütte war, stammt das
neuerworbene R u b i n g Ta s , eine Kaffeekanne
in silbervergoldeter Fassung (Abb. 4). In die Glaswand
ist das Monogramm August’s des Starken, das berühmte
A R als Zeichen zu seirrer Verfügung liergestellter
Gegenstände geschnitten. Nach dem Polnischen Königs-
wappen mit aufgelegtem sächsischem Kurschild auf der
anderen Seite, ist das Stück nicht vor 1698 entstanderi.
Die Fassung ist ohne Marke; ist sie Dresdner Arbeit
(Irminger) oder Süddeutsch? Kein Ru'binglas sonst
unter denen des Grünen Gewölbes trägt dieses
Monogramm.
Auffallend ist jederrfalls, daß die silbervergoldeten
Fassungen von Rubingläsern fast durchweg Augsburger
Bcschauzeichen tragen. Dlie Marken der Stücke im
487
Reiterdenkmals erkennen läßt (Abb. 3). Das Profil des
Kopfes ist nicht ausgeprägt genug, um mit völliger Ent-
schiedenheit identifiziert zu werden. Nach Münzen4)
und einem Porträt im Historischen Museum erinnert es
an die feisten Züge Johann Georgs III., der von 1680
bi'S 1691 regiert. In der Gestalt des Fürsten in römi-
scher Imperatorentracht mit dem Marschallstab auf tra-
bendem Pferd, schließt sich der Entwurf an Reiterstand-
bilder an, deren Typ G'irardon au'sbildete. Nach alter
Tradition wurde die Statuette Friedrich dem Großen
von einem sächsischen Fürsten geschenkt. Tatsächlich
befand sie sich früher in Neuruppin, angeblich im Gar-
tenpavillon Friedrichs des Großen.
Eine ähnliche Untersuchung wie bei den
Serpentinarbeiten über den Umfang des Exports
und die Verarbeitung ließe sich iiber die Rubin-
gläser nach ihren Fassungen ansteilen. Dabei gilt
zunächst als Voraussetzung, daß zur Zeit Kunckels
und der folgenden Jahrzehnte, allein Potsdam Rubin-
glas herstellte.6) Das Grüne Gewölbe besitzt neben
ungefaßten Rubingläsern auch eine Anzahl iu silber-
vergoldeter Fassung. Kunckels Tätigkeit ist durch sei-
nen Aufenthalt in Dresden als Direktor des chemischen
Laboratoriurns und in Annaberg, unter Kurfürst Johann
Georg II., seine Vorlesungen über Chemte in Wittenberg
ä) Vgl. Tentzel, Saxonia Numismatica Lineae Albertinae.
ö) Prof. Rob. Schmidt machte mich darauf aufmerksam, daß es
nicht gerade erwiesen sei, alle Rubingläser der Jahrzehnte vor und
nach 1700 auf Potsdamer Erzeugung zurückführen zu können. Viel-
leicht kann Potsdam nur die beste Qualität für sicli in Anspruch
nehmen. Prof. Rud. Berliner erwähnt im Münchner Jahrbuch 1924
F. 1 in „Beiträge zur bayer. Kunst- und Kunstgewerbegeschichte“
Versuche in der Reichstadter Hütte 1688. Er berichtet, daß Fiedler
sich 1689 erbot, in der Münchner Hütte Rubinglas zu brennen und
1690 zwei Rubingläser überreichen konnte. Sieben Jahre später
erlag die Hütte ganz, in der Rubinglasherstellung kam sie nie in
Flor. In Freysing brachte D. Cassius einen schönen Rubinfluß
zuwege, doch ist (nach Berliner), eine Qlaserzeugung durch nichts
sonst zu belegen. Ludw. Darmstaedter hat im „Kunstwanderer“
das Bild der Wirksamkeit Johann Kunckels, genannt von Löwen-
stern, skizziert.
Abb. 4. Käffeekanne, Rubinglas in silbervergoldeter Fassung
Auif dem Glas Monogramm Augusts des Starken
Abb. 3. Holzmodell eines Reiterstandbildes Johann Georgs III.
mit Kursachscii verknüpft. Er ging 1679 nach Berlin,
um eine Glashütte einzurichten. Der große Kurfürst
machte ihn 1685 zum Direktor des Alchimistischen
Laboratoriums auf der Pfiaueninsel bei Potsdam. Auch
die Glashütte in Potsdarn unterstand ihm. Seine
Spezialität ist das farbige Glas, vor allem Rubinglas, das
er auch in Potsdam herstellte. 1691 ist seine Hütte im
Niedergang. 1693 ging er nach Schweden. Nach man-
chen Schicksalen erholte sich die Produktion in Potsdam
für einige Jahre, um erst von 1713 ab einen wirklichen
Aufschwung zu nehmen. Es wurde bis 1736 in Potsdam
gearbeitet.
Aus der Zeit, in der die Nachrichten über die Pots-
damer Htitte nicht rnehr reich fließen, als Kunckel längst
nicht mehr Leiter der Potsdamer Hütte war, stammt das
neuerworbene R u b i n g Ta s , eine Kaffeekanne
in silbervergoldeter Fassung (Abb. 4). In die Glaswand
ist das Monogramm August’s des Starken, das berühmte
A R als Zeichen zu seirrer Verfügung liergestellter
Gegenstände geschnitten. Nach dem Polnischen Königs-
wappen mit aufgelegtem sächsischem Kurschild auf der
anderen Seite, ist das Stück nicht vor 1698 entstanderi.
Die Fassung ist ohne Marke; ist sie Dresdner Arbeit
(Irminger) oder Süddeutsch? Kein Ru'binglas sonst
unter denen des Grünen Gewölbes trägt dieses
Monogramm.
Auffallend ist jederrfalls, daß die silbervergoldeten
Fassungen von Rubingläsern fast durchweg Augsburger
Bcschauzeichen tragen. Dlie Marken der Stücke im
487