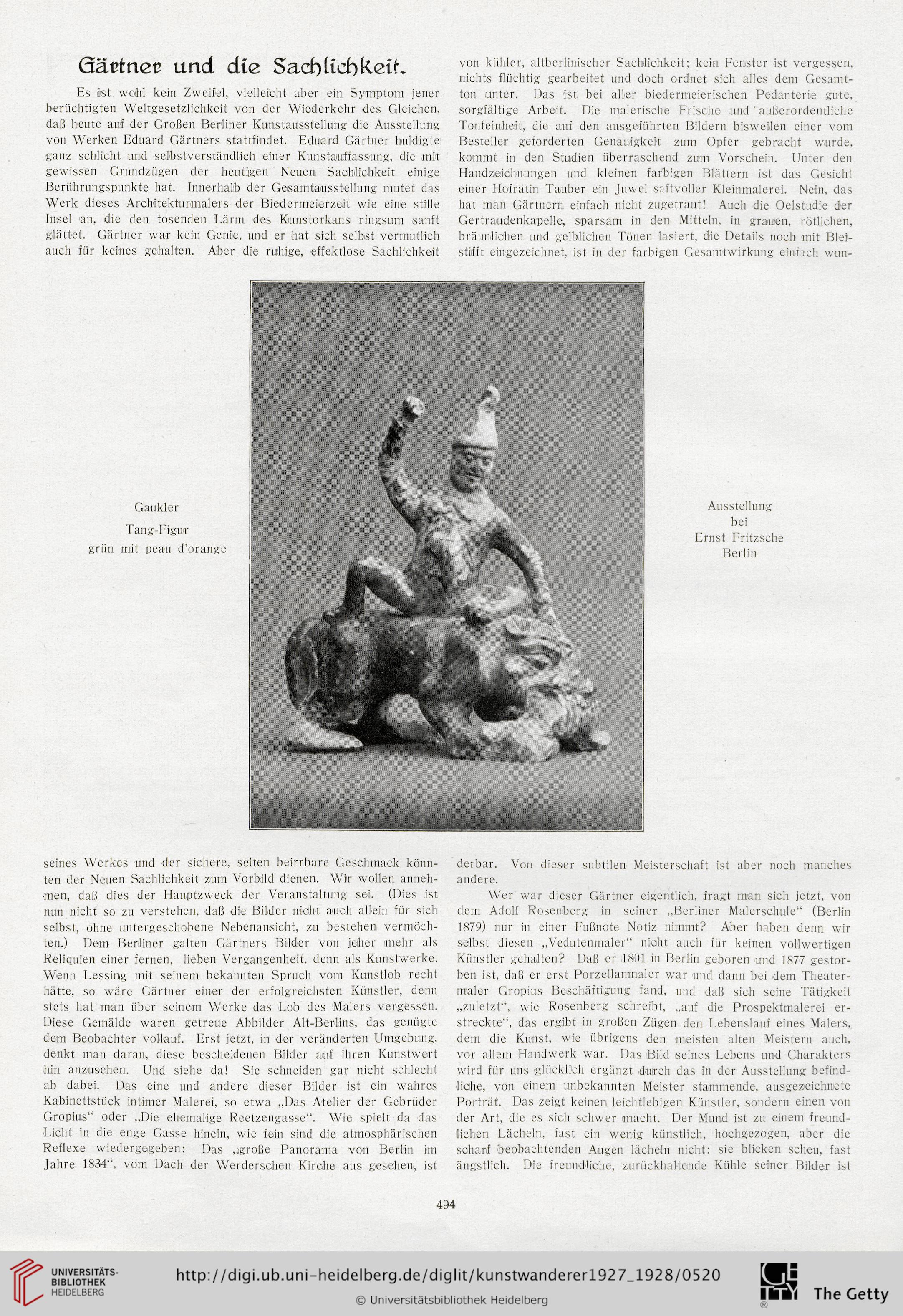Qäctnec und dte SacbUcbkeit
Es fet wohl kein Zweifel, vielleicht aber ein Symiptom jener
berüchtigten Weltgesetzlichkeit von der Wiederkehr des Gleiohen,
daß beute auf der Großen Berliner Kunstausstellung die Ausstellung
von Werken Eduard Gärtners stattfindet. Eduard Gärtner huidigte
ganz schlicht und selbstverständlich einer Kunstauffassung, die mit
gewissen Grundzügen der heutfeen Neuen Sachilichkeit einige
Beriihrungspunkte hat. Innerhalib der Gesamtausstellung mutet das
Werk dieses Arcbitekturmalers der Biedermeierzeit wie eine stille
Insel an, die -den toseriden Lärm des Kunstorkans' ringsum sanft
glättet. Gärtner war kein Genie, und er hat sich selbst vermutlich
auch fiir keines gehalten. Aber die ruhige, effektlose Sachlichkeit
von kühler, altberlinischer Sachlichkeit; kein Fenster ist vergessen,
nichts flüchtig gearbeitet und doch ordnet sich alles dem Gesamt-
ton unter. Das ist. bei aller biedermeierischen Pedanterie gute,
sorgfältige Arbeit. Die malerische Frische und ' außerordentliche
Tonfeinheit, die auf den ausgeführten Bildern bisweilen einer vom
Besteller geforderten Genauiigkeit zum Opfer gebracht wurde,
kommt in den Studien überraschend zum Vorschein. Unter den
Handzeichnungen und kleinen farbigen Blättern ist das Gesieht
einer Hofrätin Tauber ein Juwel saftvoller Kleinmalerei. Nein, das
hat man Gärtnern einfach n.icht zugetraut! Auch die Oelstudie der
Gertraudenkapelle, sparsam in den Mitteln, in grauen, rötlichen,
bräumliohen und gelblichen Tönen lasiert, die Details noch mit Blei-
stifft eingezeichnet, ist in der farbigen Gesamtwirkung einfach wun-
Gaukler
Tang-Figuir
griin mit peau d'orange
Ausstellung
bei
Ernst Fritzsche
Berlin
seines Werkes und der sichere, selten beirrbare Geschmack könn-
ten der Neuen Sachlichkeit zum Vorbild dienen. Wi'r wollen anneh-
•men, daß dies der Hauptzweck der Veranstaltung sei. (Dies ist
nun nicht so zu verstehen, daß die Bilder nicht auoh allein für sich
selbst, ohne untergeschobene Nebenansicht, zu bestehen vermöch-
ten.) Dem BerJiner galten Gärtners Biilder von jeiher mehr als
Reliquien einer fernen, lieben Vergangenheit, denn als Kunstwerke.
Wenn Lessing mit seinem bekannten Spruch vom Kunstlob recht
hätte, so wäre Gärtner einer der erfolgreichsten Künstler, denn
stets hat man über seinem Werke das Lob des Malers vergessen.
Diese Gemälde waren getreue Abbilder Alt-Berlins, das genügte
dem Beoibachter voliauf. Erst jetzt, in der veränderten Umgebung,
denkt man daran, diese bescheidenen Bilder auf ihren Kunstwert
thin anzuseihen. Und siehe da! Sie schneiden gar nicht schlecht
ab dabei. Das eine und andere dieser Bilder ist ein wahres
Kabinettstück intimer Malerei, so etwa „Das Atelier der Gebrüder
Gropius“ oder „Die ehemalige Reetzengasse“. Wie spielt da das
Licht in die enge Gasse hinein, wie fein sind die atmosphärischen
Reflexe wiedergageben; Das ,jgroße Panorama von Berlin im
Jahre 1834“, vom Dach der Werderschen Kirche aus gesehen, ist
derbar. Von dieser subtilen Meisterschaft ist aber noch manches
andere.
Wer war dieser Gärtner eigentlich, fragt man sich jetzt, von
dem Adolf Rosenberg in seiner „Berliner Malerschule“ (Berlin
1879) nur in einer Fußnote Notiz nimmt? Aber haben denn wir
seilbst diesen „Vedutenmaler“ nioht auch für keinen vollwertigen
Künstler gehalten? Daß er 1801 in Berlin geboren uind 1877 gestor-
ben ist, daß er erst Porzellanmaler war und dann bei dem Theater-
maler Gropius Beschäftigung fand, und daß sich seine Tätigkeit
„zuletzt“, wie Rosenberg schreibt, „auf die Prospektmalerei er-
streckte“, das ergibt in großen Ziigen den Lebenslauf eines Malers,
dem die Kunst, wie übrigens den meisten alten Meistern auch,
vor allem Handwerk war. Das Bild seines Lebens und Charakters
wird für uns glücklich ergänzt duirch das in der Ausstellung befind-
'liohe, von einem unbekannten Meister stammende, ausgezeichnete
Porträt. Das zeigt keinen leichtlebigen Künstler, sondern einen von
der Art, die es sich schwer macht. Der Mund ist zu einem freund-
lichen Lächeln, fast ein wenig künstlich, hochgezogen, aber die
schar.f beobachtenden Augen lächeln nicht: sie blicken scheu, fast
ängstlich. Die freundiiche, zurückhaltende Kühle seiner Bilder ist
494
Es fet wohl kein Zweifel, vielleicht aber ein Symiptom jener
berüchtigten Weltgesetzlichkeit von der Wiederkehr des Gleiohen,
daß beute auf der Großen Berliner Kunstausstellung die Ausstellung
von Werken Eduard Gärtners stattfindet. Eduard Gärtner huidigte
ganz schlicht und selbstverständlich einer Kunstauffassung, die mit
gewissen Grundzügen der heutfeen Neuen Sachilichkeit einige
Beriihrungspunkte hat. Innerhalib der Gesamtausstellung mutet das
Werk dieses Arcbitekturmalers der Biedermeierzeit wie eine stille
Insel an, die -den toseriden Lärm des Kunstorkans' ringsum sanft
glättet. Gärtner war kein Genie, und er hat sich selbst vermutlich
auch fiir keines gehalten. Aber die ruhige, effektlose Sachlichkeit
von kühler, altberlinischer Sachlichkeit; kein Fenster ist vergessen,
nichts flüchtig gearbeitet und doch ordnet sich alles dem Gesamt-
ton unter. Das ist. bei aller biedermeierischen Pedanterie gute,
sorgfältige Arbeit. Die malerische Frische und ' außerordentliche
Tonfeinheit, die auf den ausgeführten Bildern bisweilen einer vom
Besteller geforderten Genauiigkeit zum Opfer gebracht wurde,
kommt in den Studien überraschend zum Vorschein. Unter den
Handzeichnungen und kleinen farbigen Blättern ist das Gesieht
einer Hofrätin Tauber ein Juwel saftvoller Kleinmalerei. Nein, das
hat man Gärtnern einfach n.icht zugetraut! Auch die Oelstudie der
Gertraudenkapelle, sparsam in den Mitteln, in grauen, rötlichen,
bräumliohen und gelblichen Tönen lasiert, die Details noch mit Blei-
stifft eingezeichnet, ist in der farbigen Gesamtwirkung einfach wun-
Gaukler
Tang-Figuir
griin mit peau d'orange
Ausstellung
bei
Ernst Fritzsche
Berlin
seines Werkes und der sichere, selten beirrbare Geschmack könn-
ten der Neuen Sachlichkeit zum Vorbild dienen. Wi'r wollen anneh-
•men, daß dies der Hauptzweck der Veranstaltung sei. (Dies ist
nun nicht so zu verstehen, daß die Bilder nicht auoh allein für sich
selbst, ohne untergeschobene Nebenansicht, zu bestehen vermöch-
ten.) Dem BerJiner galten Gärtners Biilder von jeiher mehr als
Reliquien einer fernen, lieben Vergangenheit, denn als Kunstwerke.
Wenn Lessing mit seinem bekannten Spruch vom Kunstlob recht
hätte, so wäre Gärtner einer der erfolgreichsten Künstler, denn
stets hat man über seinem Werke das Lob des Malers vergessen.
Diese Gemälde waren getreue Abbilder Alt-Berlins, das genügte
dem Beoibachter voliauf. Erst jetzt, in der veränderten Umgebung,
denkt man daran, diese bescheidenen Bilder auf ihren Kunstwert
thin anzuseihen. Und siehe da! Sie schneiden gar nicht schlecht
ab dabei. Das eine und andere dieser Bilder ist ein wahres
Kabinettstück intimer Malerei, so etwa „Das Atelier der Gebrüder
Gropius“ oder „Die ehemalige Reetzengasse“. Wie spielt da das
Licht in die enge Gasse hinein, wie fein sind die atmosphärischen
Reflexe wiedergageben; Das ,jgroße Panorama von Berlin im
Jahre 1834“, vom Dach der Werderschen Kirche aus gesehen, ist
derbar. Von dieser subtilen Meisterschaft ist aber noch manches
andere.
Wer war dieser Gärtner eigentlich, fragt man sich jetzt, von
dem Adolf Rosenberg in seiner „Berliner Malerschule“ (Berlin
1879) nur in einer Fußnote Notiz nimmt? Aber haben denn wir
seilbst diesen „Vedutenmaler“ nioht auch für keinen vollwertigen
Künstler gehalten? Daß er 1801 in Berlin geboren uind 1877 gestor-
ben ist, daß er erst Porzellanmaler war und dann bei dem Theater-
maler Gropius Beschäftigung fand, und daß sich seine Tätigkeit
„zuletzt“, wie Rosenberg schreibt, „auf die Prospektmalerei er-
streckte“, das ergibt in großen Ziigen den Lebenslauf eines Malers,
dem die Kunst, wie übrigens den meisten alten Meistern auch,
vor allem Handwerk war. Das Bild seines Lebens und Charakters
wird für uns glücklich ergänzt duirch das in der Ausstellung befind-
'liohe, von einem unbekannten Meister stammende, ausgezeichnete
Porträt. Das zeigt keinen leichtlebigen Künstler, sondern einen von
der Art, die es sich schwer macht. Der Mund ist zu einem freund-
lichen Lächeln, fast ein wenig künstlich, hochgezogen, aber die
schar.f beobachtenden Augen lächeln nicht: sie blicken scheu, fast
ängstlich. Die freundiiche, zurückhaltende Kühle seiner Bilder ist
494