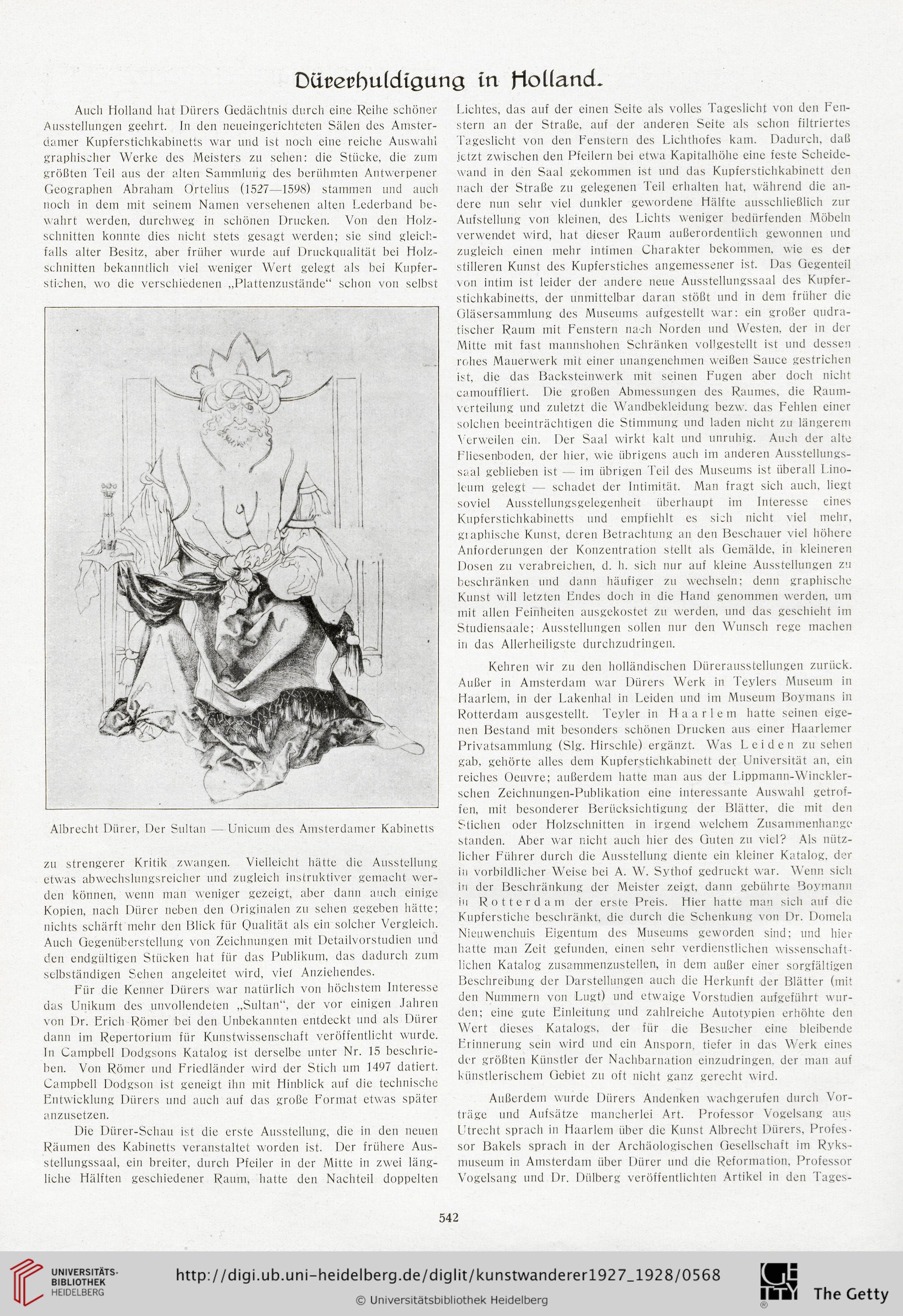Düüeübuldtgung in Jioüand.
Auch Holland liat Diirers Gcdächtnis durch eine Rcihc schöner
Ausstellungen geehrt. In den neueingerichteten Sälen des Amster-
damer Kupferstichkabinetts war und ist noch eine reiche Auswahi
graphischer Werke des Meisters zu sehen: die Stiicke, die zum
größten Teil aus der alten Sammlung des berühmten Antwerpener
Geographen Abraham Ortelius (1527—1598) stammen und auch
noch in dem mit seinem Namen versehenen alten Lederband be-
wahrt werden, durchweg in schönen Drucken. Vön den Holz-
schnitten konnte dies nicht stets gesagt werden; sie sind gleich-
falls alter Besitz, aber früher wurde auf Druckqualität bei Holz-
schnitten bekanntlich viel weniger Wert gelegt als bei Kupfer-
stichen, wo die verschiedenen „Plattenzustände“ schon von selbst
zu strengerer Kritik zwangen. Vielleicht hätte die Ausstellung
etwas abwechslungsreicher und zugleich instruktiver gemacht wer-
den können, wenn man weniger gezeigt, aber dann auch einige
Kopien, nach Dürer neben den Originalen zu sehen gegeben hätte;
nichts schärft mehr den Blick für Oualität als ein solcher Vergleich.
Auch Gegenüberstellung von Zeichnungen mit Detailvorstudien und
den endgültigen Stücken hat für das Publikum, das dadurch zum
selbständigen Sehen angeleitet wird, viet Anziehendes.
Für die Kcnner Dürers war natürlich von höchstem Interesse
das Unikum des unvollendeten „Sultan“, der vor einigen Jahren
von Dr. Erich Römer bei den Unbekannten entdeckt und als Dürer
dann im Repertorium für Kunstwissenschaft veröffentlicht wurde.
In Campbell Dodgsons Katalog ist derselbe unter Nr. 15 beschrie-
ben. Von Römcr und Friedländer wird der Stich um 1497 datiert.
Campbell Dodgson ist geneigt ihn mit Hinblick auf die technische
Entwicklung Dürers und auch auf das große Format etwas später
anzusetzen.
Die Dürer-Schau ist die erste Ausstellung, die in den neuen
Räumen des Kabinetts veranstaltet worden ist. Der frühere Aus-
stellungssaal, ein breiter, durch Pfciler in der Mitte in zwei läng-
liche Hälften geschiedener Raum, hatte den Nachteil doppelten
Lichtes, das auf der einen Seite als volles Tageslicht von den Fen-
stern an der Straße, auf dcr anderen Seite als sclion filtriertcs
Tageslicht von den Fenstern des Lichthofes kam. Dadurch, daß
jetzt zwischen den Pfeilern bei etwa Kapitalhöhe eine feste Scheide-
wand in den Saal gekommen ist und das Kupferstichkabinett den
nach der Straße zu gelegenen Teil erhalten hat, während die an-
dere nun selir viel dunkler gewordene Hälfte ausschließlich zur
Aufstellung von kleinen, des Lichts weniger bediirfenden Möbeln
verwendet wird, hat dieser Raum außerordentlich gewonnen und
zugleich einen mehr intimen Charakter bekommen, wie es der
stilleren Kunst des Kupferstiches angemessener ist. Das Gegenteil
von intim ist leider der andere neue Ausstellungssaal des Kupfer-
stichkabinetts, der unmittelbar daran stößt und in dem früher die
Gläsersammlung des Museums aufgestellt war: ein großer qudra-
tischer Raum mit Fenstern nach Norden und Westen, der in der
Mitte mit fast mannshohen Schränken vollgestellt ist und dessen
rohes Mauerwerk mit einer unangenehmen weißen Sauce gestrichen
ist, die das Backsteinwerk mit seinen Fugen aber doch nicht
camouffliert. Die großen Abmessungen des Raumes, die Raum-
verteilung und zuletzt die Wandbekleidung bezw. das Fehlen einer
solchen beeinträchtigen die Stimmung und laden nicht zu längerem
Verweilen ein. Der Saal wirkt kalt und unruhig. Auch der alte
Fliesenboden, dcr hier, wie iibrigens auch im anderen Ausstellungs-
saal geblieben ist — im übrigen Teil des Museums ist überall Lino-
leum gelegt — schadet der Intimität. Man fragt sich auch, liegt
soviel Ausstcllungsgelegenheit überhaupt im Interesse eines
Kupferstichkabinetts und empfiehlt es sieh nicht viel mehr,
graphisehe Kunst, deren Betrachtung an den Beschauer viel höhere
Anforderungen der Konzentration stellt als Gemälde, in kleineren
Dosen zu verabreichen, d. h. sich nur auf kleine Ausstellungen zu
beschränken und dann häufiger zu wechseln: denn graphische
Kunst wiil letzten Endes doch in die Hand genommen werden, um
mit allen Feinheiten ausgekostet zu werden, und das geschieht im
Studiensaale; Ausstellungen sollen nur den Wunsch rege machen
iri das Allerheiligste durchzudringen.
Kehren wir zu den holländischen Dürerausstellungen zuriick.
Außer in Amsterdam war Dürers Werk in Teylers Museum in
Haarlem, in der Lakenhal in Leiden und im Museum Boymans in
Rotterdam ausgestellt. Teyler in H a a r 1 e m hatte seinen eige-
nen Bestand mit besonders schönen Drucken aus einer Haarlemer
Privatsammlung (Slg. Hirschle) ergänzt. Was Leiden zu sehen
gab, gehörte alles dem Kupferstichkabinett der Universität an, ein
reiches Oeuvre; außerdem hatte man aus der Lippmann-Winckler-
schen Zeichnungen-Publikation eine interessante Auswahl getrof-
fen, mit besonderer Beriicksichtigung der Blätter, die mit den
Stichen oder Holzschnitten in irgend welchem Zusammenhange
standen. Aber war nicht auch liier des Guten zu viel? Als nütz-
licher Führer durch die Ausstellung diente ein kleiner Katalog. der
in vorbildlicher Weise bei A. W. Sythof gedruckt war. Wenn sicli
iri der Beschränkung der Meister zeigt, dann gebührte Boymann
iu Rotterdam der erste Preis. Hier hatte man sich auf die
Kupferstiche beschränkt, die durch die Schenkung von Dr. Domela
Nieuwenchuis Eigentum des Museums geworden sind; und hier
hatte man Zeit gefunden, einen sehr verdienstlichen wissenschaft-
lichen Katalog zusammenzustellen, in dem außer einer sorgfältigen
Beschreibung der Darstellungen auch die Herkunft der Blätter (mit
den Nummern von Lugt) und etwaige Vorstudien aufgeführt wur-
den; eine gute Einleitung und zahlreiche Autotypien erhöhte den
Wert dieses Katalogs, der für die Besucher eine bleibende
Erinnerung sein wird und ein Ansporn, tiefer in das Werk eines
der größten Kiinstler der Nachbarnation einzudringen, der man auf
künstlerischem Gebiet zu oft nicht ganz gerecht wird.
Außerdem wurde Dürers Andenken wachgerufen durch Vor-
träge und Aufsätze mancherlei Art. Professor Vogelsang aus
Utrecht sprach in Haarlem über die Kunst Albrecht Dürers, Profes-
sor Bakels sprach in der Archäologischen Gesellschaft im Ryks-
museum in Amsterdam über Diirer und die Reformation, Professor
Vogeisang und Dr. Diilberg veröffentlichten Artikel in den Tages-
542
Auch Holland liat Diirers Gcdächtnis durch eine Rcihc schöner
Ausstellungen geehrt. In den neueingerichteten Sälen des Amster-
damer Kupferstichkabinetts war und ist noch eine reiche Auswahi
graphischer Werke des Meisters zu sehen: die Stiicke, die zum
größten Teil aus der alten Sammlung des berühmten Antwerpener
Geographen Abraham Ortelius (1527—1598) stammen und auch
noch in dem mit seinem Namen versehenen alten Lederband be-
wahrt werden, durchweg in schönen Drucken. Vön den Holz-
schnitten konnte dies nicht stets gesagt werden; sie sind gleich-
falls alter Besitz, aber früher wurde auf Druckqualität bei Holz-
schnitten bekanntlich viel weniger Wert gelegt als bei Kupfer-
stichen, wo die verschiedenen „Plattenzustände“ schon von selbst
zu strengerer Kritik zwangen. Vielleicht hätte die Ausstellung
etwas abwechslungsreicher und zugleich instruktiver gemacht wer-
den können, wenn man weniger gezeigt, aber dann auch einige
Kopien, nach Dürer neben den Originalen zu sehen gegeben hätte;
nichts schärft mehr den Blick für Oualität als ein solcher Vergleich.
Auch Gegenüberstellung von Zeichnungen mit Detailvorstudien und
den endgültigen Stücken hat für das Publikum, das dadurch zum
selbständigen Sehen angeleitet wird, viet Anziehendes.
Für die Kcnner Dürers war natürlich von höchstem Interesse
das Unikum des unvollendeten „Sultan“, der vor einigen Jahren
von Dr. Erich Römer bei den Unbekannten entdeckt und als Dürer
dann im Repertorium für Kunstwissenschaft veröffentlicht wurde.
In Campbell Dodgsons Katalog ist derselbe unter Nr. 15 beschrie-
ben. Von Römcr und Friedländer wird der Stich um 1497 datiert.
Campbell Dodgson ist geneigt ihn mit Hinblick auf die technische
Entwicklung Dürers und auch auf das große Format etwas später
anzusetzen.
Die Dürer-Schau ist die erste Ausstellung, die in den neuen
Räumen des Kabinetts veranstaltet worden ist. Der frühere Aus-
stellungssaal, ein breiter, durch Pfciler in der Mitte in zwei läng-
liche Hälften geschiedener Raum, hatte den Nachteil doppelten
Lichtes, das auf der einen Seite als volles Tageslicht von den Fen-
stern an der Straße, auf dcr anderen Seite als sclion filtriertcs
Tageslicht von den Fenstern des Lichthofes kam. Dadurch, daß
jetzt zwischen den Pfeilern bei etwa Kapitalhöhe eine feste Scheide-
wand in den Saal gekommen ist und das Kupferstichkabinett den
nach der Straße zu gelegenen Teil erhalten hat, während die an-
dere nun selir viel dunkler gewordene Hälfte ausschließlich zur
Aufstellung von kleinen, des Lichts weniger bediirfenden Möbeln
verwendet wird, hat dieser Raum außerordentlich gewonnen und
zugleich einen mehr intimen Charakter bekommen, wie es der
stilleren Kunst des Kupferstiches angemessener ist. Das Gegenteil
von intim ist leider der andere neue Ausstellungssaal des Kupfer-
stichkabinetts, der unmittelbar daran stößt und in dem früher die
Gläsersammlung des Museums aufgestellt war: ein großer qudra-
tischer Raum mit Fenstern nach Norden und Westen, der in der
Mitte mit fast mannshohen Schränken vollgestellt ist und dessen
rohes Mauerwerk mit einer unangenehmen weißen Sauce gestrichen
ist, die das Backsteinwerk mit seinen Fugen aber doch nicht
camouffliert. Die großen Abmessungen des Raumes, die Raum-
verteilung und zuletzt die Wandbekleidung bezw. das Fehlen einer
solchen beeinträchtigen die Stimmung und laden nicht zu längerem
Verweilen ein. Der Saal wirkt kalt und unruhig. Auch der alte
Fliesenboden, dcr hier, wie iibrigens auch im anderen Ausstellungs-
saal geblieben ist — im übrigen Teil des Museums ist überall Lino-
leum gelegt — schadet der Intimität. Man fragt sich auch, liegt
soviel Ausstcllungsgelegenheit überhaupt im Interesse eines
Kupferstichkabinetts und empfiehlt es sieh nicht viel mehr,
graphisehe Kunst, deren Betrachtung an den Beschauer viel höhere
Anforderungen der Konzentration stellt als Gemälde, in kleineren
Dosen zu verabreichen, d. h. sich nur auf kleine Ausstellungen zu
beschränken und dann häufiger zu wechseln: denn graphische
Kunst wiil letzten Endes doch in die Hand genommen werden, um
mit allen Feinheiten ausgekostet zu werden, und das geschieht im
Studiensaale; Ausstellungen sollen nur den Wunsch rege machen
iri das Allerheiligste durchzudringen.
Kehren wir zu den holländischen Dürerausstellungen zuriick.
Außer in Amsterdam war Dürers Werk in Teylers Museum in
Haarlem, in der Lakenhal in Leiden und im Museum Boymans in
Rotterdam ausgestellt. Teyler in H a a r 1 e m hatte seinen eige-
nen Bestand mit besonders schönen Drucken aus einer Haarlemer
Privatsammlung (Slg. Hirschle) ergänzt. Was Leiden zu sehen
gab, gehörte alles dem Kupferstichkabinett der Universität an, ein
reiches Oeuvre; außerdem hatte man aus der Lippmann-Winckler-
schen Zeichnungen-Publikation eine interessante Auswahl getrof-
fen, mit besonderer Beriicksichtigung der Blätter, die mit den
Stichen oder Holzschnitten in irgend welchem Zusammenhange
standen. Aber war nicht auch liier des Guten zu viel? Als nütz-
licher Führer durch die Ausstellung diente ein kleiner Katalog. der
in vorbildlicher Weise bei A. W. Sythof gedruckt war. Wenn sicli
iri der Beschränkung der Meister zeigt, dann gebührte Boymann
iu Rotterdam der erste Preis. Hier hatte man sich auf die
Kupferstiche beschränkt, die durch die Schenkung von Dr. Domela
Nieuwenchuis Eigentum des Museums geworden sind; und hier
hatte man Zeit gefunden, einen sehr verdienstlichen wissenschaft-
lichen Katalog zusammenzustellen, in dem außer einer sorgfältigen
Beschreibung der Darstellungen auch die Herkunft der Blätter (mit
den Nummern von Lugt) und etwaige Vorstudien aufgeführt wur-
den; eine gute Einleitung und zahlreiche Autotypien erhöhte den
Wert dieses Katalogs, der für die Besucher eine bleibende
Erinnerung sein wird und ein Ansporn, tiefer in das Werk eines
der größten Kiinstler der Nachbarnation einzudringen, der man auf
künstlerischem Gebiet zu oft nicht ganz gerecht wird.
Außerdem wurde Dürers Andenken wachgerufen durch Vor-
träge und Aufsätze mancherlei Art. Professor Vogelsang aus
Utrecht sprach in Haarlem über die Kunst Albrecht Dürers, Profes-
sor Bakels sprach in der Archäologischen Gesellschaft im Ryks-
museum in Amsterdam über Diirer und die Reformation, Professor
Vogeisang und Dr. Diilberg veröffentlichten Artikel in den Tages-
542