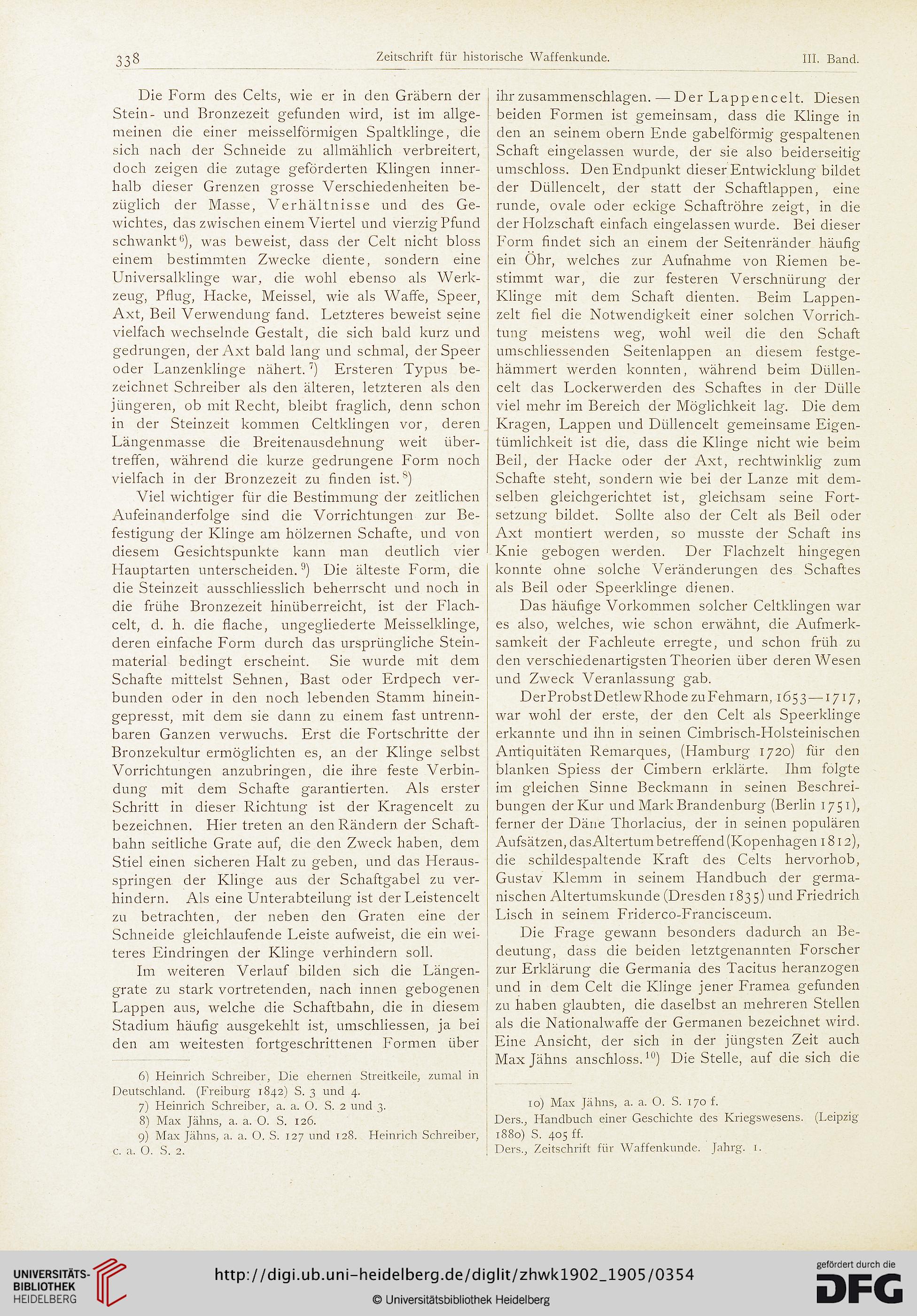338
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
III. Band.
Die Form des Celts, wie er in den Gräbern der
Stein- und Bronzezeit gefunden wird, ist im allge-
meinen die einer meisseiförmigen Spaltklinge, die
sich nach der Schneide zu allmählich verbreitert,
doch zeigen die zutage geförderten Klingen inner-
halb dieser Grenzen grosse Verschiedenheiten be-
züglich der Masse, Verhältnisse und des Ge-
wichtes, das zwischen einem Viertel und vierzig Pfund
schwankt6), was beweist, dass der Celt nicht bloss
einem bestimmten Zwecke diente, sondern eine
Universalklinge war, die wohl ebenso als Werk-
zeug, Pflug, Hacke, Meissei, wie als Waffe, Speer,
Axt, Beil Verwendung fand. Letzteres beweist seine
vielfach wechselnde Gestalt, die sich bald kurz und
gedrungen, der Axt bald lang und schmal, der Speer
oder Lanzenklinge nähert.7) Ersteren Typus be-
zeichnet Schreiber als den älteren, letzteren als den
jüngeren, ob mit Recht, bleibt fraglich, denn schon
in der Steinzeit kommen Celtklingen vor, deren
Längenmasse die Breitenausdehnung weit über-
treffen, während die kurze gedrungene Form noch
vielfach in der Bronzezeit zu finden ist.8)
Viel wichtiger für die Bestimmung der zeitlichen
Aufeinanderfolge sind die Vorrichtungen zur Be-
festigung der Klinge am hölzernen Schafte, und von
diesem Gesichtspunkte kann man deutlich vier
Hauptarten unterscheiden.9) Die älteste Form, die
die Steinzeit ausschliesslich beherrscht und noch in
die frühe Bronzezeit hinüberreicht, ist der Flach-
celt, d. h. die flache, ungegliederte Meisseiklinge,
deren einfache Form durch das ursprüngliche Stein-
material bedingt erscheint. Sie wurde mit dem
Schafte mittelst Sehnen, Bast oder Erdpech ver-
bunden oder in den noch lebenden Stamm hinein-
gepresst, mit dem sie dann zu einem fast untrenn-
baren Ganzen verwuchs. Erst die Fortschritte der
Bronzekultur ermöglichten es, an der Klinge selbst
Vorrichtungen anzubringen, die ihre feste Verbin-
dung mit dem Schafte garantierten. Als erster
Schritt in dieser Richtung ist der Kragencelt zu
bezeichnen. Hier treten an den Rändern der Schaft-
bahn seitliche Grate auf, die den Zweck haben, dem
Stiel einen sicheren Halt zu geben, und das Heraus-
springen der Klinge aus der Schaftgabel zu ver-
hindern. Als eine Unterabteilung ist der Leistencelt
zu betrachten, der neben den Graten eine der
Schneide gleichlaufende Leiste aufweist, die ein wei-
teres Eindringen der Klinge verhindern soll.
Im weiteren Verlauf bilden sich die Längen-
grate zu stark vortretenden, nach innen gebogenen
Lappen aus, welche die Schaftbahn, die in diesem
Stadium häufig ausgekehlt ist, umschliessen, ja bei
den am weitesten fortgeschrittenen Formen über
6) Heinrich Schreiber, Die ehernen Streitkeile, zumal in
Deutschland. (Freiburg 1842) S. 3 und 4.
7) Heinrich Schreiber, a. a. O. S. 2 und 3.
8) Max Jäh ns, a. a. O. S. 126.
9) Max Jähns, a. a. O. S. 127 und 128. Heinrich Schreiber,
c. a. O. S. 2.
ihr zusammenschlagen. — Der Lappencelt. Diesen
beiden Formen ist gemeinsam, dass die Klinge in
den an seinem obern Ende gabelförmig gespaltenen
Schaft eingelassen wurde, der sie also beiderseitig
umschloss. Den Endpunkt dieser Entwicklung bildet
der Düllencelt, der statt der Schaftlappen, eine
runde, ovale oder eckige Schaftröhre zeigt, in die
der Holzschaft einfach eingelassen wurde. Bei dieser
P'orm findet sich an einem der Seitenränder häufig-
ein Öhr, welches zur Aufnahme von Riemen be-
stimmt war, die zur festeren Verschnürung der
Klinge mit dem Schaft dienten. Beim Lappen-
zelt fiel die Notwendigkeit einer solchen Vorrich-
tung meistens weg, wohl weil die den Schaft
umschliessenden Seitenlappen an diesem festge-
hämmert werden konnten, während beim Düllen-
celt das Lockerwerden des Schaftes in der Dülle
viel mehr im Bereich der Möglichkeit lag. Die dem
Kragen, Lappen und Düllencelt gemeinsame Eigen-
tümlichkeit ist die, dass die Klinge nicht wie beim
Beil, der Hacke oder der Axt, rechtwinklig zum
Schafte steht, sondern wie bei der Lanze mit dem-
selben gleichgerichtet ist, gleichsam seine Fort-
setzung bildet. Sollte also der Celt als Beil oder
Axt montiert werden, so musste der Schaft ins
Knie gebogen werden. Der Flachzelt hingegen
konnte ohne solche Veränderungen des Schaftes
als Beil oder Speerklinge dienen.
Das häufige Vorkommen solcher Celtklingen war
es also, welches, wie schon erwähnt, die Aufmerk-
samkeit der Fachleute erregte, und schon früh zu
den verschiedenartigsten Theorien über deren Wesen
und Zweck Veranlassung gab.
Der Probst DetlewRhode zu Fehmarn, 1653 —1717,
war wohl der erste, der den Celt als Speerklinge
erkannte und ihn in seinen Cimbrisch-Holsteinischen
Antiquitäten Remarques, (Hamburg 1720) für den
blanken Spiess der Cimbern erklärte. Ihm folgte
im gleichen Sinne Beckmann in seinen Beschrei-
bungen der Kur und Mark Brandenburg (Berlin 1751),
ferner der Däne Thorlacius, der in seinen populären
Aufsätzen, dasAltertum betreffend (Kopenhagen 1812),
die schildespaltende Kraft des Celts hervorhob,
Gustav Klemm in seinem Handbuch der germa-
nischen Altertumskunde (Dresden 183 5) und Friedrich
Lisch in seinem Friderco-Francisceum.
Die Frage gewann besonders dadurch an Be-
deutung, dass die beiden letztgenannten Forscher
zur Erklärung die Germania des Tacitus heranzogen
und in dem Celt die Klinge jener Framea gefunden
zu haben glaubten, die daselbst an mehreren Stellen
als die Nationalwaffe der Germanen bezeichnet wird.
Eine Ansicht, der sich in der jüngsten Zeit auch
Max Jähns anschloss.10) Die Stelle, auf die sich die
10) Max Jähns, a. a. O. S. 170 f.
Ders., Handbuch einer Geschichte des Kriegswesens. (Leipzig
1880) S. 405 ff.
Ders., Zeitschrift für Waffenkunde. Jahrg. 1.
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
III. Band.
Die Form des Celts, wie er in den Gräbern der
Stein- und Bronzezeit gefunden wird, ist im allge-
meinen die einer meisseiförmigen Spaltklinge, die
sich nach der Schneide zu allmählich verbreitert,
doch zeigen die zutage geförderten Klingen inner-
halb dieser Grenzen grosse Verschiedenheiten be-
züglich der Masse, Verhältnisse und des Ge-
wichtes, das zwischen einem Viertel und vierzig Pfund
schwankt6), was beweist, dass der Celt nicht bloss
einem bestimmten Zwecke diente, sondern eine
Universalklinge war, die wohl ebenso als Werk-
zeug, Pflug, Hacke, Meissei, wie als Waffe, Speer,
Axt, Beil Verwendung fand. Letzteres beweist seine
vielfach wechselnde Gestalt, die sich bald kurz und
gedrungen, der Axt bald lang und schmal, der Speer
oder Lanzenklinge nähert.7) Ersteren Typus be-
zeichnet Schreiber als den älteren, letzteren als den
jüngeren, ob mit Recht, bleibt fraglich, denn schon
in der Steinzeit kommen Celtklingen vor, deren
Längenmasse die Breitenausdehnung weit über-
treffen, während die kurze gedrungene Form noch
vielfach in der Bronzezeit zu finden ist.8)
Viel wichtiger für die Bestimmung der zeitlichen
Aufeinanderfolge sind die Vorrichtungen zur Be-
festigung der Klinge am hölzernen Schafte, und von
diesem Gesichtspunkte kann man deutlich vier
Hauptarten unterscheiden.9) Die älteste Form, die
die Steinzeit ausschliesslich beherrscht und noch in
die frühe Bronzezeit hinüberreicht, ist der Flach-
celt, d. h. die flache, ungegliederte Meisseiklinge,
deren einfache Form durch das ursprüngliche Stein-
material bedingt erscheint. Sie wurde mit dem
Schafte mittelst Sehnen, Bast oder Erdpech ver-
bunden oder in den noch lebenden Stamm hinein-
gepresst, mit dem sie dann zu einem fast untrenn-
baren Ganzen verwuchs. Erst die Fortschritte der
Bronzekultur ermöglichten es, an der Klinge selbst
Vorrichtungen anzubringen, die ihre feste Verbin-
dung mit dem Schafte garantierten. Als erster
Schritt in dieser Richtung ist der Kragencelt zu
bezeichnen. Hier treten an den Rändern der Schaft-
bahn seitliche Grate auf, die den Zweck haben, dem
Stiel einen sicheren Halt zu geben, und das Heraus-
springen der Klinge aus der Schaftgabel zu ver-
hindern. Als eine Unterabteilung ist der Leistencelt
zu betrachten, der neben den Graten eine der
Schneide gleichlaufende Leiste aufweist, die ein wei-
teres Eindringen der Klinge verhindern soll.
Im weiteren Verlauf bilden sich die Längen-
grate zu stark vortretenden, nach innen gebogenen
Lappen aus, welche die Schaftbahn, die in diesem
Stadium häufig ausgekehlt ist, umschliessen, ja bei
den am weitesten fortgeschrittenen Formen über
6) Heinrich Schreiber, Die ehernen Streitkeile, zumal in
Deutschland. (Freiburg 1842) S. 3 und 4.
7) Heinrich Schreiber, a. a. O. S. 2 und 3.
8) Max Jäh ns, a. a. O. S. 126.
9) Max Jähns, a. a. O. S. 127 und 128. Heinrich Schreiber,
c. a. O. S. 2.
ihr zusammenschlagen. — Der Lappencelt. Diesen
beiden Formen ist gemeinsam, dass die Klinge in
den an seinem obern Ende gabelförmig gespaltenen
Schaft eingelassen wurde, der sie also beiderseitig
umschloss. Den Endpunkt dieser Entwicklung bildet
der Düllencelt, der statt der Schaftlappen, eine
runde, ovale oder eckige Schaftröhre zeigt, in die
der Holzschaft einfach eingelassen wurde. Bei dieser
P'orm findet sich an einem der Seitenränder häufig-
ein Öhr, welches zur Aufnahme von Riemen be-
stimmt war, die zur festeren Verschnürung der
Klinge mit dem Schaft dienten. Beim Lappen-
zelt fiel die Notwendigkeit einer solchen Vorrich-
tung meistens weg, wohl weil die den Schaft
umschliessenden Seitenlappen an diesem festge-
hämmert werden konnten, während beim Düllen-
celt das Lockerwerden des Schaftes in der Dülle
viel mehr im Bereich der Möglichkeit lag. Die dem
Kragen, Lappen und Düllencelt gemeinsame Eigen-
tümlichkeit ist die, dass die Klinge nicht wie beim
Beil, der Hacke oder der Axt, rechtwinklig zum
Schafte steht, sondern wie bei der Lanze mit dem-
selben gleichgerichtet ist, gleichsam seine Fort-
setzung bildet. Sollte also der Celt als Beil oder
Axt montiert werden, so musste der Schaft ins
Knie gebogen werden. Der Flachzelt hingegen
konnte ohne solche Veränderungen des Schaftes
als Beil oder Speerklinge dienen.
Das häufige Vorkommen solcher Celtklingen war
es also, welches, wie schon erwähnt, die Aufmerk-
samkeit der Fachleute erregte, und schon früh zu
den verschiedenartigsten Theorien über deren Wesen
und Zweck Veranlassung gab.
Der Probst DetlewRhode zu Fehmarn, 1653 —1717,
war wohl der erste, der den Celt als Speerklinge
erkannte und ihn in seinen Cimbrisch-Holsteinischen
Antiquitäten Remarques, (Hamburg 1720) für den
blanken Spiess der Cimbern erklärte. Ihm folgte
im gleichen Sinne Beckmann in seinen Beschrei-
bungen der Kur und Mark Brandenburg (Berlin 1751),
ferner der Däne Thorlacius, der in seinen populären
Aufsätzen, dasAltertum betreffend (Kopenhagen 1812),
die schildespaltende Kraft des Celts hervorhob,
Gustav Klemm in seinem Handbuch der germa-
nischen Altertumskunde (Dresden 183 5) und Friedrich
Lisch in seinem Friderco-Francisceum.
Die Frage gewann besonders dadurch an Be-
deutung, dass die beiden letztgenannten Forscher
zur Erklärung die Germania des Tacitus heranzogen
und in dem Celt die Klinge jener Framea gefunden
zu haben glaubten, die daselbst an mehreren Stellen
als die Nationalwaffe der Germanen bezeichnet wird.
Eine Ansicht, der sich in der jüngsten Zeit auch
Max Jähns anschloss.10) Die Stelle, auf die sich die
10) Max Jähns, a. a. O. S. 170 f.
Ders., Handbuch einer Geschichte des Kriegswesens. (Leipzig
1880) S. 405 ff.
Ders., Zeitschrift für Waffenkunde. Jahrg. 1.