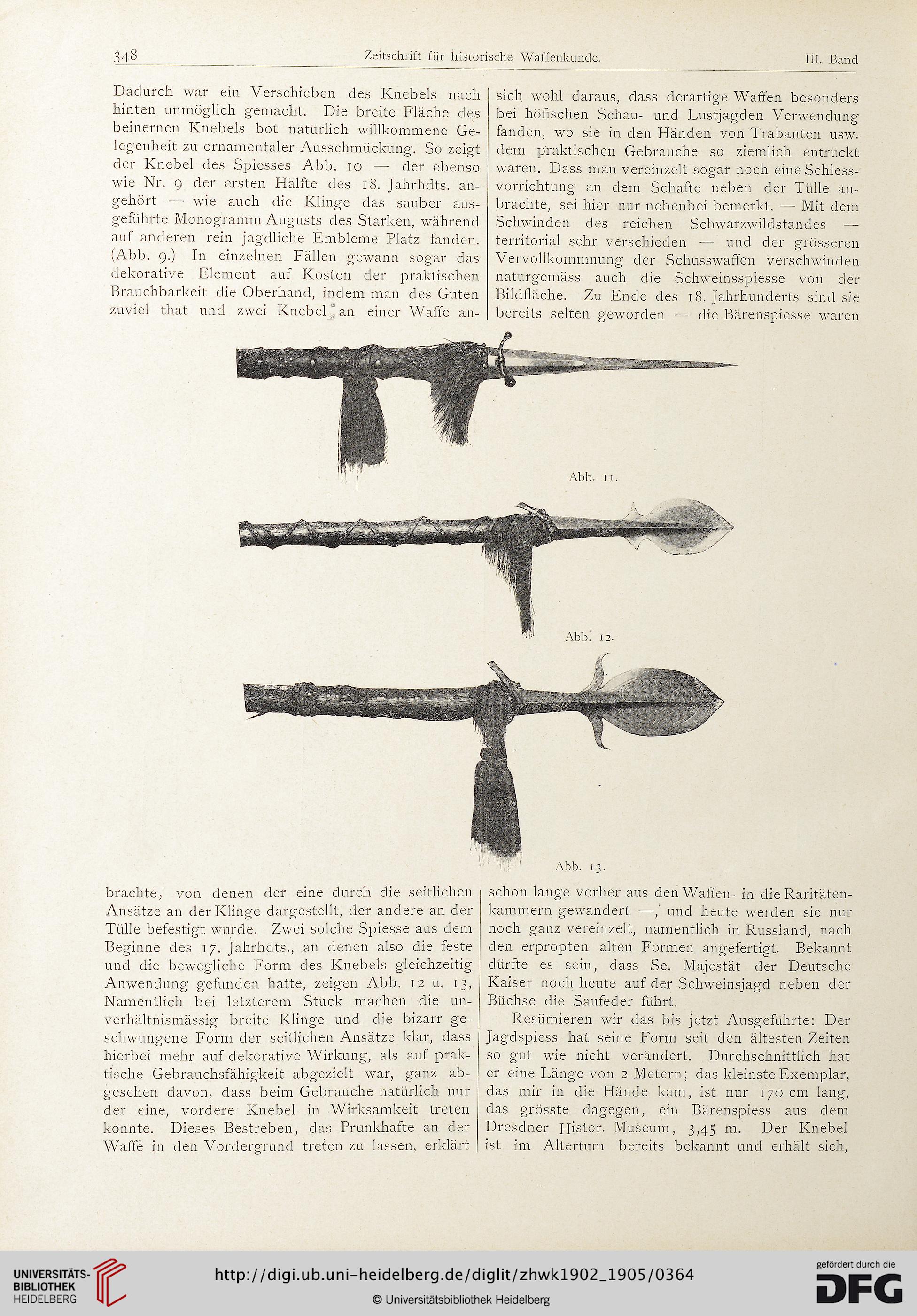343
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
III. Band
Dadurch war ein Verschieben des Knebels nach
hinten unmöglich gemacht. Die breite Fläche des
beinernen Knebels bot natürlich willkommene Ge-
legenheit zu ornamentaler Ausschmückung. So zeigt
der Knebel des Spiesses Abb. io — der ebenso
wie Nr. 9 der ersten Hälfte des 18. Jahrhdts. an-
gehört — wie auch die Klinge das sauber aus-
geführte Monogramm Augusts des Starken, während
auf anderen rein jagdliche Embleme Platz fanden.
(Abb. 9.) In einzelnen Fällen gewann sogar das
dekorative Element auf Kosten der praktischen
Brauchbarkeit die Oberhand, indem man des Guten
zuviel that und zwei Knebel an einer Waffe an-
sich wohl daraus, dass derartige Waffen besonders
bei höfischen Schau- und Lustjagden Verwendung
fanden, wo sie in den Händen von Trabanten usw.
dem praktischen Gebrauche so ziemlich entrückt
waren. Dass man vereinzelt sogar noch eine Schiess-
vorrichtung an dem Schafte neben der Tülle an-
brachte, sei hier nur nebenbei bemerkt. — Mit dem
Schwinden des reichen Schwarzwildstandes —
territorial sehr verschieden — und der grösseren
Vervollkommnung der Schusswaffen verschwinden
naturgemäss auch die Schweinsspies.se von der
Bildfläche. Zu Ende des 18. Jahrhunderts sind sie
bereits selten geworden — die Bärenspiesse waren
brachte, von denen der eine durch die seitlichen
Ansätze an der Klinge dargestellt, der andere an der
Tülle befestigt wurde. Zwei solche Spiesse aus dem
Beginne des 17. Jahrhdts., an denen also die feste
und die bewegliche Form des Knebels gleichzeitig
Anwendung gefunden hatte, zeigen Abb. 12 u. 13,
Namentlich bei letzterem Stück machen die un-
verhältnismässig breite Klinge und die bizarr ge-
schwungene Form der seitlichen Ansätze klar, dass
hierbei mehr auf dekorative Wirkung, als auf prak-
tische Gebrauchsfähigkeit abgezielt war, ganz ab-
gesehen davon, dass beim Gebrauche natürlich nur
der eine, vordere Knebel in Wirksamkeit treten
konnte. Dieses Bestreben, das Prunkhafte an der
Waffe in den Vordergrund treten zu lassen, erklärt
schon lange vorher aus den Waffen- in die Raritäten-
kammern gewandert —und heute werden sie nur
noch ganz vereinzelt, namentlich in Russland, nach
den erpropten alten Formen angefertigt. Bekannt
dürfte es sein, dass Se. Majestät der Deutsche
Kaiser noch heute auf der Schweinsjagd neben der
Büchse die Saufeder führt.
Resümieren wir das bis jetzt Ausgeführte: Der
Jagdspiess hat seine Form seit den ältesten Zeiten
so gut wie nicht verändert. Durchschnittlich hat
er eine Länge von 2 Metern; das kleinste Exemplar,
das mir in die Hände kam, ist nur 170 cm lang,
das grösste dagegen, ein Bärenspiess aus dem
Dresdner Plistor. Museum, 3,45 m. Der Knebel
ist im Altertum bereits bekannt und erhält sich,
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
III. Band
Dadurch war ein Verschieben des Knebels nach
hinten unmöglich gemacht. Die breite Fläche des
beinernen Knebels bot natürlich willkommene Ge-
legenheit zu ornamentaler Ausschmückung. So zeigt
der Knebel des Spiesses Abb. io — der ebenso
wie Nr. 9 der ersten Hälfte des 18. Jahrhdts. an-
gehört — wie auch die Klinge das sauber aus-
geführte Monogramm Augusts des Starken, während
auf anderen rein jagdliche Embleme Platz fanden.
(Abb. 9.) In einzelnen Fällen gewann sogar das
dekorative Element auf Kosten der praktischen
Brauchbarkeit die Oberhand, indem man des Guten
zuviel that und zwei Knebel an einer Waffe an-
sich wohl daraus, dass derartige Waffen besonders
bei höfischen Schau- und Lustjagden Verwendung
fanden, wo sie in den Händen von Trabanten usw.
dem praktischen Gebrauche so ziemlich entrückt
waren. Dass man vereinzelt sogar noch eine Schiess-
vorrichtung an dem Schafte neben der Tülle an-
brachte, sei hier nur nebenbei bemerkt. — Mit dem
Schwinden des reichen Schwarzwildstandes —
territorial sehr verschieden — und der grösseren
Vervollkommnung der Schusswaffen verschwinden
naturgemäss auch die Schweinsspies.se von der
Bildfläche. Zu Ende des 18. Jahrhunderts sind sie
bereits selten geworden — die Bärenspiesse waren
brachte, von denen der eine durch die seitlichen
Ansätze an der Klinge dargestellt, der andere an der
Tülle befestigt wurde. Zwei solche Spiesse aus dem
Beginne des 17. Jahrhdts., an denen also die feste
und die bewegliche Form des Knebels gleichzeitig
Anwendung gefunden hatte, zeigen Abb. 12 u. 13,
Namentlich bei letzterem Stück machen die un-
verhältnismässig breite Klinge und die bizarr ge-
schwungene Form der seitlichen Ansätze klar, dass
hierbei mehr auf dekorative Wirkung, als auf prak-
tische Gebrauchsfähigkeit abgezielt war, ganz ab-
gesehen davon, dass beim Gebrauche natürlich nur
der eine, vordere Knebel in Wirksamkeit treten
konnte. Dieses Bestreben, das Prunkhafte an der
Waffe in den Vordergrund treten zu lassen, erklärt
schon lange vorher aus den Waffen- in die Raritäten-
kammern gewandert —und heute werden sie nur
noch ganz vereinzelt, namentlich in Russland, nach
den erpropten alten Formen angefertigt. Bekannt
dürfte es sein, dass Se. Majestät der Deutsche
Kaiser noch heute auf der Schweinsjagd neben der
Büchse die Saufeder führt.
Resümieren wir das bis jetzt Ausgeführte: Der
Jagdspiess hat seine Form seit den ältesten Zeiten
so gut wie nicht verändert. Durchschnittlich hat
er eine Länge von 2 Metern; das kleinste Exemplar,
das mir in die Hände kam, ist nur 170 cm lang,
das grösste dagegen, ein Bärenspiess aus dem
Dresdner Plistor. Museum, 3,45 m. Der Knebel
ist im Altertum bereits bekannt und erhält sich,