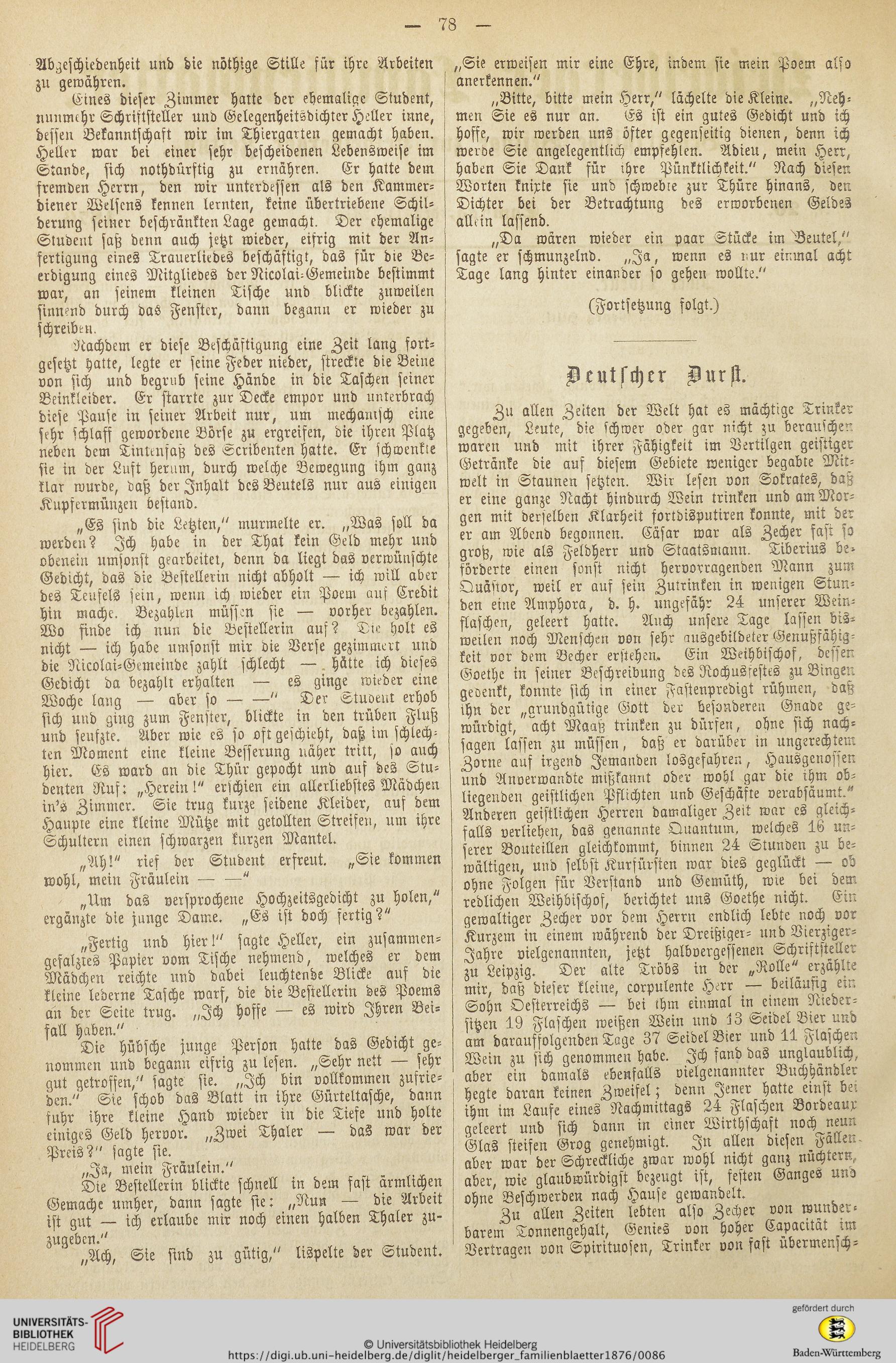Abgeſchiedenheit und die nöthige Stille für ihre Arbeiten
zu gewähren.
Eines dieſer Zimmer hatte der ehemalige Student,
nunmchr Schriftſteller und Gelegenheitsdichter Heller inne,
deſſen Bekanntſchaft wir im Thiergarten gemacht haben.
Heller war bei einer ſehr beſcheidenen Lebensweiſe im
Stande, ſich nothdürftig zu ernähren. Er hatte dem
fremden Herrn, den wir unterdeſſen als den Kammer-
diener Welſens kennen lernten, keine übertriebene Schil-
derung ſeiner beſchränkten Lage gemacht. Der ehemalige
Student ſaß denn auch jetzt wieder, eifrig mit der An-
fertigung eines Trauerliedes beſchäftigt, das für die Be-
erdigung eines Mitgliedes der Nicolai⸗Gemeinde beſtimmt
war, an ſeinem kleinen Tiſche und blickte zuweilen
ſinnend durch das Fenſter, dann begann er wieder zu
ſchreiben.
Nachdem er dieſe Beſchäftigung eine Zeit lang fort-
geſetzt hatte, legte er ſeine Feder nieder, ſtreckte die Beine
von ſich und begrub ſeine Hände in die Taſchen ſeiner
Beinkleider. Er ſtarrte zur Decke empor und unterbrach
dieſe Pauſe in ſeiner Arbeit nur, um mechaniſch eine
ſehr ſchlaff gewordene Börſe zu ergreifen, die ihren Platz
neben dem Tintenfaß des Scribenten hatte. Er ſchwenkte
ſie in der Luft herum, durch welche Bewegung ihm ganz
Har wurde, daß der Inhalt des Beutels nur aus einigen
Kupfermünzen beſtand.
„Es ſind die Letzten,“ murmelte er. „Was ſoll da
werden? Ich habe in der That kein Geld mehr und
obenein umſonſt gearbeitet, denn da liegt das verwünſchte
Gedicht, das die Beſtellerin nicht abholt — ich will aber
des Teufels ſein, wenn ich wieder ein Poem auf Credit
hin mache. Bezahlen müſſen ſie — vorher bezahlen.
Wo finde ich nun die Beſtellerin auf? Die holt es
nicht — ich habe umſonſt mir die Verſe gezimmert und
die Nicolai⸗Gemeinde zahlt ſchlecht —. haͤtte ich dieſes
Gedicht da bezahlt erhalten — es ginge wieder eine
Woche lang — aber ſo — —“ Der Student erhob
ſich und ging zum Fenſter, blickte in den trüben Fluß
und ſeufzte. Aber wie es ſo oft geſchieht, daß im ſchlech-
ten Moment eine kleine Beſſerung näher tritt, ſo auch
hier. Es ward an die Thür gepocht und auf des Stu-
denten Ruf: „Herein!“ erſchien ein allerliebſtes Mädchen
in's Zimmer. Sie trug kurze ſeidene Kleider, auf dem
Haupte eine kleine Mütze mit getollten Streifen, um ihre
Schultern einen ſchwarzen kurzen Mantel.
„Ah!“ rief der Student erfreut.
wohl, mein Fräulein — —“
„Um das verſprochene Hochzeitsgedicht zu holen,“
ergänzte die junge Dame. „Es iſt doch fertig?“
„Fertig und hier!“ ſagte Heller, ein zuſammen-
gefalztes Papier vom Tiſche nehmend, welches er dem
Mädchen reichte und dabei leuchtende Blicke auf die
kleine lederne Taſche warf, die die Beſtellerin des Poems
an der Seite trug. „Ich hoffe — es wird Ihren Bei-
fall haben.“ ö
Die hübſche junge Perſon hatte das Gedicht ge-
nommen und begann eifrig zu leſen. „Sehr nett — ſehr
gut getroffen,“ ſagte ſie. „Ich bin vollkommen zufrie-
den.“ Sie ſchob das Blatt in ihre Gürteltaſche, dann
fuhr ihre kleine Hand wieder in die Tiefe und holte
einiges Geld hervor. „Zwei Thaler — das war der
Preis?“ ſagte ſie.
„Ja, mein Fräulein.“
Die Beſtellerin blickte ſchnell in dem faſt ärmlichen
„Sie kommen
Gemache umher, dann ſagte ſie: „Nun — die Arbeit
iſt gut — ich erlaube mir noch einen halben Thaler zu-
zugeben.“
„Ach, Sie ſind zu gütig,“ lispelte der Student.
78 —
„Sie erweiſen mir eine Ehre, indem ſie mein Poem alſo
anerkennen.“
„Bitte, bitte mein Herr,“ lächelte die Kleine. „Neh-
men Sie es nur an. Es iſt ein gutes Gedicht und ich
hoffe, wir werden uns öfter gegenſeitig dienen, denn ich
werde Sie angelegentlich empfehlen. Adieu, mein Herr,
haben Sie Dank für ihre Pänktlichkeit.“ Nach dieſen
Worten knixte ſie und ſchwebte zur Thüre hinans, den
Dichter bei der Betrachtung des erworbenen Geldes
allein laſſend.
„Da wären wieder ein paar Stücke im Beutel,“
ſagte er ſchmunzelnd. „Ja, wenn es nur einmal acht
Tage lang hinter einander ſo gehen wollte.“
(Fortſetzung folgt.)
Deutſcher Durſt.
Zu allen Zeiten der Welt hat es mächtige Trinker
gegeben, Leute, die ſchwer oder gar nicht zu berauſchen
waren und mit ihrer Fähigkeit im Vertilgen geiſtiger
Getränke die auf dieſem Gebiete weniger begabte Mit-
welt in Staunen ſetzten. Wir leſen von Sokrates, daß
er eine ganze Nacht hindurch Wein trinken und am Mor-
gen mit derſelben Klarheit fortdisputiren konnte, mit der
er am Abend begonnen. Cäſar war als Zecher faſt ſo
groß, wie als Feldherr und Staatsmann. Tiberius be-
förderte einen ſonſt nicht hervorragenden Mann zum
Quäſtor, weil er auf ſein Zutrinken in wenigen Stun-
den eine Amphora, d. h. ungefähr 24 unſerer Wein-
flaſchen, geleert hatte. Auch unſere Tage laſſen bis-
weilen noch Menſchen von ſehr ausgebildeter Genußfähig-
keit vor dem Becher erſtehen. Ein Weihbiſchof, deſſen
Goethe in ſeiner Beſchreibung des Rochusfeſtes zu Bingen
gedenkt, konnte ſich in einer Faſtenpredigt rühmen, daß
ihn der „grundgütige Gott der beſonderen Gnade ge-
würdigt, acht Maaß trinken zu dürfen, ohne ſich nach-
ſagen laſſen zu müſſen, daß er darüber in ungerechtem
Zorne auf irgend Jemanden losgefahren, Hausgenoſſen
und Anverwandte mißkannt oder wohl gar die ihm ob-
liegenden geiſtlichen Pflichten und Geſchäfte verabſäumt.“
Anderen geiſtlichen Herren damaliger Zeit war es gleich-
falls verliehen, das genannte Quantum, welches 16 un-
ſerer Bouteillen gleichkommt, binnen 24 Stunden zu be-
wältigen, und ſelbſt Kurfürſten war dies geglückt — ob
ohne Folgen für Verſtand und Gemüth, wie bei dem
redlichen Weihbiſchof, berichtet uns Goethe nicht. Ein
gewaltiger Zecher vor dem Herrn endlich lebte noch vor
Kurzem in einem während der Dreißiger⸗ und Vierziger-
Jahre vielgenannten, jetzt halbvergeſſenen Schriftſteller
zu Leipzig. Der alte Tröbs in der „Rolle“ erzäͤhlte
mir, daß dieſer kleine, corpulente Herr — beiläufig ein
Sohn Oeſterreichs — bei ihm einmal in einem Nieder-
ſitzen 19 Flaſchen weißen Wein und 13 Seidel Bier und
am darauffolgenden Tage 37 Seidel Bier und 14 Flaſchen
Wein zu ſich genommen habe. Ich fand das unglaublich,
aber ein damals ebenfalls vielgenannter Buchhändler
hegte daran keinen Zweifel; denn Jener hatte einſt bei
ihm im Laufe eines Nachmittags 24 Flaſchen Bordeaux
geleert und ſich dann in einer Wirthſchaft noch neun
Glas ſteifen Grog genehmigt. In allen dieſen Fällen.
aber war der Schreckliche zwar wohl nicht ganz nüchtern,
aber, wie glaubwürdigſt bezeugt iſt, feſten Ganges und
ohne Beſchwerden nach Hauſe gewandelt.
Zu allen Zeiten lebten alſo Zecher von wunder-
barem Tonnengehalt, Genies von hoher Capacität im
Vertragen von Spirituoſen, Trinker von faſt übermenſch-
zu gewähren.
Eines dieſer Zimmer hatte der ehemalige Student,
nunmchr Schriftſteller und Gelegenheitsdichter Heller inne,
deſſen Bekanntſchaft wir im Thiergarten gemacht haben.
Heller war bei einer ſehr beſcheidenen Lebensweiſe im
Stande, ſich nothdürftig zu ernähren. Er hatte dem
fremden Herrn, den wir unterdeſſen als den Kammer-
diener Welſens kennen lernten, keine übertriebene Schil-
derung ſeiner beſchränkten Lage gemacht. Der ehemalige
Student ſaß denn auch jetzt wieder, eifrig mit der An-
fertigung eines Trauerliedes beſchäftigt, das für die Be-
erdigung eines Mitgliedes der Nicolai⸗Gemeinde beſtimmt
war, an ſeinem kleinen Tiſche und blickte zuweilen
ſinnend durch das Fenſter, dann begann er wieder zu
ſchreiben.
Nachdem er dieſe Beſchäftigung eine Zeit lang fort-
geſetzt hatte, legte er ſeine Feder nieder, ſtreckte die Beine
von ſich und begrub ſeine Hände in die Taſchen ſeiner
Beinkleider. Er ſtarrte zur Decke empor und unterbrach
dieſe Pauſe in ſeiner Arbeit nur, um mechaniſch eine
ſehr ſchlaff gewordene Börſe zu ergreifen, die ihren Platz
neben dem Tintenfaß des Scribenten hatte. Er ſchwenkte
ſie in der Luft herum, durch welche Bewegung ihm ganz
Har wurde, daß der Inhalt des Beutels nur aus einigen
Kupfermünzen beſtand.
„Es ſind die Letzten,“ murmelte er. „Was ſoll da
werden? Ich habe in der That kein Geld mehr und
obenein umſonſt gearbeitet, denn da liegt das verwünſchte
Gedicht, das die Beſtellerin nicht abholt — ich will aber
des Teufels ſein, wenn ich wieder ein Poem auf Credit
hin mache. Bezahlen müſſen ſie — vorher bezahlen.
Wo finde ich nun die Beſtellerin auf? Die holt es
nicht — ich habe umſonſt mir die Verſe gezimmert und
die Nicolai⸗Gemeinde zahlt ſchlecht —. haͤtte ich dieſes
Gedicht da bezahlt erhalten — es ginge wieder eine
Woche lang — aber ſo — —“ Der Student erhob
ſich und ging zum Fenſter, blickte in den trüben Fluß
und ſeufzte. Aber wie es ſo oft geſchieht, daß im ſchlech-
ten Moment eine kleine Beſſerung näher tritt, ſo auch
hier. Es ward an die Thür gepocht und auf des Stu-
denten Ruf: „Herein!“ erſchien ein allerliebſtes Mädchen
in's Zimmer. Sie trug kurze ſeidene Kleider, auf dem
Haupte eine kleine Mütze mit getollten Streifen, um ihre
Schultern einen ſchwarzen kurzen Mantel.
„Ah!“ rief der Student erfreut.
wohl, mein Fräulein — —“
„Um das verſprochene Hochzeitsgedicht zu holen,“
ergänzte die junge Dame. „Es iſt doch fertig?“
„Fertig und hier!“ ſagte Heller, ein zuſammen-
gefalztes Papier vom Tiſche nehmend, welches er dem
Mädchen reichte und dabei leuchtende Blicke auf die
kleine lederne Taſche warf, die die Beſtellerin des Poems
an der Seite trug. „Ich hoffe — es wird Ihren Bei-
fall haben.“ ö
Die hübſche junge Perſon hatte das Gedicht ge-
nommen und begann eifrig zu leſen. „Sehr nett — ſehr
gut getroffen,“ ſagte ſie. „Ich bin vollkommen zufrie-
den.“ Sie ſchob das Blatt in ihre Gürteltaſche, dann
fuhr ihre kleine Hand wieder in die Tiefe und holte
einiges Geld hervor. „Zwei Thaler — das war der
Preis?“ ſagte ſie.
„Ja, mein Fräulein.“
Die Beſtellerin blickte ſchnell in dem faſt ärmlichen
„Sie kommen
Gemache umher, dann ſagte ſie: „Nun — die Arbeit
iſt gut — ich erlaube mir noch einen halben Thaler zu-
zugeben.“
„Ach, Sie ſind zu gütig,“ lispelte der Student.
78 —
„Sie erweiſen mir eine Ehre, indem ſie mein Poem alſo
anerkennen.“
„Bitte, bitte mein Herr,“ lächelte die Kleine. „Neh-
men Sie es nur an. Es iſt ein gutes Gedicht und ich
hoffe, wir werden uns öfter gegenſeitig dienen, denn ich
werde Sie angelegentlich empfehlen. Adieu, mein Herr,
haben Sie Dank für ihre Pänktlichkeit.“ Nach dieſen
Worten knixte ſie und ſchwebte zur Thüre hinans, den
Dichter bei der Betrachtung des erworbenen Geldes
allein laſſend.
„Da wären wieder ein paar Stücke im Beutel,“
ſagte er ſchmunzelnd. „Ja, wenn es nur einmal acht
Tage lang hinter einander ſo gehen wollte.“
(Fortſetzung folgt.)
Deutſcher Durſt.
Zu allen Zeiten der Welt hat es mächtige Trinker
gegeben, Leute, die ſchwer oder gar nicht zu berauſchen
waren und mit ihrer Fähigkeit im Vertilgen geiſtiger
Getränke die auf dieſem Gebiete weniger begabte Mit-
welt in Staunen ſetzten. Wir leſen von Sokrates, daß
er eine ganze Nacht hindurch Wein trinken und am Mor-
gen mit derſelben Klarheit fortdisputiren konnte, mit der
er am Abend begonnen. Cäſar war als Zecher faſt ſo
groß, wie als Feldherr und Staatsmann. Tiberius be-
förderte einen ſonſt nicht hervorragenden Mann zum
Quäſtor, weil er auf ſein Zutrinken in wenigen Stun-
den eine Amphora, d. h. ungefähr 24 unſerer Wein-
flaſchen, geleert hatte. Auch unſere Tage laſſen bis-
weilen noch Menſchen von ſehr ausgebildeter Genußfähig-
keit vor dem Becher erſtehen. Ein Weihbiſchof, deſſen
Goethe in ſeiner Beſchreibung des Rochusfeſtes zu Bingen
gedenkt, konnte ſich in einer Faſtenpredigt rühmen, daß
ihn der „grundgütige Gott der beſonderen Gnade ge-
würdigt, acht Maaß trinken zu dürfen, ohne ſich nach-
ſagen laſſen zu müſſen, daß er darüber in ungerechtem
Zorne auf irgend Jemanden losgefahren, Hausgenoſſen
und Anverwandte mißkannt oder wohl gar die ihm ob-
liegenden geiſtlichen Pflichten und Geſchäfte verabſäumt.“
Anderen geiſtlichen Herren damaliger Zeit war es gleich-
falls verliehen, das genannte Quantum, welches 16 un-
ſerer Bouteillen gleichkommt, binnen 24 Stunden zu be-
wältigen, und ſelbſt Kurfürſten war dies geglückt — ob
ohne Folgen für Verſtand und Gemüth, wie bei dem
redlichen Weihbiſchof, berichtet uns Goethe nicht. Ein
gewaltiger Zecher vor dem Herrn endlich lebte noch vor
Kurzem in einem während der Dreißiger⸗ und Vierziger-
Jahre vielgenannten, jetzt halbvergeſſenen Schriftſteller
zu Leipzig. Der alte Tröbs in der „Rolle“ erzäͤhlte
mir, daß dieſer kleine, corpulente Herr — beiläufig ein
Sohn Oeſterreichs — bei ihm einmal in einem Nieder-
ſitzen 19 Flaſchen weißen Wein und 13 Seidel Bier und
am darauffolgenden Tage 37 Seidel Bier und 14 Flaſchen
Wein zu ſich genommen habe. Ich fand das unglaublich,
aber ein damals ebenfalls vielgenannter Buchhändler
hegte daran keinen Zweifel; denn Jener hatte einſt bei
ihm im Laufe eines Nachmittags 24 Flaſchen Bordeaux
geleert und ſich dann in einer Wirthſchaft noch neun
Glas ſteifen Grog genehmigt. In allen dieſen Fällen.
aber war der Schreckliche zwar wohl nicht ganz nüchtern,
aber, wie glaubwürdigſt bezeugt iſt, feſten Ganges und
ohne Beſchwerden nach Hauſe gewandelt.
Zu allen Zeiten lebten alſo Zecher von wunder-
barem Tonnengehalt, Genies von hoher Capacität im
Vertragen von Spirituoſen, Trinker von faſt übermenſch-