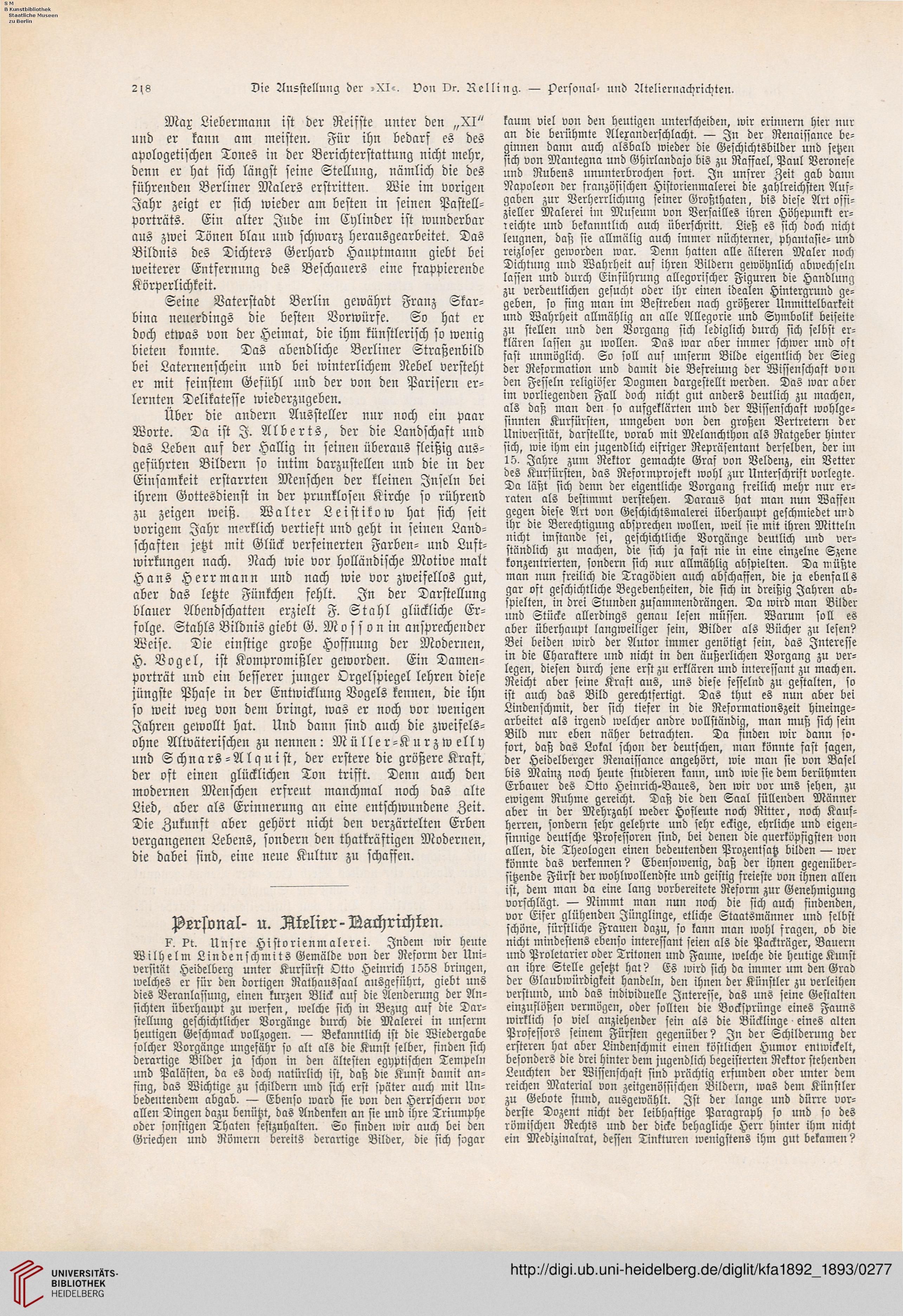2^8
Die Ausstellung der ,XI-. Don vr. Relliug. — Personal- und Atelicrnacbricbtcn.
Max Liebermann ist der Reifste unter den „XI"
und er kann am meisten. Für ihn bedarf es des
apologetischen Tones in der Berichterstattung nicht mehr,
denn er hat sich längst seine Stellung, nämlich die des
führenden Berliner Malers erstritten. Wie im vorigen
Jahr zeigt er sich wieder am besten in seinen Pastell-
porträts. Ein alter Jude im Cylinder ist wunderbar
aus zwei Tönen blau und schwarz herausgearbeitet. Das
Bildnis des Dichters Gerhard Hauptmann giebt bei
weiterer Entfernung des Beschauers eine frappierende
Körperlichkeit.
Seine Vaterstadt Berlin gewährt Franz Skar-
bina neuerdings die besten Vorwürfe. So hat er
doch etwas von der Heimat, die ihm künstlerisch so wenig
bieten konnte. Das abendliche Berliner Straßenbild
bei Laternenschein und bei winterlichem Nebel versteht
er mit feinstem Gefühl und der von den Parisern er-
lernten Delikatesse wiederzugeben.
Über die andern Aussteller nur noch ein Paar-
Worte. Da ist I. Alberts, der die Landschaft und
das Leben auf der Hallig in seinen überaus fleißig aus-
geführten Bildern so intim darzustellen und die in der
Einsamkeit erstarrten Menschen der kleinen Inseln bei
ihrem Gottesdienst in der prunklosen Kirche so rührend
zu zeigen weiß. Walter Leistikow hat sich seit
vorigem Jahr merklich vertieft und geht in seinen Land-
schaften jetzt mit Glück verfeinerten Farben- und Luft-
wirkungen nach. Nach wie vor holländische Motive malt
Hans Herr mann und nach wie vor zweifellos gut,
aber das letzte Fünkchen fehlt. In der Darstellung
blauer Abendschatten erzielt F. Stahl glückliche Er-
folge. Stahls Bildnis giebt G. Mossonin ansprechender
Weise. Die einstige große Hoffnung der Modernen,
H. Vogel, ist Kompromißler geworden. Ein Damen-
porträt und ein besserer junger Orgelspiegel lehren diese
jüngste Phase in der Entwicklung Vogels kennen, die ihn
so weit weg von dem bringt, was er noch vor wenigen
Jahren gewollt hat. Und dann sind auch die zweifels-
ohne Altväterischen zu nennen: Müller-Kurzw elly
und Schnars-Alquist, der erstere die größere Kraft,
der oft einen glücklichen Ton trifft. Denn auch den
modernen Menschen erfreut manchmal noch das alte
Lied, aber als Erinnerung an eine entschwundene Zeit.
Die Zukunft aber gehört nicht den verzärtelten Erben
vergangenen Lebens, sondern den thatkräftigen Modernen,
die dabei sind, eine neue Kultur zu schaffen.
Personal- u. Melier-Nachrichten.
r. kt. Unsre Historienmalerei. Indem wir heute
Wilhelm Lindenschmits Gemälde von der Reform der Uni-
versität Heidelberg unter Kurfürst Otto Heinrich 1558 bringen,
welches er für den dortigen Rathaussaal ausgeführt, giebt uns
dies Veranlassung, einen kurzen Blick auf die Aenderung der An-
sichten überhaupt zu werfen, welche sich in Bezug auf die Dar-
stellung geschichtlicher Vorgänge durch die Malerei in unserm
heutigen Geschmack vollzogen. — Bekanntlich ist die Wiedergabe
solcher Vorgänge ungefähr so alt als die Kunst selber, finden sich
derartige Bilder ja schon in den ältesten egyptischen Tempeln
und Palästen, da es doch natürlich ist, daß die Kunst damit an-
sing, das Wichtige zu schildern und sich erst später auch mit Un-
bedeutendem abgab. — Ebenso ward sie von den Herrschern vor
allen Dingen dazu benützt, das Andenken an sie und ihre Triumphe
oder sonstigen Thaten festzuhallen. So finden wir auch bei den
Griechen und Römern bereits derartige Bilder, die sich sogar
kaum viel von den heutigen unterscheiden, wir eriiinern hier nur
an die berühmte Alexanderschlacht. — In der Renaissance be-
ginnen dann auch alsbald wieder die Geschichtsbilder und setzen
sich von Mantegna und Ghirlandajo bis zu Raffael, Paul Veronese
und Rubens ununterbrochen fort. In unsrer Zeit gab dann
Napoleon der französischen Historienmalerei die zahlreichsten Auf-
gaben zur Verherrlichung seiner Großthaten, bis diese Art offi-
zieller Malerei im Museum von Versailles ihren Höhepunkt er-
reichte und bekanntlich auch überschritt. Ließ es sich doch nicht
leugnen, daß sie allmälig auch immer nüchterner, Phantasie- und
reizloser geworden war. Denn hatten alle älteren Maler noch
Dichtung und Wahrheit auf ihren Bildern gewöhnlich abwechseln
lassen und durch Einführung allegorischer Figuren die Handlung
zu verdeutlichen gesucht oder ihr einen idealen Hintergrund ge-
geben, so fing man im Bestreben nach größerer Unmittelbarkeit
und Wahrheit allmählig an alle Allegorie und Symbolik beiseite
zu stellen und den Vorgang sich lediglich durch sich selbst er-
klären lassen zu wollen. Das war aber immer schwer und oft
fast unmöglich. So soll auf unserm Bilde eigenllich der Sieg
der Reformation und damit die Befreiung der Wissenschaft von
den Fesseln religiöser Dogmen dargestellt werden. Das war aber
im vorliegenden Fall doch nicht gut anders deutlich zu machen,
als daß man den so aufgeklärten und der Wissenschaft wohlge-
sinnten Kurfürsten, umgeben von den großen Vertretern der
Universität, darstellte, vorab mit Melanchthon als Ratgeber hinter
sich, wie ihm ein jugendlich eifriger Repräsentant derselben, der im
15. Jahre zum Rektor gemachte Graf von Veldenz, ein Vetter
des Kurfürsten, das Reformprojekt wohl zur Unterschrift vorlegte.
Da läßt sich denn der eigentliche Vorgang freilich mehr nur er-
raten als bestimmt verstehen. Daraus hat man nun Waffen
gegen diese Art von Geschichtsmalerei überhaupt geschmiedet und
ihr die Berechtigung absprechen wollen, weil sie mit ihren Mitteln
nicht imstande sei, geschichtliche Vorgänge deutlich und ver-
ständlich zu machen, die sich ja säst nie in eine einzelne Szene
konzentrierten, sondern sich nur allmählig abspielten. Da müßte
man nun freilich die Tragödien auch abschaffen, die ja ebenfalls
gar oft geschichtliche Begebenheiten, die sich in dreißig Jahren ab-
spielten, in drei Stunden zusammendrängen. Da wird man Bilder
und Stücke allerdings genau lesen müssen. Warum soll es
aber überhaupt langweiliger sein, Bilder als Bücher zu lesen?
Bei beiden wird der Autor immer genötigt sein, das Interesse
in die Charaktere und nicht in den äußerlichen Vorgang zu ver-
legen, diesen durch jene erst zu erklären und interessant zu machen.
Reicht aber seine Kraft aus, uns diese fesselnd zu gestalten, so
ist auch das Bild gerechtfertigt. Das thut es nun aber bei
Lindenschmit, der sich tiefer in die Resormationszeit hineinge-
arbeitet als irgend welcher andre vollständig, man muß sich sein
Bild nur eben näher betrachten. Da finden wir dann so-
fort, daß das Lokal schon der deutschen, man könnte fast sagen,
der Heidelberger Renaissance angehört, wie man sie von Basel
bis Mainz noch heute studieren kann, und wie sie dem berühmten
Erbauer des Otto Heinrich-Baues, den wir vor uns sehen, zu
ewigem Ruhme gereicht. Daß die den Saal füllenden Männer
aber in der Mehrzahl weder Hofleute noch Ritter, noch Kauf-
herren, sondern sehr gelehrte und sehr eckige, ehrliche und eigen-
sinnige deutsche Professoren sind, bei denen die querköpfigsten von
allen, die Theologen einen bedeutenden Prozentsatz bilden — wer
könnte das verkennen? Ebensowenig, daß der ihnen gegenüber-
sitzende Fürst der wohlwollendste und geistig freieste von ihnen allen
ist, dem man da eine lang vorbereitete Reform zur Genehmigung
vorschlägt. — Nimmt man nun noch die sich auch findenden,
vor Eifer glühenden Jünglinge, etliche Staatsmänner und selbst
schöne, fürstliche Frauen dazu, so kann man wohl fragen, ob die
nicht mindestens ebenso interessant seien als die Packträger, Bauern
und Proletarier oder Tritonen und Faune, welche die heutige Kunst
an ihre Stelle gesetzt hat? Es wird sich da immer um den Grad
der Glaubwürdigkeit handeln, den ihnen der Künstler zu verleihen
verstund, und das individuelle Interesse, das uns seine Gestalten
einzuflößen vermögen, oder sollten die Bocksprünge eines Fauns
wirklich so viel anziehender sein als die Bücklinge eines alten
Professors seinem Fürsten gegenüber? In der Schilderung der
ersteren hat aber Lindenschmit einen köstlichen Humor entwickelt,
besonders die drei hinter dem jugendlich begeisterten Rektor stehenden
Leuchten der Wissenschaft sind prächtig erfunden oder unter dem
reichen Material von zeitgenössischen Bildern, was dem Künstler
zu Gebote stund, ausgewählt. Ist der lange und dürre vor-
derste Dozent nicht der leibhaftige Paragraph so und so des
römischen Rechts und der dicke behagliche Herr hinter ihm nicht
ein Medizinalrat, dessen Tinkturen wenigstens ihm gut bekamen?
Die Ausstellung der ,XI-. Don vr. Relliug. — Personal- und Atelicrnacbricbtcn.
Max Liebermann ist der Reifste unter den „XI"
und er kann am meisten. Für ihn bedarf es des
apologetischen Tones in der Berichterstattung nicht mehr,
denn er hat sich längst seine Stellung, nämlich die des
führenden Berliner Malers erstritten. Wie im vorigen
Jahr zeigt er sich wieder am besten in seinen Pastell-
porträts. Ein alter Jude im Cylinder ist wunderbar
aus zwei Tönen blau und schwarz herausgearbeitet. Das
Bildnis des Dichters Gerhard Hauptmann giebt bei
weiterer Entfernung des Beschauers eine frappierende
Körperlichkeit.
Seine Vaterstadt Berlin gewährt Franz Skar-
bina neuerdings die besten Vorwürfe. So hat er
doch etwas von der Heimat, die ihm künstlerisch so wenig
bieten konnte. Das abendliche Berliner Straßenbild
bei Laternenschein und bei winterlichem Nebel versteht
er mit feinstem Gefühl und der von den Parisern er-
lernten Delikatesse wiederzugeben.
Über die andern Aussteller nur noch ein Paar-
Worte. Da ist I. Alberts, der die Landschaft und
das Leben auf der Hallig in seinen überaus fleißig aus-
geführten Bildern so intim darzustellen und die in der
Einsamkeit erstarrten Menschen der kleinen Inseln bei
ihrem Gottesdienst in der prunklosen Kirche so rührend
zu zeigen weiß. Walter Leistikow hat sich seit
vorigem Jahr merklich vertieft und geht in seinen Land-
schaften jetzt mit Glück verfeinerten Farben- und Luft-
wirkungen nach. Nach wie vor holländische Motive malt
Hans Herr mann und nach wie vor zweifellos gut,
aber das letzte Fünkchen fehlt. In der Darstellung
blauer Abendschatten erzielt F. Stahl glückliche Er-
folge. Stahls Bildnis giebt G. Mossonin ansprechender
Weise. Die einstige große Hoffnung der Modernen,
H. Vogel, ist Kompromißler geworden. Ein Damen-
porträt und ein besserer junger Orgelspiegel lehren diese
jüngste Phase in der Entwicklung Vogels kennen, die ihn
so weit weg von dem bringt, was er noch vor wenigen
Jahren gewollt hat. Und dann sind auch die zweifels-
ohne Altväterischen zu nennen: Müller-Kurzw elly
und Schnars-Alquist, der erstere die größere Kraft,
der oft einen glücklichen Ton trifft. Denn auch den
modernen Menschen erfreut manchmal noch das alte
Lied, aber als Erinnerung an eine entschwundene Zeit.
Die Zukunft aber gehört nicht den verzärtelten Erben
vergangenen Lebens, sondern den thatkräftigen Modernen,
die dabei sind, eine neue Kultur zu schaffen.
Personal- u. Melier-Nachrichten.
r. kt. Unsre Historienmalerei. Indem wir heute
Wilhelm Lindenschmits Gemälde von der Reform der Uni-
versität Heidelberg unter Kurfürst Otto Heinrich 1558 bringen,
welches er für den dortigen Rathaussaal ausgeführt, giebt uns
dies Veranlassung, einen kurzen Blick auf die Aenderung der An-
sichten überhaupt zu werfen, welche sich in Bezug auf die Dar-
stellung geschichtlicher Vorgänge durch die Malerei in unserm
heutigen Geschmack vollzogen. — Bekanntlich ist die Wiedergabe
solcher Vorgänge ungefähr so alt als die Kunst selber, finden sich
derartige Bilder ja schon in den ältesten egyptischen Tempeln
und Palästen, da es doch natürlich ist, daß die Kunst damit an-
sing, das Wichtige zu schildern und sich erst später auch mit Un-
bedeutendem abgab. — Ebenso ward sie von den Herrschern vor
allen Dingen dazu benützt, das Andenken an sie und ihre Triumphe
oder sonstigen Thaten festzuhallen. So finden wir auch bei den
Griechen und Römern bereits derartige Bilder, die sich sogar
kaum viel von den heutigen unterscheiden, wir eriiinern hier nur
an die berühmte Alexanderschlacht. — In der Renaissance be-
ginnen dann auch alsbald wieder die Geschichtsbilder und setzen
sich von Mantegna und Ghirlandajo bis zu Raffael, Paul Veronese
und Rubens ununterbrochen fort. In unsrer Zeit gab dann
Napoleon der französischen Historienmalerei die zahlreichsten Auf-
gaben zur Verherrlichung seiner Großthaten, bis diese Art offi-
zieller Malerei im Museum von Versailles ihren Höhepunkt er-
reichte und bekanntlich auch überschritt. Ließ es sich doch nicht
leugnen, daß sie allmälig auch immer nüchterner, Phantasie- und
reizloser geworden war. Denn hatten alle älteren Maler noch
Dichtung und Wahrheit auf ihren Bildern gewöhnlich abwechseln
lassen und durch Einführung allegorischer Figuren die Handlung
zu verdeutlichen gesucht oder ihr einen idealen Hintergrund ge-
geben, so fing man im Bestreben nach größerer Unmittelbarkeit
und Wahrheit allmählig an alle Allegorie und Symbolik beiseite
zu stellen und den Vorgang sich lediglich durch sich selbst er-
klären lassen zu wollen. Das war aber immer schwer und oft
fast unmöglich. So soll auf unserm Bilde eigenllich der Sieg
der Reformation und damit die Befreiung der Wissenschaft von
den Fesseln religiöser Dogmen dargestellt werden. Das war aber
im vorliegenden Fall doch nicht gut anders deutlich zu machen,
als daß man den so aufgeklärten und der Wissenschaft wohlge-
sinnten Kurfürsten, umgeben von den großen Vertretern der
Universität, darstellte, vorab mit Melanchthon als Ratgeber hinter
sich, wie ihm ein jugendlich eifriger Repräsentant derselben, der im
15. Jahre zum Rektor gemachte Graf von Veldenz, ein Vetter
des Kurfürsten, das Reformprojekt wohl zur Unterschrift vorlegte.
Da läßt sich denn der eigentliche Vorgang freilich mehr nur er-
raten als bestimmt verstehen. Daraus hat man nun Waffen
gegen diese Art von Geschichtsmalerei überhaupt geschmiedet und
ihr die Berechtigung absprechen wollen, weil sie mit ihren Mitteln
nicht imstande sei, geschichtliche Vorgänge deutlich und ver-
ständlich zu machen, die sich ja säst nie in eine einzelne Szene
konzentrierten, sondern sich nur allmählig abspielten. Da müßte
man nun freilich die Tragödien auch abschaffen, die ja ebenfalls
gar oft geschichtliche Begebenheiten, die sich in dreißig Jahren ab-
spielten, in drei Stunden zusammendrängen. Da wird man Bilder
und Stücke allerdings genau lesen müssen. Warum soll es
aber überhaupt langweiliger sein, Bilder als Bücher zu lesen?
Bei beiden wird der Autor immer genötigt sein, das Interesse
in die Charaktere und nicht in den äußerlichen Vorgang zu ver-
legen, diesen durch jene erst zu erklären und interessant zu machen.
Reicht aber seine Kraft aus, uns diese fesselnd zu gestalten, so
ist auch das Bild gerechtfertigt. Das thut es nun aber bei
Lindenschmit, der sich tiefer in die Resormationszeit hineinge-
arbeitet als irgend welcher andre vollständig, man muß sich sein
Bild nur eben näher betrachten. Da finden wir dann so-
fort, daß das Lokal schon der deutschen, man könnte fast sagen,
der Heidelberger Renaissance angehört, wie man sie von Basel
bis Mainz noch heute studieren kann, und wie sie dem berühmten
Erbauer des Otto Heinrich-Baues, den wir vor uns sehen, zu
ewigem Ruhme gereicht. Daß die den Saal füllenden Männer
aber in der Mehrzahl weder Hofleute noch Ritter, noch Kauf-
herren, sondern sehr gelehrte und sehr eckige, ehrliche und eigen-
sinnige deutsche Professoren sind, bei denen die querköpfigsten von
allen, die Theologen einen bedeutenden Prozentsatz bilden — wer
könnte das verkennen? Ebensowenig, daß der ihnen gegenüber-
sitzende Fürst der wohlwollendste und geistig freieste von ihnen allen
ist, dem man da eine lang vorbereitete Reform zur Genehmigung
vorschlägt. — Nimmt man nun noch die sich auch findenden,
vor Eifer glühenden Jünglinge, etliche Staatsmänner und selbst
schöne, fürstliche Frauen dazu, so kann man wohl fragen, ob die
nicht mindestens ebenso interessant seien als die Packträger, Bauern
und Proletarier oder Tritonen und Faune, welche die heutige Kunst
an ihre Stelle gesetzt hat? Es wird sich da immer um den Grad
der Glaubwürdigkeit handeln, den ihnen der Künstler zu verleihen
verstund, und das individuelle Interesse, das uns seine Gestalten
einzuflößen vermögen, oder sollten die Bocksprünge eines Fauns
wirklich so viel anziehender sein als die Bücklinge eines alten
Professors seinem Fürsten gegenüber? In der Schilderung der
ersteren hat aber Lindenschmit einen köstlichen Humor entwickelt,
besonders die drei hinter dem jugendlich begeisterten Rektor stehenden
Leuchten der Wissenschaft sind prächtig erfunden oder unter dem
reichen Material von zeitgenössischen Bildern, was dem Künstler
zu Gebote stund, ausgewählt. Ist der lange und dürre vor-
derste Dozent nicht der leibhaftige Paragraph so und so des
römischen Rechts und der dicke behagliche Herr hinter ihm nicht
ein Medizinalrat, dessen Tinkturen wenigstens ihm gut bekamen?