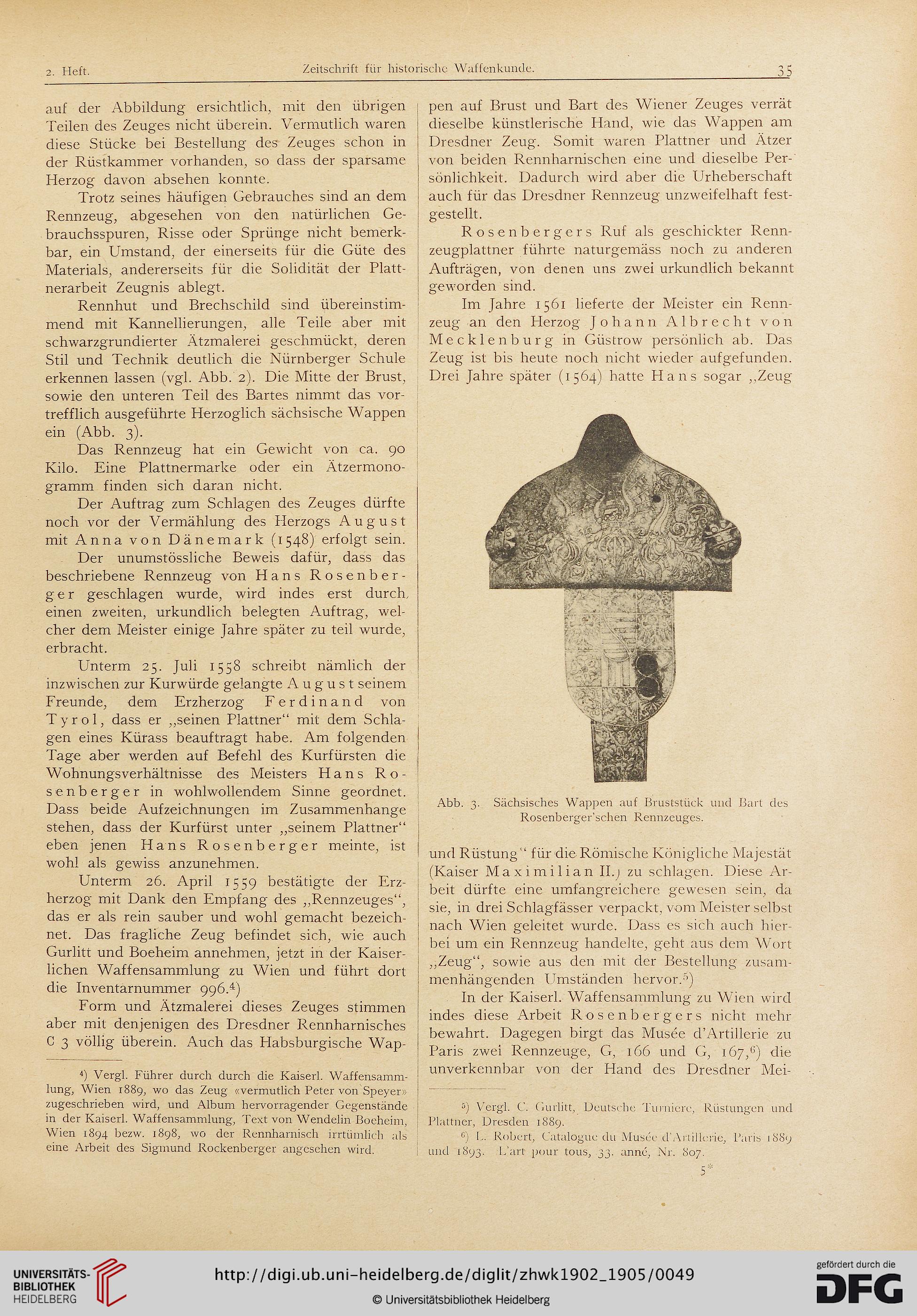2. Heft.
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
35
auf der Abbildung ersichtlich, mit den übrigen
Teilen des Zeuges nicht überein. Vermutlich waren
diese Stücke bei Bestellung des Zeuges schon in
der Rüstkammer vorhanden, so dass der sparsame
Herzog davon absehen konnte.
Trotz seines häufigen Gebrauches sind an dem
Rennzeug, abgesehen von den natürlichen Ge-
brauchsspuren, Risse oder Sprünge nicht bemerk-
bar, ein Umstand, der einerseits für die Güte des
Materials, andererseits für die Solidität der Platt-
nerarbeit Zeugnis ablegt.
Rennhut und Brechschild sind übereinstim-
mend mit Kannellierungen, alle Teile aber mit
schwarzgrundierter Ätzmalerei geschmückt, deren
Stil und Technik deutlich die Nürnberger Schule
erkennen lassen (vgl. Abb. 2). Die Mitte der Brust,
sowie den unteren Teil des Bartes nimmt das vor-
trefflich ausgeführte Herzoglich sächsische Wappen
ein (Abb. 3).
Das Rennzeug hat ein Gewicht von ca. 90
Kilo. Eine Plattnermarke oder ein Ätzermono-
gramm finden sich daran nicht.
Der Auftrag zum Schlagen des Zeuges dürfte
noch vor der Vermählung des Herzogs August
mit Anna von Dänemark (1548) erfolgt sein.
Der unumstössliche Beweis dafür, dass das
beschriebene Rennzeug von Hans Rosenber-
ger geschlagen wurde, wird indes erst durch
einen zweiten, urkundlich belegten Auftrag, wel-
cher dem Meister einige Jahre später zu teil wurde,
erbracht.
Unterm 25. Juli 1558 schreibt nämlich der
inzwischen zur Kurwürde gelangte August seinem
Freunde, dem Erzherzog Ferdinand von
Tyrol, dass er „seinen Plattner“ mit dem Schla-
gen eines Kürass beauftragt habe. Am folgenden
Tage aber werden auf Befehl des Kurfürsten die
Wohnungsverhältnisse des Meisters Hans Ro-
senberger in wohlwollendem Sinne geordnet.
Dass beide Aufzeichnungen im Zusammenhänge
stehen, dass der Kurfürst unter „seinem Plattner“
eben jenen Hans Rosenberger meinte, ist
wohl als gewiss anzunehmen.
Unterm 26. April 1559 bestätigte der Erz-
herzog mit Dank den Empfang des ,,Rennzeuges“,
das er als rein sauber und wohl gemacht bezeich-
net. Das fragliche Zeug befindet sich, wie auch
Gurlitt und Boeheim annehmen, jetzt in der Kaiser-
lichen Waffensammlung zu Wien und führt dort
die Inventarnummer 996.4)
Form und Ätzmalerei dieses Zeuges stimmen
aber mit denjenigen des Dresdner Rennharnisches
C 3 völlig überein. Auch das Habsburgische Wap-
4) Vergl. Führer durch durch die Kaiserl. Waffensamm-
lung, Wien 1889, wo das Zeug «vermutlich Peter von Speyer»
zugeschrieben wird, und Album hervorragender Gegenstände
in der Kaiserl. Waffensammlung, Text von Wendelin Boeheim,
Wien 1894 bezw. 1898, wo der Rennharnisch irrtümlich als
eine Arbeit des Sigmund Rockenberger angesehen wird.
pen auf Brust und Bart des Wiener Zeuges verrät
dieselbe künstlerische Hand, wie das Wappen am
Dresdner Zeug. Somit waren Plattner und Ätzer
von beiden Rennharnischen eine und dieselbe Per-
sönlichkeit. Dadurch wird aber die Urheberschaft
auch für das Dresdner Rennzeug unzweifelhaft fest-
gestellt.
Rosenbergers Ruf als geschickter Renn-
zeugplattner führte naturgemäss noch zu anderen
Aufträgen, von denen uns zwei urkundlich bekannt
geworden sind.
Im Jahre 1561 lieferte der Meister ein Renn-
zeug an den Herzog Johann Albrecht von
Mecklenburg in Güstrow persönlich ab. Das
Zeug ist bis heute noch nicht wieder aufgefunden.
Drei Jahre später (1564) batte Hans sogar „Zeug
Abb. 3. Sächsisches Wappen auf Bruststück und Bart des
Rosenberger’schen Rennzeuges.
und Rüstung“ für die Römische Königliche Majestät
(Kaiser Maximilian 11.) zu schlagen. Diese Ar-
beit dürfte eine umfangreichere gewesen sein, da
sie, in drei Schlagfässer verpackt, vom Meister selbst
nach Wien geleitet wurde. Dass es sich auch hier-
bei um ein Rennzeug handelte, geht aus dem Wort
„Zeug“, sowie aus den mit der Bestellung zusam-
menhängenden Umständen hervor.5)
In der Kaiserl. Waffensammlung zu Wien wird
indes diese Arbeit Rosenbergers nicht mehr
bewahrt. Dagegen birgt das Musee d’Artillcrie zu
Paris zwei Rennzeuge, G, 166 und G, 167,6) die
unverkennbar von der Hand des Dresdner Mei-
5) Vergl. C. Gurlitt, Deutsche Turniere, Rüstungen und
Plattner, Dresden 1889.
c) L. Robert, Catalogue du Musee d’Arlillerie, Paris 1889
und 1893. h art pour tous, 33. annc, Nr. 807.
5*
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
35
auf der Abbildung ersichtlich, mit den übrigen
Teilen des Zeuges nicht überein. Vermutlich waren
diese Stücke bei Bestellung des Zeuges schon in
der Rüstkammer vorhanden, so dass der sparsame
Herzog davon absehen konnte.
Trotz seines häufigen Gebrauches sind an dem
Rennzeug, abgesehen von den natürlichen Ge-
brauchsspuren, Risse oder Sprünge nicht bemerk-
bar, ein Umstand, der einerseits für die Güte des
Materials, andererseits für die Solidität der Platt-
nerarbeit Zeugnis ablegt.
Rennhut und Brechschild sind übereinstim-
mend mit Kannellierungen, alle Teile aber mit
schwarzgrundierter Ätzmalerei geschmückt, deren
Stil und Technik deutlich die Nürnberger Schule
erkennen lassen (vgl. Abb. 2). Die Mitte der Brust,
sowie den unteren Teil des Bartes nimmt das vor-
trefflich ausgeführte Herzoglich sächsische Wappen
ein (Abb. 3).
Das Rennzeug hat ein Gewicht von ca. 90
Kilo. Eine Plattnermarke oder ein Ätzermono-
gramm finden sich daran nicht.
Der Auftrag zum Schlagen des Zeuges dürfte
noch vor der Vermählung des Herzogs August
mit Anna von Dänemark (1548) erfolgt sein.
Der unumstössliche Beweis dafür, dass das
beschriebene Rennzeug von Hans Rosenber-
ger geschlagen wurde, wird indes erst durch
einen zweiten, urkundlich belegten Auftrag, wel-
cher dem Meister einige Jahre später zu teil wurde,
erbracht.
Unterm 25. Juli 1558 schreibt nämlich der
inzwischen zur Kurwürde gelangte August seinem
Freunde, dem Erzherzog Ferdinand von
Tyrol, dass er „seinen Plattner“ mit dem Schla-
gen eines Kürass beauftragt habe. Am folgenden
Tage aber werden auf Befehl des Kurfürsten die
Wohnungsverhältnisse des Meisters Hans Ro-
senberger in wohlwollendem Sinne geordnet.
Dass beide Aufzeichnungen im Zusammenhänge
stehen, dass der Kurfürst unter „seinem Plattner“
eben jenen Hans Rosenberger meinte, ist
wohl als gewiss anzunehmen.
Unterm 26. April 1559 bestätigte der Erz-
herzog mit Dank den Empfang des ,,Rennzeuges“,
das er als rein sauber und wohl gemacht bezeich-
net. Das fragliche Zeug befindet sich, wie auch
Gurlitt und Boeheim annehmen, jetzt in der Kaiser-
lichen Waffensammlung zu Wien und führt dort
die Inventarnummer 996.4)
Form und Ätzmalerei dieses Zeuges stimmen
aber mit denjenigen des Dresdner Rennharnisches
C 3 völlig überein. Auch das Habsburgische Wap-
4) Vergl. Führer durch durch die Kaiserl. Waffensamm-
lung, Wien 1889, wo das Zeug «vermutlich Peter von Speyer»
zugeschrieben wird, und Album hervorragender Gegenstände
in der Kaiserl. Waffensammlung, Text von Wendelin Boeheim,
Wien 1894 bezw. 1898, wo der Rennharnisch irrtümlich als
eine Arbeit des Sigmund Rockenberger angesehen wird.
pen auf Brust und Bart des Wiener Zeuges verrät
dieselbe künstlerische Hand, wie das Wappen am
Dresdner Zeug. Somit waren Plattner und Ätzer
von beiden Rennharnischen eine und dieselbe Per-
sönlichkeit. Dadurch wird aber die Urheberschaft
auch für das Dresdner Rennzeug unzweifelhaft fest-
gestellt.
Rosenbergers Ruf als geschickter Renn-
zeugplattner führte naturgemäss noch zu anderen
Aufträgen, von denen uns zwei urkundlich bekannt
geworden sind.
Im Jahre 1561 lieferte der Meister ein Renn-
zeug an den Herzog Johann Albrecht von
Mecklenburg in Güstrow persönlich ab. Das
Zeug ist bis heute noch nicht wieder aufgefunden.
Drei Jahre später (1564) batte Hans sogar „Zeug
Abb. 3. Sächsisches Wappen auf Bruststück und Bart des
Rosenberger’schen Rennzeuges.
und Rüstung“ für die Römische Königliche Majestät
(Kaiser Maximilian 11.) zu schlagen. Diese Ar-
beit dürfte eine umfangreichere gewesen sein, da
sie, in drei Schlagfässer verpackt, vom Meister selbst
nach Wien geleitet wurde. Dass es sich auch hier-
bei um ein Rennzeug handelte, geht aus dem Wort
„Zeug“, sowie aus den mit der Bestellung zusam-
menhängenden Umständen hervor.5)
In der Kaiserl. Waffensammlung zu Wien wird
indes diese Arbeit Rosenbergers nicht mehr
bewahrt. Dagegen birgt das Musee d’Artillcrie zu
Paris zwei Rennzeuge, G, 166 und G, 167,6) die
unverkennbar von der Hand des Dresdner Mei-
5) Vergl. C. Gurlitt, Deutsche Turniere, Rüstungen und
Plattner, Dresden 1889.
c) L. Robert, Catalogue du Musee d’Arlillerie, Paris 1889
und 1893. h art pour tous, 33. annc, Nr. 807.
5*