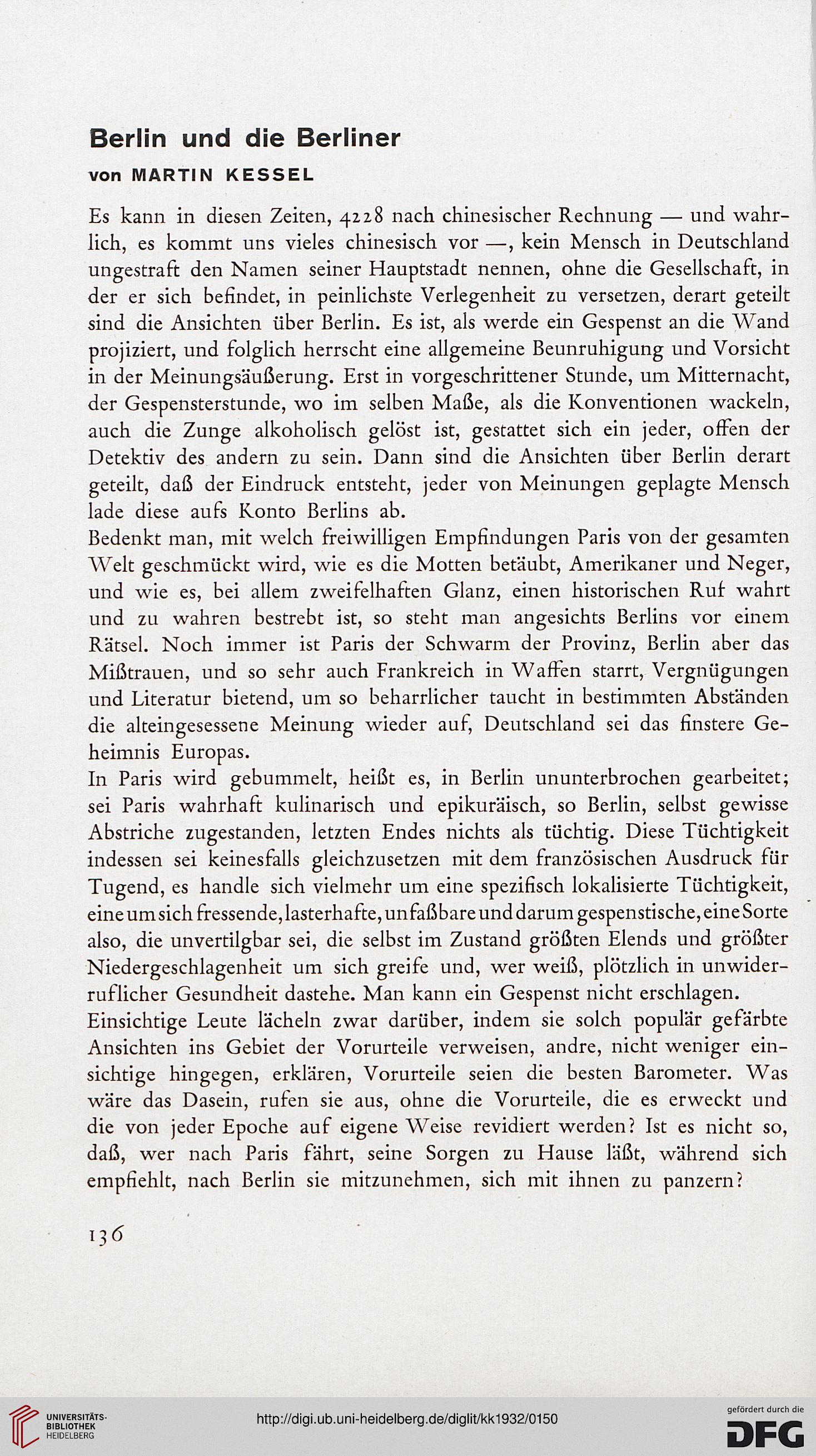Berlin und die Berliner
von MARTIN KESSEL
Es kann in diesen Zeiten, 4128 nach chinesischer Rechnung — und wahr-
lich, es kommt uns vieles chinesisch vor —, kein Mensch in Deutschland
ungestraft den Namen seiner Hauptstadt nennen, ohne die Gesellschaft, in
der er sich befindet, in peinlichste Verlegenheit zu versetzen, derart geteilt
sind die Ansichten über Berlin. Es ist, als werde ein Gespenst an die Wand
projiziert, und folglich herrscht eine allgemeine Beunruhigung und Vorsicht
in der Meinungsäußerung. Erst in vorgeschrittener Stunde, um Mitternacht,
der Gespensterstunde, wo im selben Maße, als die Konventionen wackeln,
auch die Zunge alkoholisch gelöst ist, gestattet sich ein jeder, offen der
Detektiv des andern zu sein. Dann sind die Ansichten über Berlin derart
geteilt, daß der Eindruck entsteht, jeder von Meinungen geplagte Mensch
lade diese aufs Konto Berlins ab.
Bedenkt man, mit welch freiwilligen Empfindungen Paris von der gesamten
Welt geschmückt wird, wie es die Motten betäubt, Amerikaner und Neger,
und wie es, bei allem zweifelhaften Glanz, einen historischen Ruf wahrt
und zu wahren bestrebt ist, so steht man angesichts Berlins vor einem
Rätsel. Noch immer ist Paris der Schwärm der Provinz, Berlin aber das
Mißtrauen, und so sehr auch Frankreich in Waffen starrt, Vergnügungen
und Literatur bietend, um so beharrlicher taucht in bestimmten Abständen
die alteingesessene Meinung wieder auf, Deutschland sei das finstere Ge-
heimnis Europas.
In Paris wird gebummelt, heißt es, in Berlin ununterbrochen gearbeitet;
sei Paris wahrhaft kulinarisch und epikuräisch, so Berlin, selbst gewisse
Abstriche zugestanden, letzten Endes nichts als tüchtig. Diese Tüchtigkeit
indessen sei keinesfalls gleichzusetzen mit dem französischen Ausdruck für
Tugend, es handle sich vielmehr um eine spezifisch lokalisierte Tüchtigkeit,
eine umsich fressende, lasterhafte, unfaßbare und darum gespenstische, eine Sorte
also, die unvertilgbar sei, die selbst im Zustand größten Elends und größter
Niedergeschlagenheit um sich greife und, wer weiß, plötzlich in unwider-
ruflicher Gesundheit dastehe. Man kann ein Gespenst nicht erschlagen.
Einsichtige Leute lächeln zwar darüber, indem sie solch populär gefärbte
Ansichten ins Gebiet der Vorurteile verweisen, andre, nicht weniger ein-
sichtige hingegen, erklären, Vorurteile seien die besten Barometer. Was
wäre das Dasein, rufen sie aus, ohne die Vorurteile, die es erweckt und
die von jeder Epoche auf eigene Weise revidiert werden? Ist es nicht so,
daß, wer nach Paris fährt, seine Sorgen zu Hause läßt, während sich
empfiehlt, nach Berlin sie mitzunehmen, sich mit ihnen zu panzern?
x36
von MARTIN KESSEL
Es kann in diesen Zeiten, 4128 nach chinesischer Rechnung — und wahr-
lich, es kommt uns vieles chinesisch vor —, kein Mensch in Deutschland
ungestraft den Namen seiner Hauptstadt nennen, ohne die Gesellschaft, in
der er sich befindet, in peinlichste Verlegenheit zu versetzen, derart geteilt
sind die Ansichten über Berlin. Es ist, als werde ein Gespenst an die Wand
projiziert, und folglich herrscht eine allgemeine Beunruhigung und Vorsicht
in der Meinungsäußerung. Erst in vorgeschrittener Stunde, um Mitternacht,
der Gespensterstunde, wo im selben Maße, als die Konventionen wackeln,
auch die Zunge alkoholisch gelöst ist, gestattet sich ein jeder, offen der
Detektiv des andern zu sein. Dann sind die Ansichten über Berlin derart
geteilt, daß der Eindruck entsteht, jeder von Meinungen geplagte Mensch
lade diese aufs Konto Berlins ab.
Bedenkt man, mit welch freiwilligen Empfindungen Paris von der gesamten
Welt geschmückt wird, wie es die Motten betäubt, Amerikaner und Neger,
und wie es, bei allem zweifelhaften Glanz, einen historischen Ruf wahrt
und zu wahren bestrebt ist, so steht man angesichts Berlins vor einem
Rätsel. Noch immer ist Paris der Schwärm der Provinz, Berlin aber das
Mißtrauen, und so sehr auch Frankreich in Waffen starrt, Vergnügungen
und Literatur bietend, um so beharrlicher taucht in bestimmten Abständen
die alteingesessene Meinung wieder auf, Deutschland sei das finstere Ge-
heimnis Europas.
In Paris wird gebummelt, heißt es, in Berlin ununterbrochen gearbeitet;
sei Paris wahrhaft kulinarisch und epikuräisch, so Berlin, selbst gewisse
Abstriche zugestanden, letzten Endes nichts als tüchtig. Diese Tüchtigkeit
indessen sei keinesfalls gleichzusetzen mit dem französischen Ausdruck für
Tugend, es handle sich vielmehr um eine spezifisch lokalisierte Tüchtigkeit,
eine umsich fressende, lasterhafte, unfaßbare und darum gespenstische, eine Sorte
also, die unvertilgbar sei, die selbst im Zustand größten Elends und größter
Niedergeschlagenheit um sich greife und, wer weiß, plötzlich in unwider-
ruflicher Gesundheit dastehe. Man kann ein Gespenst nicht erschlagen.
Einsichtige Leute lächeln zwar darüber, indem sie solch populär gefärbte
Ansichten ins Gebiet der Vorurteile verweisen, andre, nicht weniger ein-
sichtige hingegen, erklären, Vorurteile seien die besten Barometer. Was
wäre das Dasein, rufen sie aus, ohne die Vorurteile, die es erweckt und
die von jeder Epoche auf eigene Weise revidiert werden? Ist es nicht so,
daß, wer nach Paris fährt, seine Sorgen zu Hause läßt, während sich
empfiehlt, nach Berlin sie mitzunehmen, sich mit ihnen zu panzern?
x36