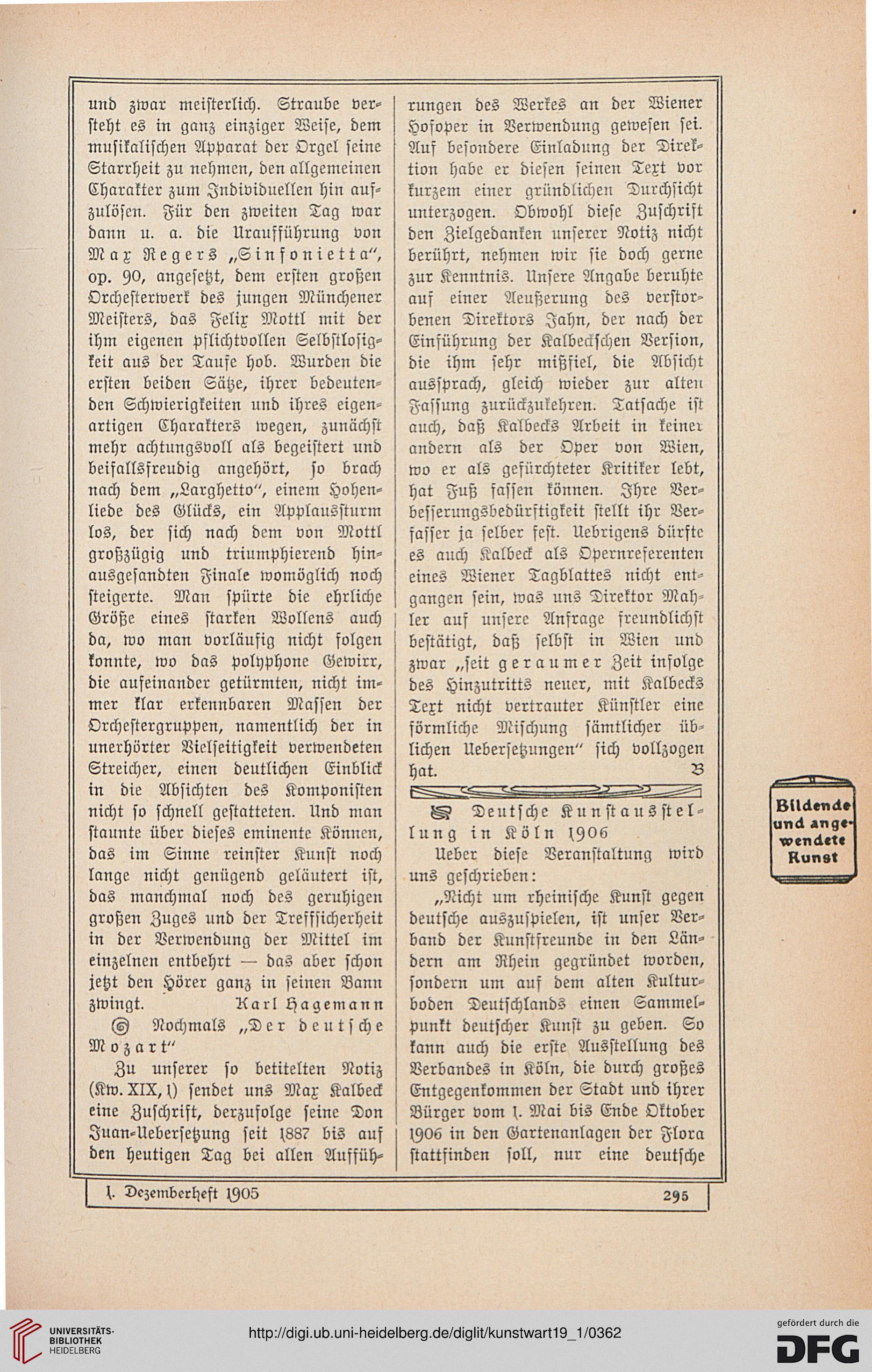und zwar meisterlich. Straube ver-
steht es in ganz einziger Weise, dem
musikalischen Apparat der Orgel seine
Starrheit zu nehmen, den allgemeinen
Charakter zum Jndividuellen hin auf-
zulösen. Für den zweiten Tag war
dann u. a. die Uraufführung von
Max Negers „Sinfonietta",
op. ZO, angesetzt, dem ersten großen
Orchesterwerk des jungen Münchener
Meisters, das Felix Mottl mit der
ihm eigenen pflichtvollcn Selbstlosig-
keit aus der Taufe hob. Wurden die
ersten beiden Sätze, ihrer bedcuten-
den Schwierigkeiten und ihres eigen-
artigen Charakters wegen, zunächst
mehr achtungsvoll als begeistert und
beifallsfreudig angehört, so brach
nach dem „Larghetto", einem Hohen-
liede des Glücks, ein Applaussturm
los, der sich nach dem von Mottl
großzügig und triumphierend hin-
ausgesandten Finale womöglich noch
steigerte. Man spürte die ehrliche
Größe eines starken Wollens auch
da, wo man vorläufig nicht folgen
konnte, wo das polyphone Gewirr,
die aufeinandcr getürmten, nicht im-
mcr klar erkennbaren Massen der
Orchestergruppen, namentlich der in
unerhörter Vielseitigkeit verwendeten
Streicher, einen deutlichen Einblick
in die Absichten dcs Komponisten
nicht so schnell gestatteten. Und man
staunte über dieses eminente Können,
das im Sinne reinster Kunst noch
lange nicht genügend geläutert ist,
das manchmal noch des geruhigcn
großen Zuges und der Treffsicherheit
in der Verwendung der Mittel im
einzelncn entbehrt — das aber schon
jetzt dcn Hörer ganz in seinen Bann
zwingt. Karl ksagemann
G Nochmals „Der deutsche
M 0 z a r t"
Zu unserer so betitelten Notiz
(Kw. XIX, j) sendet uns Max Kalbeck
eine Zuschrift, derzufolge seine Don
Juan-Uebersetzung seit (887 bis auf
dcn heutigen Tag bei allen Auffüh-
rungen des Werkes an der Wiener
Hosoper in Verwendung gewesen sei.
Auf besondere Einladnng der Direk-
tion habe er diesen seinen Text vor
kurzem einer gründlichen Durchsicht
unterzogen. Obwohl diese Zuschrift
den Zielgedanken unsercr Notiz nicht
berührt, nehmen wir sie doch gerne
zur Kenntnis. Unsere Angabe beruhte
auf einer Aeußerung dcs verstor-
benen Direktors Jahn, der nach der
Einführung der Kalbeckschen Version,
die ihm sehr mißfiel, die Absicht
aussprach, gleich wieder zur alten
F-assung zurückzukehren. Tatsache ist
auch, daß Kalbecks Arbeit in keiner
andern als der Oper von Wien,
wo er als gefürchteter Kritiker lebt,
hat Fuß fassen können. Jhre Ver-
besserungsbedürftigkeit stellt ihr Ver-
fasser ja selber fest. Uebrigens dürftc
es auch Kalbeck als Opernreferenten
eines Wiener Tagblattes nicht ent-
gangen sein, was uns Direktor Mah-
ler auf unserc Anfrage freundlichst
bestätigt, daß selbst in Wien und
zwar „seit geraumer Zeit infolge
des Hinzutritts neuer, mit Kalbecks
Text nicht vertrauter Künstler eine
sörmliche Mischung sämtlicher üb-
lichen Uebersetzungen" sich vollzogen
hat. B
t--^- -
M Deutsche K u n st a u s st e l-
lung in Köln (906
Uebcr diese Veranstaltung wird
uns geschrieben:
„Nicht um rheinische Kunst gcgen
deutsche auszuspielen, ist unser Ver-
band der Kunstfreunde in den Län-
dern am Rhein gegründet worden,
sondern um auf dem alten Kultur-
boden Deutschlands einen Sammel-
punkt deutscher Kunst zu geben. So
kann auch die erste Ausstellung des
Verbandes in Köln, die durch großes
Entgegenkommen der Stadt und ihrer
Bürger vom (. Mai bis Ende Oktober
(906 in den Gartenanlagen der F-lora
stattfinden soll, nur eine deutsche
(. Dczemberheft (905 2^5
8llck«n<1»
un<1 »ng«-
vrn<1«1«
ktunst
->. . - ---»
steht es in ganz einziger Weise, dem
musikalischen Apparat der Orgel seine
Starrheit zu nehmen, den allgemeinen
Charakter zum Jndividuellen hin auf-
zulösen. Für den zweiten Tag war
dann u. a. die Uraufführung von
Max Negers „Sinfonietta",
op. ZO, angesetzt, dem ersten großen
Orchesterwerk des jungen Münchener
Meisters, das Felix Mottl mit der
ihm eigenen pflichtvollcn Selbstlosig-
keit aus der Taufe hob. Wurden die
ersten beiden Sätze, ihrer bedcuten-
den Schwierigkeiten und ihres eigen-
artigen Charakters wegen, zunächst
mehr achtungsvoll als begeistert und
beifallsfreudig angehört, so brach
nach dem „Larghetto", einem Hohen-
liede des Glücks, ein Applaussturm
los, der sich nach dem von Mottl
großzügig und triumphierend hin-
ausgesandten Finale womöglich noch
steigerte. Man spürte die ehrliche
Größe eines starken Wollens auch
da, wo man vorläufig nicht folgen
konnte, wo das polyphone Gewirr,
die aufeinandcr getürmten, nicht im-
mcr klar erkennbaren Massen der
Orchestergruppen, namentlich der in
unerhörter Vielseitigkeit verwendeten
Streicher, einen deutlichen Einblick
in die Absichten dcs Komponisten
nicht so schnell gestatteten. Und man
staunte über dieses eminente Können,
das im Sinne reinster Kunst noch
lange nicht genügend geläutert ist,
das manchmal noch des geruhigcn
großen Zuges und der Treffsicherheit
in der Verwendung der Mittel im
einzelncn entbehrt — das aber schon
jetzt dcn Hörer ganz in seinen Bann
zwingt. Karl ksagemann
G Nochmals „Der deutsche
M 0 z a r t"
Zu unserer so betitelten Notiz
(Kw. XIX, j) sendet uns Max Kalbeck
eine Zuschrift, derzufolge seine Don
Juan-Uebersetzung seit (887 bis auf
dcn heutigen Tag bei allen Auffüh-
rungen des Werkes an der Wiener
Hosoper in Verwendung gewesen sei.
Auf besondere Einladnng der Direk-
tion habe er diesen seinen Text vor
kurzem einer gründlichen Durchsicht
unterzogen. Obwohl diese Zuschrift
den Zielgedanken unsercr Notiz nicht
berührt, nehmen wir sie doch gerne
zur Kenntnis. Unsere Angabe beruhte
auf einer Aeußerung dcs verstor-
benen Direktors Jahn, der nach der
Einführung der Kalbeckschen Version,
die ihm sehr mißfiel, die Absicht
aussprach, gleich wieder zur alten
F-assung zurückzukehren. Tatsache ist
auch, daß Kalbecks Arbeit in keiner
andern als der Oper von Wien,
wo er als gefürchteter Kritiker lebt,
hat Fuß fassen können. Jhre Ver-
besserungsbedürftigkeit stellt ihr Ver-
fasser ja selber fest. Uebrigens dürftc
es auch Kalbeck als Opernreferenten
eines Wiener Tagblattes nicht ent-
gangen sein, was uns Direktor Mah-
ler auf unserc Anfrage freundlichst
bestätigt, daß selbst in Wien und
zwar „seit geraumer Zeit infolge
des Hinzutritts neuer, mit Kalbecks
Text nicht vertrauter Künstler eine
sörmliche Mischung sämtlicher üb-
lichen Uebersetzungen" sich vollzogen
hat. B
t--^- -
M Deutsche K u n st a u s st e l-
lung in Köln (906
Uebcr diese Veranstaltung wird
uns geschrieben:
„Nicht um rheinische Kunst gcgen
deutsche auszuspielen, ist unser Ver-
band der Kunstfreunde in den Län-
dern am Rhein gegründet worden,
sondern um auf dem alten Kultur-
boden Deutschlands einen Sammel-
punkt deutscher Kunst zu geben. So
kann auch die erste Ausstellung des
Verbandes in Köln, die durch großes
Entgegenkommen der Stadt und ihrer
Bürger vom (. Mai bis Ende Oktober
(906 in den Gartenanlagen der F-lora
stattfinden soll, nur eine deutsche
(. Dczemberheft (905 2^5
8llck«n<1»
un<1 »ng«-
vrn<1«1«
ktunst
->. . - ---»