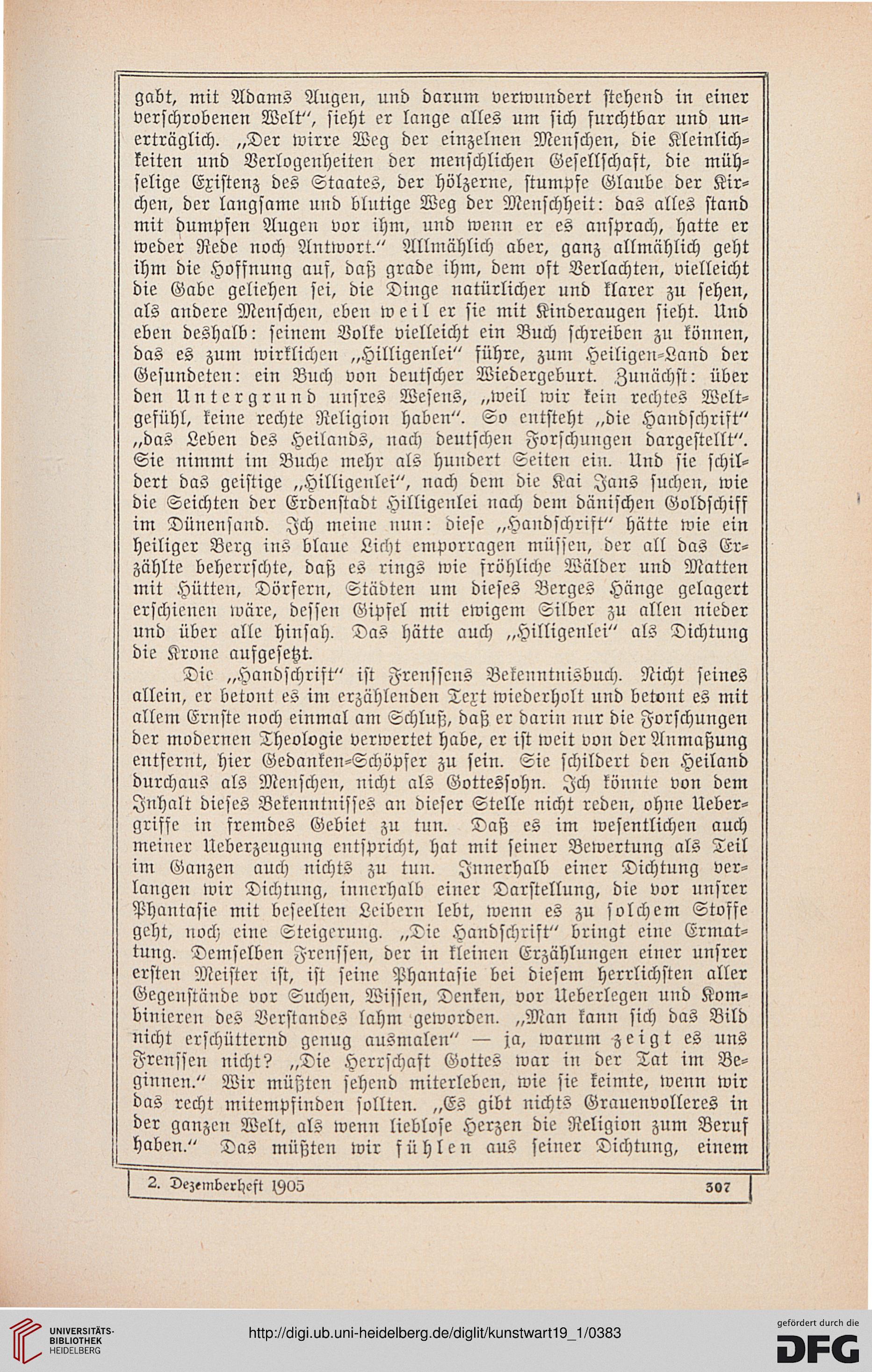gabt, mit Adams Augen, uud darum verwundert stchcud in einer
verschrobenen Welt", sieht er lange alles um sich fnrchtbar und un-
erträglich. „Der wirre Weg der einzelnen Menschen, die Kleinlich-
keiten und Verlogenheiten der menschlichen Gesellschaft, die müh-
selige Existenz des Staates, der hölzerne, stumpfe Glaube der Kir-
chen, der langsame und blntige Weg der Menschheit: das alles stand
mit dumpfen Augen vor ihm, und wenn er es ansprach, hatte er
weder Rede noch Antwort." Allmählich aber, ganz allmählich geht
ihm die Hoffnung auf, daß grade ihm, dem oft Verlachten, vielleicht
die Gabe geliehen sei, die Dinge natürlicher nnd klarer zu sehen,
als andere Menschen, eben weil er sie mit Kinderaugen sieht. Und
eben deshalb: seinem Volke vielleicht ein Buch schreibcn zu können,
das es zum wirklichen „Hilligenlei" führe, zum Heiligen-Land der
Gesundeten: ein Buch von deutscher Wiedergebnrt. Zunächst: über
den Untergrund nnsrcs Wesens, „weil wir kein rechtes Welt-
gefühl, keine rechte Religion haben". So entsteht „die Handschrift"
„das Leben des Heilands, nach deutschen Forschungen dargestellt".
Sie nimmt im Buche mehr als hnndert Seiten ein. Und sie schil-
dert das geistige „Hilligenlei", nach dem die Kai Jans snchen, wie
die Seichten der Erdenstadt Hilligenlei nach dem dänischen Goldschiff
im Dünensand. Jch meine nun: diese „Handschrift" hätte wie ein
heiliger Berg ins blaue Licht emporragen müssen, der all das Er-
zählte beherrschte, daß es rings wie fröhliche Wälder und Matten
mit Hütten, Dörfern, Städten um dieses Berges Hänge gelagert
erschicnen wäre, dessen Gipfel mit ewigem Silber zu allen nieder
und über alle hinsah. Das hätte auch „Hilligenlei" als Dichtung
die Kronc aufgesetzt.
Die „Handschrift" ist Frenssens Bekenntnisbuch. Nicht seines
allein, er betont es im erzählenden Text wiederholt und betont es mit
allem Ernste noch einmal am Schluß, daß er darin nnr die Forschungen
der modernen Theologie verwertet habe, er ist weit von der Anmaßung
entfernt, hier Gedanken-Schöpfer zu sein. Sie schildert den Heiland
durchaus als Menschen, nicht als Gottessohn. Jch könnte von dem
Jnhalt dieses Bekenntnisses an dieser Stelle nicht reden, ohne Ueber-
griffe in fremdes Gebiet zu tun. Daß es im wesentlichen auch
meiner Ueberzeugnng entspricht, hat mit seiner Bewertung als Teil
im Ganzen auch nichts zu tun. Jnnerhalb einer Dichtung ver-
langen wir Dichtnng, inncrhalb einer Darstellung, die vor unsrer
Phantasie mit beseelten Leibcrn lebt, wenn es zu solchem Stosfe
gcht, noch eine Steigcrung. „Dic Handschrift" bringt eine Ermat-
tung. Demselben Frenssen, der in kleincn Erzählungen einer unsrer
ersten Meister ist, ist seine Phantasie bei diesem herrlichsten aller
Gegenstände vor Suchen, Wissen, Denken, vor Ucberlegen und Kom-
binieren des Verstandes lahm geworden. „Man kann sich das Bild
nicht erschütternd genug ausmalen" — ja, warnm zeigt es uns
Frenssen nicht? „Die Herrschaft Gottes war in dcr Tat im Be-
ginncn." Wir müßten sehend miterleben, wie sie keimte, wenn wir
das recht mitempfinden sollten. „Es gibt nichts Grauenvolleres in
der ganzen Welt, als wenn lieblose Herzen die Religion znm Beruf
haben." Das müßten wir fühlen ans seiner Dichtnng, einem
2. Dezemberheft Mö 307
verschrobenen Welt", sieht er lange alles um sich fnrchtbar und un-
erträglich. „Der wirre Weg der einzelnen Menschen, die Kleinlich-
keiten und Verlogenheiten der menschlichen Gesellschaft, die müh-
selige Existenz des Staates, der hölzerne, stumpfe Glaube der Kir-
chen, der langsame und blntige Weg der Menschheit: das alles stand
mit dumpfen Augen vor ihm, und wenn er es ansprach, hatte er
weder Rede noch Antwort." Allmählich aber, ganz allmählich geht
ihm die Hoffnung auf, daß grade ihm, dem oft Verlachten, vielleicht
die Gabe geliehen sei, die Dinge natürlicher nnd klarer zu sehen,
als andere Menschen, eben weil er sie mit Kinderaugen sieht. Und
eben deshalb: seinem Volke vielleicht ein Buch schreibcn zu können,
das es zum wirklichen „Hilligenlei" führe, zum Heiligen-Land der
Gesundeten: ein Buch von deutscher Wiedergebnrt. Zunächst: über
den Untergrund nnsrcs Wesens, „weil wir kein rechtes Welt-
gefühl, keine rechte Religion haben". So entsteht „die Handschrift"
„das Leben des Heilands, nach deutschen Forschungen dargestellt".
Sie nimmt im Buche mehr als hnndert Seiten ein. Und sie schil-
dert das geistige „Hilligenlei", nach dem die Kai Jans snchen, wie
die Seichten der Erdenstadt Hilligenlei nach dem dänischen Goldschiff
im Dünensand. Jch meine nun: diese „Handschrift" hätte wie ein
heiliger Berg ins blaue Licht emporragen müssen, der all das Er-
zählte beherrschte, daß es rings wie fröhliche Wälder und Matten
mit Hütten, Dörfern, Städten um dieses Berges Hänge gelagert
erschicnen wäre, dessen Gipfel mit ewigem Silber zu allen nieder
und über alle hinsah. Das hätte auch „Hilligenlei" als Dichtung
die Kronc aufgesetzt.
Die „Handschrift" ist Frenssens Bekenntnisbuch. Nicht seines
allein, er betont es im erzählenden Text wiederholt und betont es mit
allem Ernste noch einmal am Schluß, daß er darin nnr die Forschungen
der modernen Theologie verwertet habe, er ist weit von der Anmaßung
entfernt, hier Gedanken-Schöpfer zu sein. Sie schildert den Heiland
durchaus als Menschen, nicht als Gottessohn. Jch könnte von dem
Jnhalt dieses Bekenntnisses an dieser Stelle nicht reden, ohne Ueber-
griffe in fremdes Gebiet zu tun. Daß es im wesentlichen auch
meiner Ueberzeugnng entspricht, hat mit seiner Bewertung als Teil
im Ganzen auch nichts zu tun. Jnnerhalb einer Dichtung ver-
langen wir Dichtnng, inncrhalb einer Darstellung, die vor unsrer
Phantasie mit beseelten Leibcrn lebt, wenn es zu solchem Stosfe
gcht, noch eine Steigcrung. „Dic Handschrift" bringt eine Ermat-
tung. Demselben Frenssen, der in kleincn Erzählungen einer unsrer
ersten Meister ist, ist seine Phantasie bei diesem herrlichsten aller
Gegenstände vor Suchen, Wissen, Denken, vor Ucberlegen und Kom-
binieren des Verstandes lahm geworden. „Man kann sich das Bild
nicht erschütternd genug ausmalen" — ja, warnm zeigt es uns
Frenssen nicht? „Die Herrschaft Gottes war in dcr Tat im Be-
ginncn." Wir müßten sehend miterleben, wie sie keimte, wenn wir
das recht mitempfinden sollten. „Es gibt nichts Grauenvolleres in
der ganzen Welt, als wenn lieblose Herzen die Religion znm Beruf
haben." Das müßten wir fühlen ans seiner Dichtnng, einem
2. Dezemberheft Mö 307