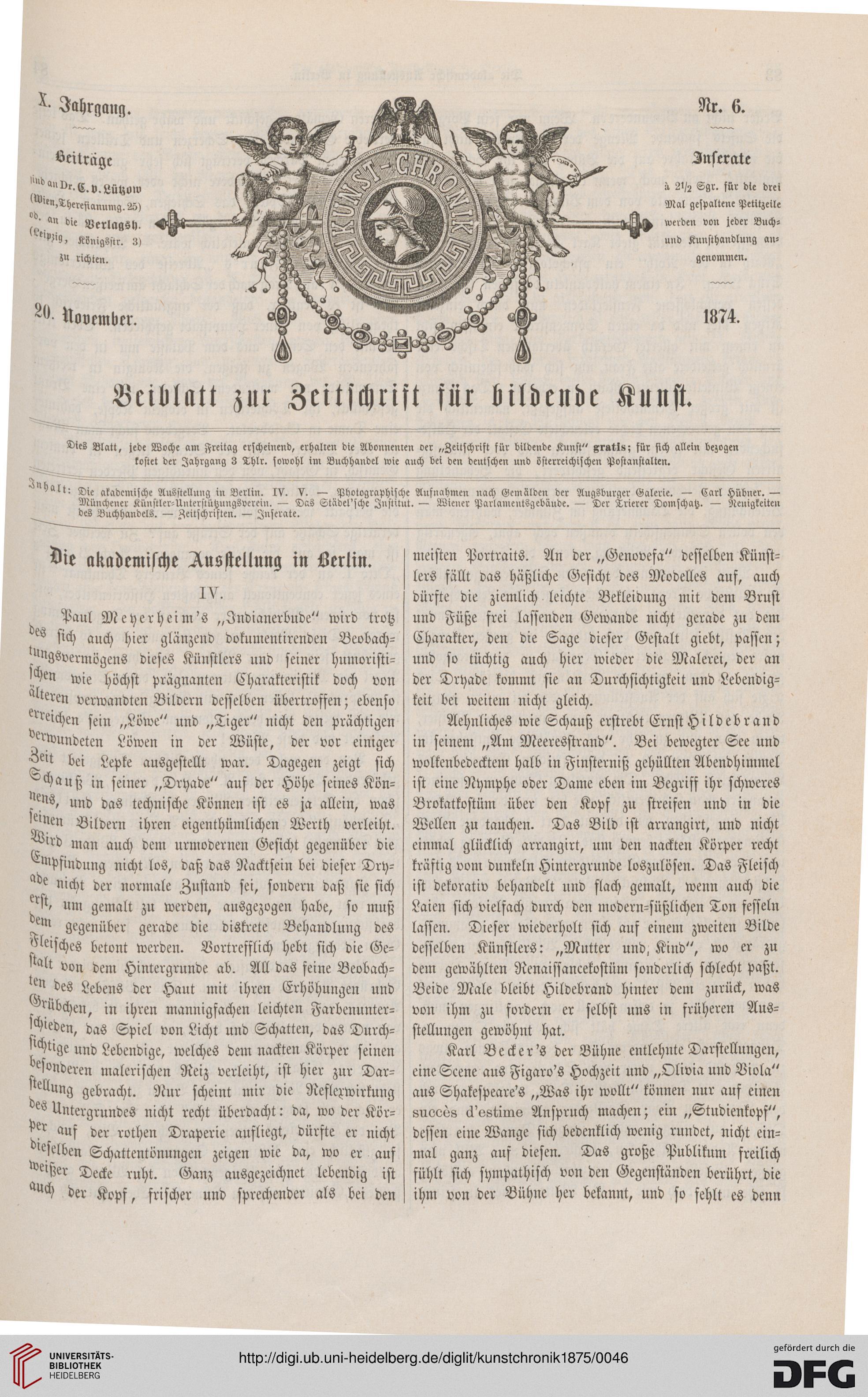Jahrgang.
^citrägc
C.v.LüIzvw
^",Therefianumg.25)
^ an die Verlagsl).
Königsstr. 3)
zu richten.
"0 fiovnnbrr.
Nr. 6.
Znscrate
ü. 21/2 Sgr. für die drei
Mal gespaltene Petitzeile
werden von jeder Buch-
und Kunsthandlung an-
genommen.
1874.
Gnlilatt zur Zcitschrist sür bildende Kunst.
Dies Blatt, jede Woche am Freitag erscheinend, erhalren die Abonnenren oer „Zeitschrift für bildende Kunst" gratls; für sich allein bezogen
kostet der Jahrgang 3 Thlr. fowohl im Buchhandel wie auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.
-.. -.. —....- —. ,, , . - . ..
Die akadcmische Ausstellung in Berlin. IV. V. — Photographische Aufnahmen nach Gemälden der Augsburger Galerie. — Carl Hübner. —
Münchener Künstler-Unterslützungsverein. — Das Städel'sche Jnstitut. — Wiener Parlamentsgebäude. — Der Trierer Domschatz. — Neuigkeiten
des Buchhandels. — Zeitschriften. — Jnserate.
Die akademische Äusftellung in Oerlin.
IV.
Paul Meyerheim's „Jndianerbude" wird trotz
^ sich auch hier glänzend dokumentirenden Beobach-
^ugsvermögens dieses Künstlers und seiner humoristi-
Ichen mie höchst prägnanten Charakteristik doch von
Eeren verwandten Bildern desselben übertrofsen; ebenso
^'ceichen sein „Löwe" und „Tiger" nicht den prächtigen
^'wundeten Löwen in der Wüste, der vor einiger
-oeit bet Lepke ausgestcllt war. Dagegen zeigt sich
chauß in seiner „Dryade" auf der Höhe seines Kön-
^s, nnd das technische Können ist es ja allein, was
Icinen Bildern ihren eigcnthümlichen Wcrth verleiht.
^rd man anch dem urmodernen Gesicht gegenüber die
^"pfindung nicht los, daß das Nacktsein bei dieser Dry-
nicht der normale Zustand sci, sondern daß sie sich
^sst um gemalt zu werden, ausgezogen habe, so muß
gegenüber gerade die diskrete Behandlung des
^isches bctont wcrden. Vortrcfflich hebt sich die Ge-
Ilalt von dem Hintergrunde ab. All das feine Beobach-
wn des Lebens der Haut mit ihren Erhöhungen und
cübchen, in ihren mannigfachen leichten Farbenunter-
ichieden, das Spiel von Licht und Schatten, das Durch-
stchtige und Lebendige, welches dem nackten Körper seinen
csvnderen malerischen Reiz verleiht, ist hier zur Dar-
cllung gebracht. Nur scheint mir die Reflcxwirkung
^ Üntergrundes nicht recht überdacht: da, wo der Kör-
auf der rothen Draperie aufliegt, dürfte er nicht
^cselben Schattentönungen zeigen wie da, wo er auf
^cißer Decke ruht. Ganz ausgezcichnet lebendig ist
auch Kopf, frischer und sprechender als bei den
meisten Portraits. An der „Genovefa" desselben Künst-
lers fällt das häßliche Gcsicht des Modelles auf, auch
dürste die ziemlich leichte Bekleidung mit dem Brust
und Füße frei lassenden Gewande nicht gerade zu dem
Charakter, den die Sage dieser Gestalt giebt, Passen;
und so tüchtig auch hier wieder die Malerei, der an
der Dryade kvmmt sie an Durchsichtigkeit und Lebendig-
keit bei weitem nicht gleich.
Aehnliches wie Schauß erstrebt Ernst Hildebrand
in seinem „Am Meeresstrand". Bei bewegter See und
wolkenbedecktem halb in Finsterniß gchüllten Abendhimmel
ist eine Nymphe oder Dame eben im Begriff ihr schweres
Brokatkostüm über den Kopf zu streifen und in die
Wellen zu tauchen- Das Bild ist arrangirt, und nicht
cimnal glücklich arrangirt, um den nacklen Körper recht
kräftig vom dunkeln Hintcrgrunde loszulösen. Das Fleisch
ist dekorativ behandelt und flach gemalt, wenn auch die
Laien sich vielfach durch den modern-süßlichen Ton fesseln
lafsen. Dieser wiederholt sich auf einem zweiten Bilde
desselben Künstlers: „Mutter und, Kind", wo er zu
dem gewählten Renaissancekostüm sonderlich schlecht paßt.
Beide Male bleibt Hildebrand hinter dem zurück, was
von ihm zu fordern er selbst uns in früheren Aus-
stellungen gewöhnt hat.
Karl Becker 's der Bühne entlehnte Darstellungen,
eine Scene aus Figaro's Hochzeit und „Olivia und Viola"
aus Shakespeare's „Was ihr wollt" können nur auf einen
8U6O68 ä'vbtiins Anspruch machen; ein „Studienkopf",
dessen eine Wange sich bedenklich wenig rundet, nicht ein-
mal ganz auf diesen. Das große Publikum freilich
fühlt sich sympathisch von den Gegenständen berührt, die
ihm von der Bühne her bekannt, und so fehlt es denn
^citrägc
C.v.LüIzvw
^",Therefianumg.25)
^ an die Verlagsl).
Königsstr. 3)
zu richten.
"0 fiovnnbrr.
Nr. 6.
Znscrate
ü. 21/2 Sgr. für die drei
Mal gespaltene Petitzeile
werden von jeder Buch-
und Kunsthandlung an-
genommen.
1874.
Gnlilatt zur Zcitschrist sür bildende Kunst.
Dies Blatt, jede Woche am Freitag erscheinend, erhalren die Abonnenren oer „Zeitschrift für bildende Kunst" gratls; für sich allein bezogen
kostet der Jahrgang 3 Thlr. fowohl im Buchhandel wie auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.
-.. -.. —....- —. ,, , . - . ..
Die akadcmische Ausstellung in Berlin. IV. V. — Photographische Aufnahmen nach Gemälden der Augsburger Galerie. — Carl Hübner. —
Münchener Künstler-Unterslützungsverein. — Das Städel'sche Jnstitut. — Wiener Parlamentsgebäude. — Der Trierer Domschatz. — Neuigkeiten
des Buchhandels. — Zeitschriften. — Jnserate.
Die akademische Äusftellung in Oerlin.
IV.
Paul Meyerheim's „Jndianerbude" wird trotz
^ sich auch hier glänzend dokumentirenden Beobach-
^ugsvermögens dieses Künstlers und seiner humoristi-
Ichen mie höchst prägnanten Charakteristik doch von
Eeren verwandten Bildern desselben übertrofsen; ebenso
^'ceichen sein „Löwe" und „Tiger" nicht den prächtigen
^'wundeten Löwen in der Wüste, der vor einiger
-oeit bet Lepke ausgestcllt war. Dagegen zeigt sich
chauß in seiner „Dryade" auf der Höhe seines Kön-
^s, nnd das technische Können ist es ja allein, was
Icinen Bildern ihren eigcnthümlichen Wcrth verleiht.
^rd man anch dem urmodernen Gesicht gegenüber die
^"pfindung nicht los, daß das Nacktsein bei dieser Dry-
nicht der normale Zustand sci, sondern daß sie sich
^sst um gemalt zu werden, ausgezogen habe, so muß
gegenüber gerade die diskrete Behandlung des
^isches bctont wcrden. Vortrcfflich hebt sich die Ge-
Ilalt von dem Hintergrunde ab. All das feine Beobach-
wn des Lebens der Haut mit ihren Erhöhungen und
cübchen, in ihren mannigfachen leichten Farbenunter-
ichieden, das Spiel von Licht und Schatten, das Durch-
stchtige und Lebendige, welches dem nackten Körper seinen
csvnderen malerischen Reiz verleiht, ist hier zur Dar-
cllung gebracht. Nur scheint mir die Reflcxwirkung
^ Üntergrundes nicht recht überdacht: da, wo der Kör-
auf der rothen Draperie aufliegt, dürfte er nicht
^cselben Schattentönungen zeigen wie da, wo er auf
^cißer Decke ruht. Ganz ausgezcichnet lebendig ist
auch Kopf, frischer und sprechender als bei den
meisten Portraits. An der „Genovefa" desselben Künst-
lers fällt das häßliche Gcsicht des Modelles auf, auch
dürste die ziemlich leichte Bekleidung mit dem Brust
und Füße frei lassenden Gewande nicht gerade zu dem
Charakter, den die Sage dieser Gestalt giebt, Passen;
und so tüchtig auch hier wieder die Malerei, der an
der Dryade kvmmt sie an Durchsichtigkeit und Lebendig-
keit bei weitem nicht gleich.
Aehnliches wie Schauß erstrebt Ernst Hildebrand
in seinem „Am Meeresstrand". Bei bewegter See und
wolkenbedecktem halb in Finsterniß gchüllten Abendhimmel
ist eine Nymphe oder Dame eben im Begriff ihr schweres
Brokatkostüm über den Kopf zu streifen und in die
Wellen zu tauchen- Das Bild ist arrangirt, und nicht
cimnal glücklich arrangirt, um den nacklen Körper recht
kräftig vom dunkeln Hintcrgrunde loszulösen. Das Fleisch
ist dekorativ behandelt und flach gemalt, wenn auch die
Laien sich vielfach durch den modern-süßlichen Ton fesseln
lafsen. Dieser wiederholt sich auf einem zweiten Bilde
desselben Künstlers: „Mutter und, Kind", wo er zu
dem gewählten Renaissancekostüm sonderlich schlecht paßt.
Beide Male bleibt Hildebrand hinter dem zurück, was
von ihm zu fordern er selbst uns in früheren Aus-
stellungen gewöhnt hat.
Karl Becker 's der Bühne entlehnte Darstellungen,
eine Scene aus Figaro's Hochzeit und „Olivia und Viola"
aus Shakespeare's „Was ihr wollt" können nur auf einen
8U6O68 ä'vbtiins Anspruch machen; ein „Studienkopf",
dessen eine Wange sich bedenklich wenig rundet, nicht ein-
mal ganz auf diesen. Das große Publikum freilich
fühlt sich sympathisch von den Gegenständen berührt, die
ihm von der Bühne her bekannt, und so fehlt es denn