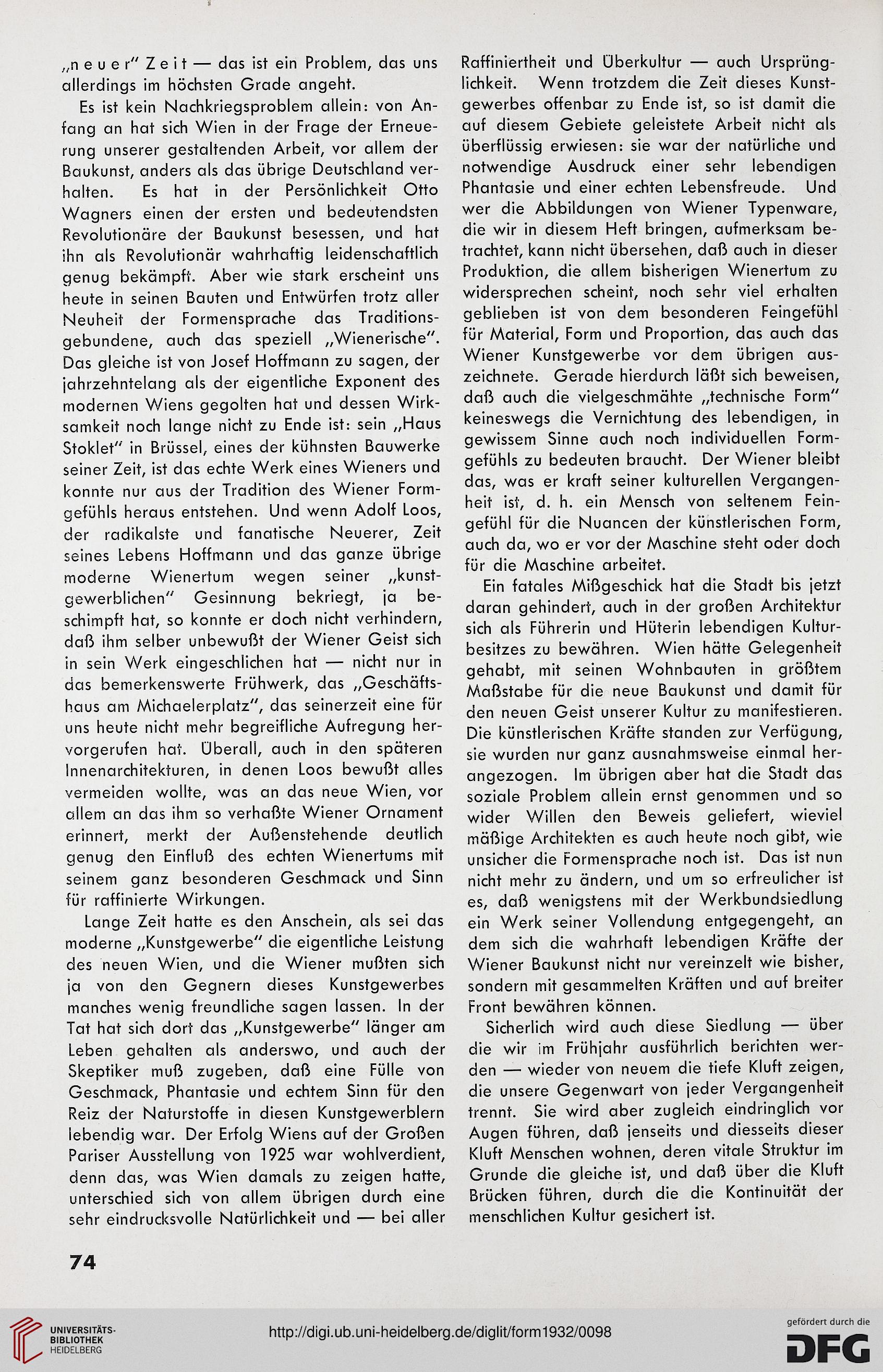>
„n e u e r" Z e i t — das ist ein Problem, das uns
allerdings im höchsten Grade angeht.
Es ist kein Nachkriegsproblem allein: von An-
fang an hat sich Wien in der Frage der Erneue-
rung unserer gestaltenden Arbeit, vor allem der
Baukunst, anders als das übrige Deutschland ver-
halten. Es hat in der Persönlichkeit Otto
Wagners einen der ersten und bedeutendsten
Revolutionäre der Baukunst besessen, und hat
ihn als Revolutionär wahrhaftig leidenschaftlich
genug bekämpft. Aber wie stark erscheint uns
heute in seinen Bauten und Entwürfen trotz aller
Neuheit der Formensprache das Traditions-
gebundene, auch das speziell „Wienerische".
Das gleiche ist von Josef Hoffmann zu sagen, der
jahrzehntelang als der eigentliche Exponent des
modernen Wiens gegolten hat und dessen Wirk-
samkeit noch lange nicht zu Ende ist: sein „Haus
Stoklet" in Brüssel, eines der kühnsten Bauwerke
seiner Zeit, ist das echte Werk eines Wieners und
konnte nur aus der Tradition des Wiener Form-
gefühls heraus entstehen. Und wenn Adolf Loos,
der radikalste und fanatische Neuerer, Zeit
seines Lebens Hoffmann und das ganze übrige
moderne Wienertum wegen seiner „kunst-
gewerblichen" Gesinnung bekriegt, ja be-
schimpft hat, so konnte er doch nicht verhindern,
daß ihm selber unbewußt der Wiener Geist sich
in sein Werk eingeschlichen hat — nicht nur in
das bemerkenswerte Frühwerk, das „Geschäfts-
haus am Michaelerplatz", das seinerzeit eine für
uns heute nicht mehr begreifliche Aufregung her-
vorgerufen hat. überall, auch in den späteren
Innenarchitekturen, in denen Loos bewußt alles
vermeiden wollte, was an das neue Wien, vor
allem an das ihm so verhaßte Wiener Ornament
erinnert, merkt der Außenstehende deutlich
genug den Einfluß des echten Wienertums mit
seinem ganz besonderen Geschmack und Sinn
für raffinierte Wirkungen.
Lange Zeit hatte es den Anschein, als sei das
moderne „Kunstgewerbe" die eigentliche Leistung
des neuen Wien, und die Wiener mußten sich
ja von den Gegnern dieses Kunstgewerbes
manches wenig freundliche sagen lassen. In der
Tat hat sich dort das „Kunstgewerbe" länger am
Leben gehalten als anderswo, und auch der
Skeptiker muß zugeben, daß eine Fülle von
Geschmack, Phantasie und echtem Sinn für den
Reiz der Naturstoffe in diesen Kunstgewerblern
lebendig war. Der Erfolg Wiens auf der Großen
Pariser Ausstellung von 1925 war wohlverdient,
denn das, was Wien damals zu zeigen hatte,
unterschied sich von allem übrigen durch eine
sehr eindrucksvolle Natürlichkeit und — bei aller
Raffiniertheit und Überkultur — auch Ursprüng-
lichkeit. Wenn trotzdem die Zeit dieses Kunst-
gewerbes offenbar zu Ende ist, so ist damit die
auf diesem Gebiete geleistete Arbeit nicht als
überflüssig erwiesen: sie war der natürliche und
notwendige Ausdruck einer sehr lebendigen
Phantasie und einer echten Lebensfreude. Und
wer die Abbildungen von Wiener Typenware,
die wir in diesem Heft bringen, aufmerksam be-
trachtet, kann nicht übersehen, daß auch in dieser
Produktion, die allem bisherigen Wienertum zu
widersprechen scheint, noch sehr viel erhalten
geblieben ist von dem besonderen Feingefühl
für Material, Form und Proportion, das auch das
Wiener Kunstgewerbe vor dem übrigen aus-
zeichnete. Gerade hierdurch läßt sich beweisen,
daß auch die vielgeschmähte „technische Form"
keineswegs die Vernichtung des lebendigen, in
gewissem Sinne auch noch individuellen Form-
gefühls zu bedeuten braucht. Der Wiener bleibt
das, was er kraft seiner kulturellen Vergangen-
heit ist, d. h. ein Mensch von seltenem Fein-
gefühl für die Nuancen der künstlerischen Form,
auch da, wo er vor der Maschine steht oder doch
für die Maschine arbeitet.
Ein fatales Mißgeschick hat die Stadt bis jetzt
daran gehindert, auch in der großen Architektur
sich als Führerin und Hüterin lebendigen Kultur-
besitzes zu bewähren. Wien hätte Gelegenheit
gehabt, mit seinen Wohnbauten in größtem
Maßstabe für die neue Baukunst und damit für
den neuen Geist unserer Kultur zu manifestieren.
Die künstlerischen Kräfte standen zur Verfügung,
sie wurden nur ganz ausnahmsweise einmal her-
angezogen. Im übrigen aber hat die Stadt das
soziale Problem allein ernst genommen und so
wider Willen den Beweis geliefert, wieviel
mäßige Architekten es auch heute noch gibt, wie
unsicher die Formensprache noch ist. Das ist nun
nicht mehr zu ändern, und um so erfreulicher ist
es, daß wenigstens mit der Werkbundsiedlung
ein Werk seiner Vollendung entgegengeht, an
dem sich die wahrhaft lebendigen Kräfte der
Wiener Baukunst nicht nur vereinzelt wie bisher,
sondern mit gesammelten Kräften und auf breiter
Front bewähren können.
Sicherlich wird auch diese Siedlung — über
die wir im Frühjahr ausführlich berichten wer-
den — wieder von neuem die tiefe Kluft zeigen,
die unsere Gegenwart von jeder Vergangenheit
trennt. Sie wird aber zugleich eindringlich vor
Augen führen, daß jenseits und diesseits dieser
Kluft Menschen wohnen, deren vitale Struktur im
Grunde die gleiche ist, und daß über die Kluft
Brücken führen, durch die die Kontinuität der
menschlichen Kultur gesichert ist.
74
„n e u e r" Z e i t — das ist ein Problem, das uns
allerdings im höchsten Grade angeht.
Es ist kein Nachkriegsproblem allein: von An-
fang an hat sich Wien in der Frage der Erneue-
rung unserer gestaltenden Arbeit, vor allem der
Baukunst, anders als das übrige Deutschland ver-
halten. Es hat in der Persönlichkeit Otto
Wagners einen der ersten und bedeutendsten
Revolutionäre der Baukunst besessen, und hat
ihn als Revolutionär wahrhaftig leidenschaftlich
genug bekämpft. Aber wie stark erscheint uns
heute in seinen Bauten und Entwürfen trotz aller
Neuheit der Formensprache das Traditions-
gebundene, auch das speziell „Wienerische".
Das gleiche ist von Josef Hoffmann zu sagen, der
jahrzehntelang als der eigentliche Exponent des
modernen Wiens gegolten hat und dessen Wirk-
samkeit noch lange nicht zu Ende ist: sein „Haus
Stoklet" in Brüssel, eines der kühnsten Bauwerke
seiner Zeit, ist das echte Werk eines Wieners und
konnte nur aus der Tradition des Wiener Form-
gefühls heraus entstehen. Und wenn Adolf Loos,
der radikalste und fanatische Neuerer, Zeit
seines Lebens Hoffmann und das ganze übrige
moderne Wienertum wegen seiner „kunst-
gewerblichen" Gesinnung bekriegt, ja be-
schimpft hat, so konnte er doch nicht verhindern,
daß ihm selber unbewußt der Wiener Geist sich
in sein Werk eingeschlichen hat — nicht nur in
das bemerkenswerte Frühwerk, das „Geschäfts-
haus am Michaelerplatz", das seinerzeit eine für
uns heute nicht mehr begreifliche Aufregung her-
vorgerufen hat. überall, auch in den späteren
Innenarchitekturen, in denen Loos bewußt alles
vermeiden wollte, was an das neue Wien, vor
allem an das ihm so verhaßte Wiener Ornament
erinnert, merkt der Außenstehende deutlich
genug den Einfluß des echten Wienertums mit
seinem ganz besonderen Geschmack und Sinn
für raffinierte Wirkungen.
Lange Zeit hatte es den Anschein, als sei das
moderne „Kunstgewerbe" die eigentliche Leistung
des neuen Wien, und die Wiener mußten sich
ja von den Gegnern dieses Kunstgewerbes
manches wenig freundliche sagen lassen. In der
Tat hat sich dort das „Kunstgewerbe" länger am
Leben gehalten als anderswo, und auch der
Skeptiker muß zugeben, daß eine Fülle von
Geschmack, Phantasie und echtem Sinn für den
Reiz der Naturstoffe in diesen Kunstgewerblern
lebendig war. Der Erfolg Wiens auf der Großen
Pariser Ausstellung von 1925 war wohlverdient,
denn das, was Wien damals zu zeigen hatte,
unterschied sich von allem übrigen durch eine
sehr eindrucksvolle Natürlichkeit und — bei aller
Raffiniertheit und Überkultur — auch Ursprüng-
lichkeit. Wenn trotzdem die Zeit dieses Kunst-
gewerbes offenbar zu Ende ist, so ist damit die
auf diesem Gebiete geleistete Arbeit nicht als
überflüssig erwiesen: sie war der natürliche und
notwendige Ausdruck einer sehr lebendigen
Phantasie und einer echten Lebensfreude. Und
wer die Abbildungen von Wiener Typenware,
die wir in diesem Heft bringen, aufmerksam be-
trachtet, kann nicht übersehen, daß auch in dieser
Produktion, die allem bisherigen Wienertum zu
widersprechen scheint, noch sehr viel erhalten
geblieben ist von dem besonderen Feingefühl
für Material, Form und Proportion, das auch das
Wiener Kunstgewerbe vor dem übrigen aus-
zeichnete. Gerade hierdurch läßt sich beweisen,
daß auch die vielgeschmähte „technische Form"
keineswegs die Vernichtung des lebendigen, in
gewissem Sinne auch noch individuellen Form-
gefühls zu bedeuten braucht. Der Wiener bleibt
das, was er kraft seiner kulturellen Vergangen-
heit ist, d. h. ein Mensch von seltenem Fein-
gefühl für die Nuancen der künstlerischen Form,
auch da, wo er vor der Maschine steht oder doch
für die Maschine arbeitet.
Ein fatales Mißgeschick hat die Stadt bis jetzt
daran gehindert, auch in der großen Architektur
sich als Führerin und Hüterin lebendigen Kultur-
besitzes zu bewähren. Wien hätte Gelegenheit
gehabt, mit seinen Wohnbauten in größtem
Maßstabe für die neue Baukunst und damit für
den neuen Geist unserer Kultur zu manifestieren.
Die künstlerischen Kräfte standen zur Verfügung,
sie wurden nur ganz ausnahmsweise einmal her-
angezogen. Im übrigen aber hat die Stadt das
soziale Problem allein ernst genommen und so
wider Willen den Beweis geliefert, wieviel
mäßige Architekten es auch heute noch gibt, wie
unsicher die Formensprache noch ist. Das ist nun
nicht mehr zu ändern, und um so erfreulicher ist
es, daß wenigstens mit der Werkbundsiedlung
ein Werk seiner Vollendung entgegengeht, an
dem sich die wahrhaft lebendigen Kräfte der
Wiener Baukunst nicht nur vereinzelt wie bisher,
sondern mit gesammelten Kräften und auf breiter
Front bewähren können.
Sicherlich wird auch diese Siedlung — über
die wir im Frühjahr ausführlich berichten wer-
den — wieder von neuem die tiefe Kluft zeigen,
die unsere Gegenwart von jeder Vergangenheit
trennt. Sie wird aber zugleich eindringlich vor
Augen führen, daß jenseits und diesseits dieser
Kluft Menschen wohnen, deren vitale Struktur im
Grunde die gleiche ist, und daß über die Kluft
Brücken führen, durch die die Kontinuität der
menschlichen Kultur gesichert ist.
74