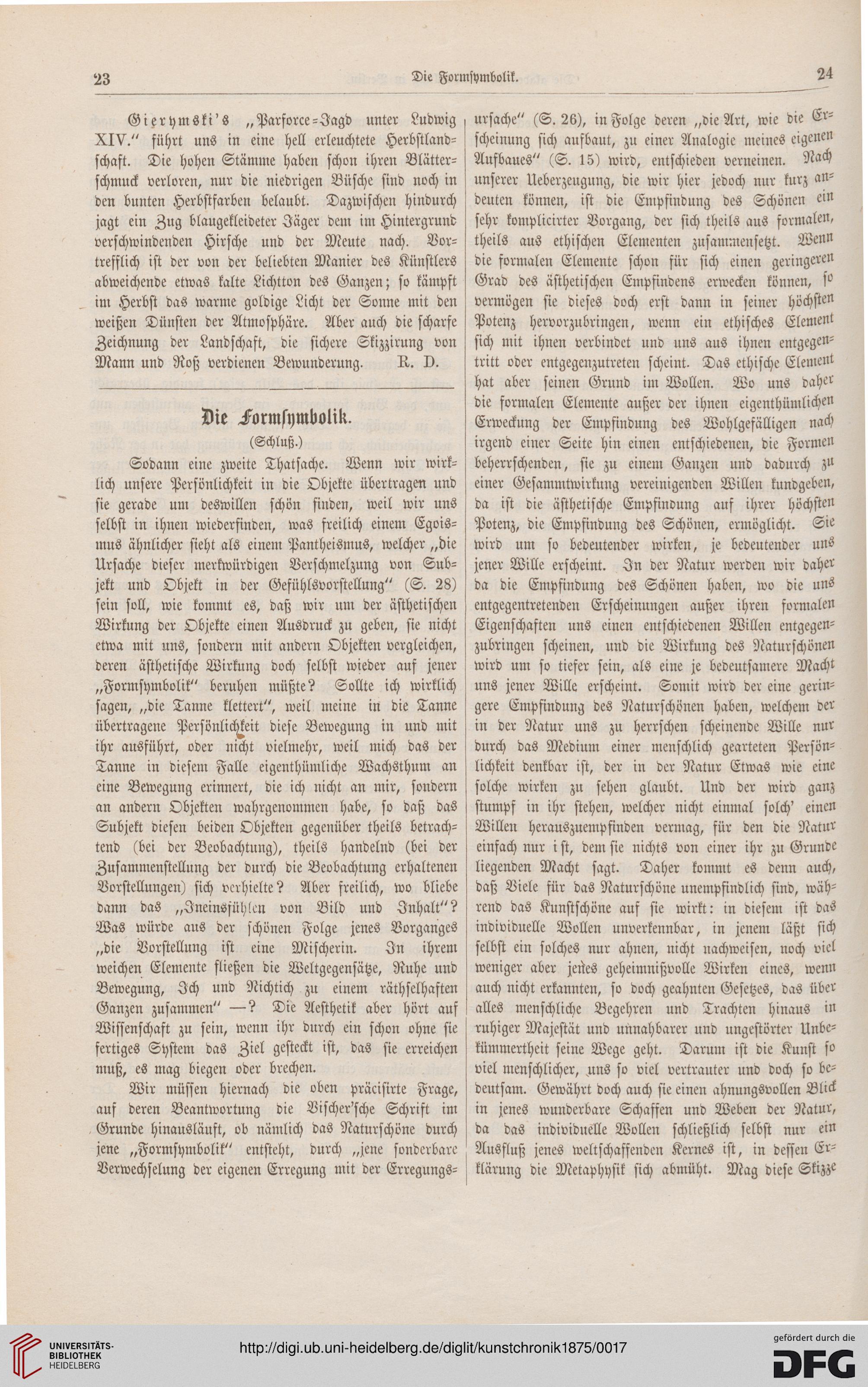23
Die Formsymbolik.
Gierymski's „Parforce-Jagd unter Ludwig
XIV." führt uns in eine hell erleuchtete Herbstland-
schaft. Die hohen Stämme haben schon ihren Blätter-
schmuck verloren, nur die niedrigen Büsche sind noch in
den bunten Herbstfarben belaubt. Dazwischen hindurch
jagt ein Zug blaugekleideter Jäger dem im Hintergrund
verschwindenden Hirsche und der Meute nach. Vor-
trefslich ist der von der beliebten Manier des Künstlers
abweichende etwas kalte Lichtton des Ganzen; so kämpft
im Herbst das warme goldige Licht der Sonne mit den
weißen Dünsten der Atmosphäre. Aber auch die scharfe
Zeichnung der Landschaft, die sichere Skizzirung von
Mann und Roß verdienen Bewunderung. L. v.
Die Formsymbolik.
(Schluß.)
Sodann eine zweite Thatsache. Wenn wir wirk-
lich unsere Persönlichkeit in die Objekte übertragen und
sie gerade um deswillen schön sinden, weil wir uns
selbst in ihnen wiedersinden, was freilich einem Egois-
mus ähnlicher sieht als einem Pantheismus, welcher „die
Ursache dieser merkwürdigen Verschmelzung von Sub-
jekt und Objekt in der Gefühlsvorstellung" (S. 28)
sein soll, wie kommt es, daß wir um der ästhetischen
Wirkung der Objekte einen Ausdruck zu geben, sie nicht
etwa mit uns, sondern mit andern Objekten vergleichen,
deren ästhetische Wirkung doch selbst wieder auf jener
„Formsymbolik" beruhen müßte? Sollte ich wirklich
sagen, „die Tanne klettert", weil meine in die Tanne
übertragene Persönlic^keit diese Bewegung in und mit
ihr ausführt, oder nicht vielmehr, weil mich das der
Tanne in diesem Falle eigenthümliche Wachsthum an
eine Bewegung erinnert, die ich nicht an mir, sondern
an andern Objekten wahrgenommen habe, so daß das
Subjekt diesen beiden Objekten gegenüber theils betrach-
tend (bei der Beobachtung), theils handelnd (bei der
Zusammenstellung der durch die Beobachtung erhaltenen
Vorstellungen) sich vcrhielte? Aber freilich, wo bliebe
dann das „Jneinssühien von Bild und Jnhalt"?
Was würde aus der schönen Folge jenes Vorganges
„die Vorstellung ist eine Mischerin. Än ihrem
weichen Elemente fließen die Weltgegensätze, Ruhe und
Bewegung, Äch und Nichtich zu einem räthselhaften
Ganzen zusammen" —? Die Aesthetik aber hört auf
Wissenschaft zu sein, wenn ihr durch ein schon ohne sie
fertiges System das Ziel gesteckt ist, das sie erreichen
muß, es mag biegen oder brechen.
Wir müssen hiernach die oben präcisirte Frage,
auf deren Beantwortung die Vischer'sche Schrift im
Grunde hinausläuft, ob nämlich das Naturschöne durch
jene „Formsymbolik" entsteht, durch „jene sonderbare
Verwechselung der eigenen Erregung mit der Erregungs-
24
ursache" (S. 26), in Folge deren „vie Art, wie die Er-
scheinung sich aufbaut, zu einer Analogie meines eigenen
Aufbaues" (S. 15) wird, entschieden verneinen. Rach
unserer Ueberzeugung, die wir hier jedoch nur kurz an-
deuten können, ist die Empfindung des Schönen ein
sehr komplicirter Vorgang, der sich theils aus formalen,
theils aus ethischen Elementen zusammensetzt. Wenn
die formalen Elemente schon für sich einen geringeren
Grad des ästhetischen Empfindens erwecken können, se
vermögen sie dieses doch erst dann in seiner höchsten
Potenz hervorzubringen, wenn ein ethisches Element
sich mit ihnen verbindct und uns aus ihnen entgegen-
tritt oder entgegenzutreten scheint. Das ethische Elenient
hat aber seinen Grund im Wollen. Wo uns daher
die formalen Elemente außer der ihnen eigenthümlichen
Erweckung der Empfindung des Wohlgefälligen nach
irgend einer Seite hin einen entschiedenen, die Formen
beherrschenden, sie zu einem Ganzen und dadurch zn
einer Gesammtwirkung vereinigenden Willen kundgeben,
da ist die ästhetische Empfindung auf ihrer höchsten
Potenz, die Empfindung des Schönen, ermöglicht. Sie
wird um so bedeutender wirken, je bedeutender uns
jener Wille erscheint. Jn der Natur werden wir daher
da die Empfindung des Schönen haben, wo die uns
entgegentretendeu Erscheinungen außer ihren formalen
Eigenschasten uns einen entschiedenen Willen entgegen-
zubringen scheinen, und die Wirkung des Naturschönen
wird um so tiefer sein, als eine je bedeutsamere Mackst
uns jener Wille erscheint. Somit wird der eine gerin-
gere Empfindung des Naturschönen haben, welchem der
in der Natur uns zu herrschen schemende Wille nur
durch das Medium einer menschlich gearteten Persön-
lichkeit denkbar ist, der in der Natur Etwas wie eine
solche wirken zu sehen glaubt. Und der wird ganz
stumpf in ihr stehen, welcher nicht einmal solch' einen
Willen herauszuempfinden vermag, für den die Natur
einfach nur i st, dem sie nichts von einer ihr zu Grunde
liegenden Macht sagt. Daher kommt es denn auch,
daß Viele für das Naturschöne unempfindlich sind, wäh-
rend das Kunstschöne auf sie wirkt: in diesem ist das
individuelle Wollen unverkennbar, in jenem läßt sich
selbst ein solches nur ahnen, nicht nachweisen, noch viel
weniger aber jefles geheimnißvolle Wirken eines, wenn
auch nicht erkannten, so doch geahnten Gesetzes, das über
alles menschliche Begehren und Trachten hinaus in
ruhiger Majestät und unnrhbarer und ungestörter Unbe-
kümmertheit seine Wege geht. Darum ist die Kunst sv
viel menschlicher, ^uns so viel vertrauter und doch so be-
deutsam. Gewährt doch auch sie einen ahnungsvollen Blick
in jenes wunderbare Schaffen und Weben der Natur,
da das individuelle Wollen schließlich selbst nur ein
Ausfluß jenes weltschaffenden Kernes ist, in dessen Er-
klärung die Metaphysik sich abmüht. Mag diese Skizze
Die Formsymbolik.
Gierymski's „Parforce-Jagd unter Ludwig
XIV." führt uns in eine hell erleuchtete Herbstland-
schaft. Die hohen Stämme haben schon ihren Blätter-
schmuck verloren, nur die niedrigen Büsche sind noch in
den bunten Herbstfarben belaubt. Dazwischen hindurch
jagt ein Zug blaugekleideter Jäger dem im Hintergrund
verschwindenden Hirsche und der Meute nach. Vor-
trefslich ist der von der beliebten Manier des Künstlers
abweichende etwas kalte Lichtton des Ganzen; so kämpft
im Herbst das warme goldige Licht der Sonne mit den
weißen Dünsten der Atmosphäre. Aber auch die scharfe
Zeichnung der Landschaft, die sichere Skizzirung von
Mann und Roß verdienen Bewunderung. L. v.
Die Formsymbolik.
(Schluß.)
Sodann eine zweite Thatsache. Wenn wir wirk-
lich unsere Persönlichkeit in die Objekte übertragen und
sie gerade um deswillen schön sinden, weil wir uns
selbst in ihnen wiedersinden, was freilich einem Egois-
mus ähnlicher sieht als einem Pantheismus, welcher „die
Ursache dieser merkwürdigen Verschmelzung von Sub-
jekt und Objekt in der Gefühlsvorstellung" (S. 28)
sein soll, wie kommt es, daß wir um der ästhetischen
Wirkung der Objekte einen Ausdruck zu geben, sie nicht
etwa mit uns, sondern mit andern Objekten vergleichen,
deren ästhetische Wirkung doch selbst wieder auf jener
„Formsymbolik" beruhen müßte? Sollte ich wirklich
sagen, „die Tanne klettert", weil meine in die Tanne
übertragene Persönlic^keit diese Bewegung in und mit
ihr ausführt, oder nicht vielmehr, weil mich das der
Tanne in diesem Falle eigenthümliche Wachsthum an
eine Bewegung erinnert, die ich nicht an mir, sondern
an andern Objekten wahrgenommen habe, so daß das
Subjekt diesen beiden Objekten gegenüber theils betrach-
tend (bei der Beobachtung), theils handelnd (bei der
Zusammenstellung der durch die Beobachtung erhaltenen
Vorstellungen) sich vcrhielte? Aber freilich, wo bliebe
dann das „Jneinssühien von Bild und Jnhalt"?
Was würde aus der schönen Folge jenes Vorganges
„die Vorstellung ist eine Mischerin. Än ihrem
weichen Elemente fließen die Weltgegensätze, Ruhe und
Bewegung, Äch und Nichtich zu einem räthselhaften
Ganzen zusammen" —? Die Aesthetik aber hört auf
Wissenschaft zu sein, wenn ihr durch ein schon ohne sie
fertiges System das Ziel gesteckt ist, das sie erreichen
muß, es mag biegen oder brechen.
Wir müssen hiernach die oben präcisirte Frage,
auf deren Beantwortung die Vischer'sche Schrift im
Grunde hinausläuft, ob nämlich das Naturschöne durch
jene „Formsymbolik" entsteht, durch „jene sonderbare
Verwechselung der eigenen Erregung mit der Erregungs-
24
ursache" (S. 26), in Folge deren „vie Art, wie die Er-
scheinung sich aufbaut, zu einer Analogie meines eigenen
Aufbaues" (S. 15) wird, entschieden verneinen. Rach
unserer Ueberzeugung, die wir hier jedoch nur kurz an-
deuten können, ist die Empfindung des Schönen ein
sehr komplicirter Vorgang, der sich theils aus formalen,
theils aus ethischen Elementen zusammensetzt. Wenn
die formalen Elemente schon für sich einen geringeren
Grad des ästhetischen Empfindens erwecken können, se
vermögen sie dieses doch erst dann in seiner höchsten
Potenz hervorzubringen, wenn ein ethisches Element
sich mit ihnen verbindct und uns aus ihnen entgegen-
tritt oder entgegenzutreten scheint. Das ethische Elenient
hat aber seinen Grund im Wollen. Wo uns daher
die formalen Elemente außer der ihnen eigenthümlichen
Erweckung der Empfindung des Wohlgefälligen nach
irgend einer Seite hin einen entschiedenen, die Formen
beherrschenden, sie zu einem Ganzen und dadurch zn
einer Gesammtwirkung vereinigenden Willen kundgeben,
da ist die ästhetische Empfindung auf ihrer höchsten
Potenz, die Empfindung des Schönen, ermöglicht. Sie
wird um so bedeutender wirken, je bedeutender uns
jener Wille erscheint. Jn der Natur werden wir daher
da die Empfindung des Schönen haben, wo die uns
entgegentretendeu Erscheinungen außer ihren formalen
Eigenschasten uns einen entschiedenen Willen entgegen-
zubringen scheinen, und die Wirkung des Naturschönen
wird um so tiefer sein, als eine je bedeutsamere Mackst
uns jener Wille erscheint. Somit wird der eine gerin-
gere Empfindung des Naturschönen haben, welchem der
in der Natur uns zu herrschen schemende Wille nur
durch das Medium einer menschlich gearteten Persön-
lichkeit denkbar ist, der in der Natur Etwas wie eine
solche wirken zu sehen glaubt. Und der wird ganz
stumpf in ihr stehen, welcher nicht einmal solch' einen
Willen herauszuempfinden vermag, für den die Natur
einfach nur i st, dem sie nichts von einer ihr zu Grunde
liegenden Macht sagt. Daher kommt es denn auch,
daß Viele für das Naturschöne unempfindlich sind, wäh-
rend das Kunstschöne auf sie wirkt: in diesem ist das
individuelle Wollen unverkennbar, in jenem läßt sich
selbst ein solches nur ahnen, nicht nachweisen, noch viel
weniger aber jefles geheimnißvolle Wirken eines, wenn
auch nicht erkannten, so doch geahnten Gesetzes, das über
alles menschliche Begehren und Trachten hinaus in
ruhiger Majestät und unnrhbarer und ungestörter Unbe-
kümmertheit seine Wege geht. Darum ist die Kunst sv
viel menschlicher, ^uns so viel vertrauter und doch so be-
deutsam. Gewährt doch auch sie einen ahnungsvollen Blick
in jenes wunderbare Schaffen und Weben der Natur,
da das individuelle Wollen schließlich selbst nur ein
Ausfluß jenes weltschaffenden Kernes ist, in dessen Er-
klärung die Metaphysik sich abmüht. Mag diese Skizze