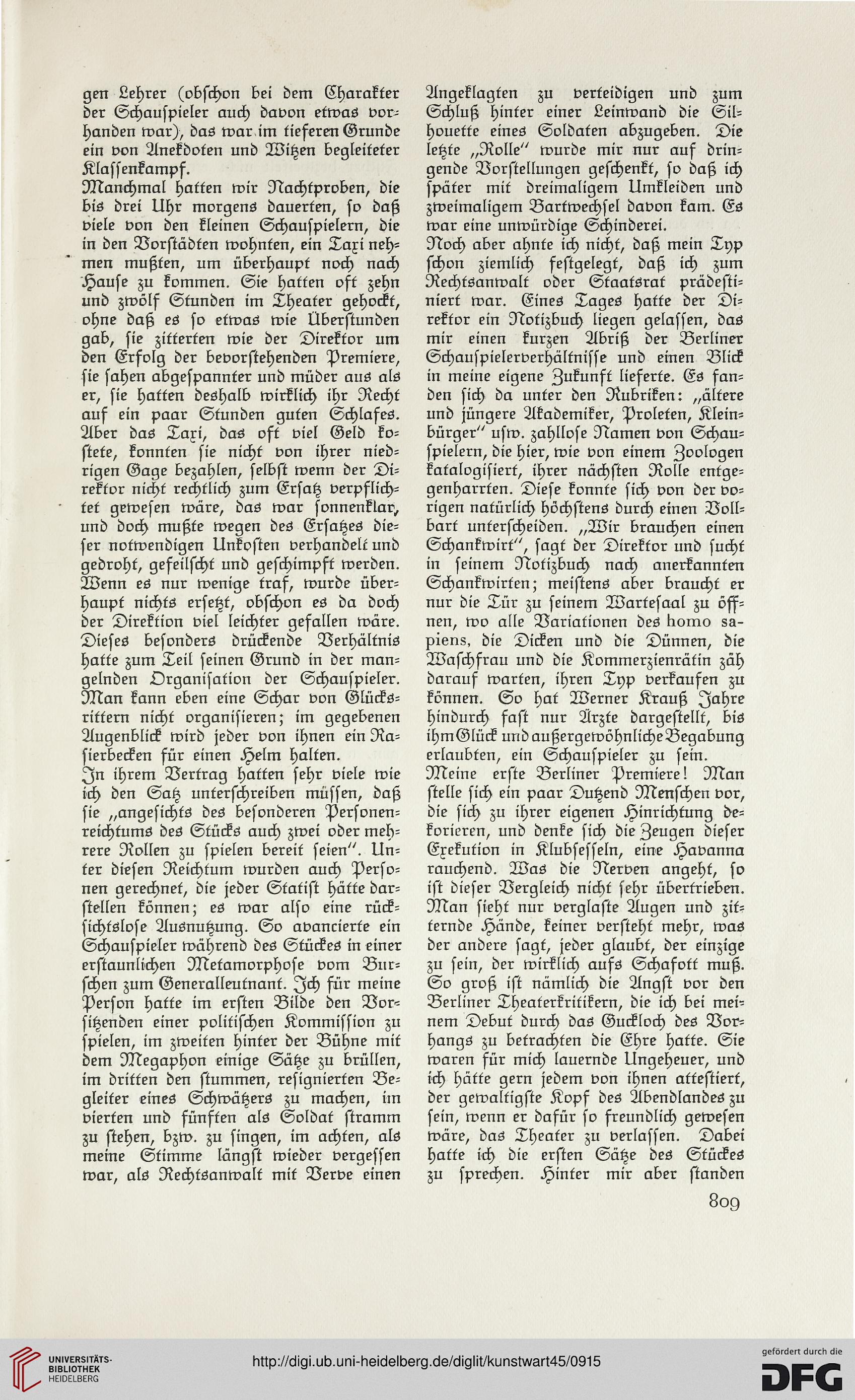gen Lehrer (obschon bei dem Charakter
der Schauspieler auch davon ettvas vor-
handen war), das tvar im tieseren Grunde
ein von Anekdoten und Witzen begleiteter
Klassenkampf.
Manchmal hatten wir Nachtproben, die
bis drei Uhr morgens dauerten, so daß
viele von den kleinen Schauspielern, die
in den Vorstädten wohnten, ein Taxi neh-
men mußten, um überhaupt noch nach
Hause zu kommen. Sie hatten oft zehn
und zwölf Stunden im Theater gehockt,
ohne daß es so etwas wie Uberstunden
gab, sie zitterten wie der Direktor um
den Erfolg der bevorstehenden Premiere,
sie sahen abgespannter und müder aus als
er, sie hatten deshalb wirklich ihr Recht
auf ein paar Stunden guten Schlafes.
Aber das Taxi, das oft viel Geld ko-
stete, konnten sie nicht von ihrer nied-
rigen Gage bezahlen, selbst wenn der Di-
rektor nicht rechtlich zum Ersatz verpflich-
tet gewesen wäre, das war sonnenklar,
und doch mußte wegen des Ersatzes die-
ser notwendigen Unkosten verhandelt und
gedroht, gefeilscht und geschimpft werden.
Wenn es nur wenige traf, wurde über-
haupt nichts ersetzt, obfchon es da doch
der Direktion viel leichter gefallen wäre.
DieseS besonders drückende Verhältnis
hatte zum Teil seinen Grund in der man-
gelnden Organisation der Schauspieler.
Man kann eben eine Schar von Glücks-
rittern nicht organisieren; im gegebenen
Augenblick wird jeder von ihnen ein Ra-
sierbecken für einen Helm halten.
In ihrem Vertrag hatten sehr viele wie
ich den Satz unterfchreiben müssen, daß
sie „angesichts des besonderen Personen-
reichtums des Stücks auch zwei oder meh-
rere Rollen zu spielen bereit seien". Un-
ter diesen Reichtum wurden auch Perso-
nen gerechnet, die jeder Statist hätte dar-
stellen können; es war also eine rück-
sichtslose Ausnutzung. So avancierte ein
Schauspieler während des StückeS in einer
erstaunlichen Metamorphose vom Bur-
schen zum Generalleutnant. Jch für meine
Person hatte im ersten Bilde den Vor-
sitzenden einer politischen Kommission zu
fpielen, im zweiten hinter der Bühne mit
dem Megaphon einige Sätze zu brüllen,
im dritten den stummen, resignierten Be-
gleiter eines Schwätzers zu machen, nn
vierten und fünften als Soldat stramm
zu stehen, bzw. zu singen, im achten, als
meine Stimme längst wieder vergessen
war, als Rechtsanwalt mit Verve einen
Angeklagten zu verteidigen und zum
Schluß hinter einer Leinwand die Sil-
houette eines Soldaten abzugeben. Die
letzte „Rolle" wurde mir nur auf drin-
gende Vorstellungen geschenkt, so daß ich
später mit dreimaligem Llmkleiden und
zweimaligem Bartwechsel davon kam. Es
war eine unwürdige Schinderei.
Noch aber ahnte ich nicht, daß mein Typ
schon ziemlich festgelegt, daß ich zum
RechtSanwalt oder Staatsrat prädesti-
niert war. Eines Tages hatte der Di-
rektor ein Notizbuch liegen gelassen, das
mir einen kurzen Abriß der Berliner
Schauspielerverhältnisse und einen Blick
in meine eigene Zukunft lieferte. Es fan-
den sich da unter den Rubriken: „ältere
und jüngere Akademiker, Proleten, Klein-
bürger" usw. zahllose Namen von Schau-
spielern, die hier, wie von einem Zoologen
katalogisiert, ihrer nächsten Rolle entge-
genharrten. Diese konnte sich von der vo-
rigen natürlich höchstens durch einen Voll-
bart unterscheiden. „Wir brauchen einen
Schankwirt", sagt der Direktor und sucht
in seinem Notizbuch nach anerkannten
Schankwirten; meistens aber braucht er
nur die Tür zu seinem Wartesaal zn ösf-
nen, wo alle Variationen des bomo ss-
piens, die Dicken und die Dünnen, die
Waschfrau und die Kommerzienrätin zäh
darauf warten, ihren Typ verkaufen zu
können. So hat Werner Krauß Jahre
hindurch fast nur Ärzte dargestellt, bis
ihmGlück und außergewöhnlicheBegabung
erlaubten, ein Schauspieler zn sein.
Meine erste Berliner Premiere! Man
stelle sich ein paar Dutzend Menschen vor,
die sich zu ihrer eigenen Hinrichtnng de-
korieren, und denke sich die Zeugen dieser
Exekution in Klubsesseln, eine Havanna
rauchend. Was die Nerven angeht, so
ist dieser Vergleich nicht sehr übertrieben.
Man sieht nur verglaste Augen und zit-
ternde Hände, keiner versteht mehr, was
der andere sagt, jeder glaubt, der einzige
zu sein, der wirklich aufs Schafott muß.
So groß ist nämlich die Angst vor den
Berliner Theaterkritikern, die ich bei mei-
nem Debut durch das Guckloch des Vor-
hangs zu betrachten die Ehre hatte. Sie
waren für mi'ch lauernde blngeheuer, und
ich hätte gern jedem von ihnen attestiert,
der gewaltigste Kopf des Abendlandes zu
sein, wenn er dafür so freundlich gewesen
wäre, das Theater zu verlassen. Dabei
hatte ich die ersten Sätze des Stückes
zu sprechen. Hinter mir aber standen
809
der Schauspieler auch davon ettvas vor-
handen war), das tvar im tieseren Grunde
ein von Anekdoten und Witzen begleiteter
Klassenkampf.
Manchmal hatten wir Nachtproben, die
bis drei Uhr morgens dauerten, so daß
viele von den kleinen Schauspielern, die
in den Vorstädten wohnten, ein Taxi neh-
men mußten, um überhaupt noch nach
Hause zu kommen. Sie hatten oft zehn
und zwölf Stunden im Theater gehockt,
ohne daß es so etwas wie Uberstunden
gab, sie zitterten wie der Direktor um
den Erfolg der bevorstehenden Premiere,
sie sahen abgespannter und müder aus als
er, sie hatten deshalb wirklich ihr Recht
auf ein paar Stunden guten Schlafes.
Aber das Taxi, das oft viel Geld ko-
stete, konnten sie nicht von ihrer nied-
rigen Gage bezahlen, selbst wenn der Di-
rektor nicht rechtlich zum Ersatz verpflich-
tet gewesen wäre, das war sonnenklar,
und doch mußte wegen des Ersatzes die-
ser notwendigen Unkosten verhandelt und
gedroht, gefeilscht und geschimpft werden.
Wenn es nur wenige traf, wurde über-
haupt nichts ersetzt, obfchon es da doch
der Direktion viel leichter gefallen wäre.
DieseS besonders drückende Verhältnis
hatte zum Teil seinen Grund in der man-
gelnden Organisation der Schauspieler.
Man kann eben eine Schar von Glücks-
rittern nicht organisieren; im gegebenen
Augenblick wird jeder von ihnen ein Ra-
sierbecken für einen Helm halten.
In ihrem Vertrag hatten sehr viele wie
ich den Satz unterfchreiben müssen, daß
sie „angesichts des besonderen Personen-
reichtums des Stücks auch zwei oder meh-
rere Rollen zu spielen bereit seien". Un-
ter diesen Reichtum wurden auch Perso-
nen gerechnet, die jeder Statist hätte dar-
stellen können; es war also eine rück-
sichtslose Ausnutzung. So avancierte ein
Schauspieler während des StückeS in einer
erstaunlichen Metamorphose vom Bur-
schen zum Generalleutnant. Jch für meine
Person hatte im ersten Bilde den Vor-
sitzenden einer politischen Kommission zu
fpielen, im zweiten hinter der Bühne mit
dem Megaphon einige Sätze zu brüllen,
im dritten den stummen, resignierten Be-
gleiter eines Schwätzers zu machen, nn
vierten und fünften als Soldat stramm
zu stehen, bzw. zu singen, im achten, als
meine Stimme längst wieder vergessen
war, als Rechtsanwalt mit Verve einen
Angeklagten zu verteidigen und zum
Schluß hinter einer Leinwand die Sil-
houette eines Soldaten abzugeben. Die
letzte „Rolle" wurde mir nur auf drin-
gende Vorstellungen geschenkt, so daß ich
später mit dreimaligem Llmkleiden und
zweimaligem Bartwechsel davon kam. Es
war eine unwürdige Schinderei.
Noch aber ahnte ich nicht, daß mein Typ
schon ziemlich festgelegt, daß ich zum
RechtSanwalt oder Staatsrat prädesti-
niert war. Eines Tages hatte der Di-
rektor ein Notizbuch liegen gelassen, das
mir einen kurzen Abriß der Berliner
Schauspielerverhältnisse und einen Blick
in meine eigene Zukunft lieferte. Es fan-
den sich da unter den Rubriken: „ältere
und jüngere Akademiker, Proleten, Klein-
bürger" usw. zahllose Namen von Schau-
spielern, die hier, wie von einem Zoologen
katalogisiert, ihrer nächsten Rolle entge-
genharrten. Diese konnte sich von der vo-
rigen natürlich höchstens durch einen Voll-
bart unterscheiden. „Wir brauchen einen
Schankwirt", sagt der Direktor und sucht
in seinem Notizbuch nach anerkannten
Schankwirten; meistens aber braucht er
nur die Tür zu seinem Wartesaal zn ösf-
nen, wo alle Variationen des bomo ss-
piens, die Dicken und die Dünnen, die
Waschfrau und die Kommerzienrätin zäh
darauf warten, ihren Typ verkaufen zu
können. So hat Werner Krauß Jahre
hindurch fast nur Ärzte dargestellt, bis
ihmGlück und außergewöhnlicheBegabung
erlaubten, ein Schauspieler zn sein.
Meine erste Berliner Premiere! Man
stelle sich ein paar Dutzend Menschen vor,
die sich zu ihrer eigenen Hinrichtnng de-
korieren, und denke sich die Zeugen dieser
Exekution in Klubsesseln, eine Havanna
rauchend. Was die Nerven angeht, so
ist dieser Vergleich nicht sehr übertrieben.
Man sieht nur verglaste Augen und zit-
ternde Hände, keiner versteht mehr, was
der andere sagt, jeder glaubt, der einzige
zu sein, der wirklich aufs Schafott muß.
So groß ist nämlich die Angst vor den
Berliner Theaterkritikern, die ich bei mei-
nem Debut durch das Guckloch des Vor-
hangs zu betrachten die Ehre hatte. Sie
waren für mi'ch lauernde blngeheuer, und
ich hätte gern jedem von ihnen attestiert,
der gewaltigste Kopf des Abendlandes zu
sein, wenn er dafür so freundlich gewesen
wäre, das Theater zu verlassen. Dabei
hatte ich die ersten Sätze des Stückes
zu sprechen. Hinter mir aber standen
809