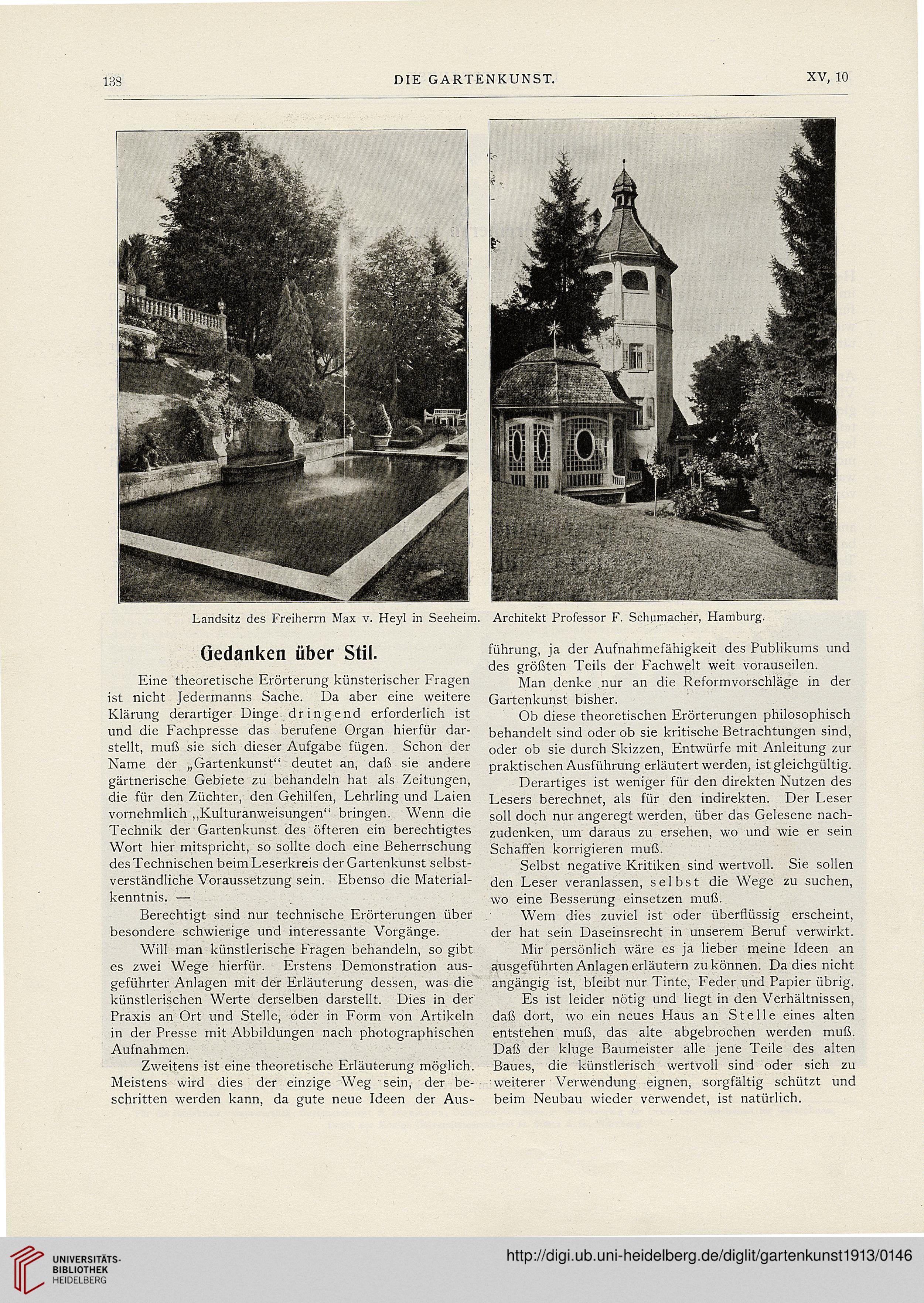Die Gartenkunst — 15.1913
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.28103#0146
DOI Heft:
Nr. 10
DOI Artikel:Rasch, Edgar: Landsitz des Freiherrn Max von Heyl
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.28103#0146
133
DIE GARTENKUNST.
XV, 10
Landsitz des Freiherrn Max v. Heyl in Seeheim. Architekt Professor F. Schumacher, Hamburg.
Gedanken über Stil.
Eine theoretische Erörterung künsterischer Fragen
ist nicht Jedermanns Sache. Da aber eine weitere
Klärung derartiger Dinge dringend erforderlich ist
und die Fachpresse das berufene Organ hierfür dar-
stellt, muß sie sich dieser Aufgabe fügen. Schon der
Name der „Gartenkunst“ deutet an, daß sie andere
gärtnerische Gebiete zu behandeln hat als Zeitungen,
die für den Züchter, den Gehilfen, Lehrling und Laien
vornehmlich „Kulturanweisungen“ bringen. Wenn die
Technik der Gartenkunst des öfteren ein berechtigtes
Wort hier mitspricht, so sollte doch eine Beherrschung
des Technischen beim Leserkreis der Gartenkunst selbst-
verständliche Voraussetzung sein. Ebenso die Material-
kenntnis. —
Berechtigt sind nur technische Erörterungen über
besondere schwierige und interessante Vorgänge.
Will man künstlerische Fragen behandeln, so gibt
es zwei Wege hierfür. Erstens Demonstration aus-
geführter Anlagen mit der Erläuterung dessen, was die
künstlerischen Werte derselben darstellt. Dies in der
Praxis an Ort und Stelle, oder in Form von Artikeln
in der Presse mit Abbildungen nach photographischen
Aufnahmen.
Zweitens ist eine theoretische Erläuterung möglich.
Meistens wird dies der einzige Weg sein, der be-
schritten werden kann, da gute neue Ideen der Aus-
führung, ja der Aufnahmefähigkeit des Publikums und
des größten Teils der Fachwelt weit vorauseilen.
Man denke nur an die Reform Vorschläge in der
Gartenkunst bisher.
Ob diese theoretischen Erörterungen philosophisch
behandelt sind oder ob sie kritische Betrachtungen sind,
oder ob sie durch Skizzen, Entwürfe mit Anleitung zur
praktischen Ausführung erläutert werden, ist gleichgültig.
Derartiges ist weniger für den direkten Nutzen des
Lesers berechnet, als für den indirekten. Der Leser
soll doch nur angeregt werden, über das Gelesene nach-
zudenken, um daraus zu ersehen, wo und wie er sein
Schaffen korrigieren muß.
Selbst negative Kritiken sind wertvoll. Sie sollen
den Leser veranlassen, selbst die Wege zu suchen,
wo eine Besserung einsetzen muß.
Wem dies zuviel ist oder überflüssig erscheint,
der hat sein Daseinsrecht in unserem Beruf verwirkt.
Mir persönlich wäre es ja lieber meine Ideen an
ausgeführten Anlagen erläutern zu können. Da dies nicht
angängig ist, bleibt nur Tinte, Feder und Papier übrig.
Es ist leider nötig und liegt in den Verhältnissen,
daß dort, wo ein neues Haus an Stelle eines alten
entstehen muß, das alte abgebrochen werden muß.
Daß der kluge Baumeister alle jene Teile des alten
Baues, die künstlerisch wertvoll sind oder sich zu
weiterer Verwendung eignen, sorgfältig schützt und
beim Neubau wieder verwendet, ist natürlich.
DIE GARTENKUNST.
XV, 10
Landsitz des Freiherrn Max v. Heyl in Seeheim. Architekt Professor F. Schumacher, Hamburg.
Gedanken über Stil.
Eine theoretische Erörterung künsterischer Fragen
ist nicht Jedermanns Sache. Da aber eine weitere
Klärung derartiger Dinge dringend erforderlich ist
und die Fachpresse das berufene Organ hierfür dar-
stellt, muß sie sich dieser Aufgabe fügen. Schon der
Name der „Gartenkunst“ deutet an, daß sie andere
gärtnerische Gebiete zu behandeln hat als Zeitungen,
die für den Züchter, den Gehilfen, Lehrling und Laien
vornehmlich „Kulturanweisungen“ bringen. Wenn die
Technik der Gartenkunst des öfteren ein berechtigtes
Wort hier mitspricht, so sollte doch eine Beherrschung
des Technischen beim Leserkreis der Gartenkunst selbst-
verständliche Voraussetzung sein. Ebenso die Material-
kenntnis. —
Berechtigt sind nur technische Erörterungen über
besondere schwierige und interessante Vorgänge.
Will man künstlerische Fragen behandeln, so gibt
es zwei Wege hierfür. Erstens Demonstration aus-
geführter Anlagen mit der Erläuterung dessen, was die
künstlerischen Werte derselben darstellt. Dies in der
Praxis an Ort und Stelle, oder in Form von Artikeln
in der Presse mit Abbildungen nach photographischen
Aufnahmen.
Zweitens ist eine theoretische Erläuterung möglich.
Meistens wird dies der einzige Weg sein, der be-
schritten werden kann, da gute neue Ideen der Aus-
führung, ja der Aufnahmefähigkeit des Publikums und
des größten Teils der Fachwelt weit vorauseilen.
Man denke nur an die Reform Vorschläge in der
Gartenkunst bisher.
Ob diese theoretischen Erörterungen philosophisch
behandelt sind oder ob sie kritische Betrachtungen sind,
oder ob sie durch Skizzen, Entwürfe mit Anleitung zur
praktischen Ausführung erläutert werden, ist gleichgültig.
Derartiges ist weniger für den direkten Nutzen des
Lesers berechnet, als für den indirekten. Der Leser
soll doch nur angeregt werden, über das Gelesene nach-
zudenken, um daraus zu ersehen, wo und wie er sein
Schaffen korrigieren muß.
Selbst negative Kritiken sind wertvoll. Sie sollen
den Leser veranlassen, selbst die Wege zu suchen,
wo eine Besserung einsetzen muß.
Wem dies zuviel ist oder überflüssig erscheint,
der hat sein Daseinsrecht in unserem Beruf verwirkt.
Mir persönlich wäre es ja lieber meine Ideen an
ausgeführten Anlagen erläutern zu können. Da dies nicht
angängig ist, bleibt nur Tinte, Feder und Papier übrig.
Es ist leider nötig und liegt in den Verhältnissen,
daß dort, wo ein neues Haus an Stelle eines alten
entstehen muß, das alte abgebrochen werden muß.
Daß der kluge Baumeister alle jene Teile des alten
Baues, die künstlerisch wertvoll sind oder sich zu
weiterer Verwendung eignen, sorgfältig schützt und
beim Neubau wieder verwendet, ist natürlich.