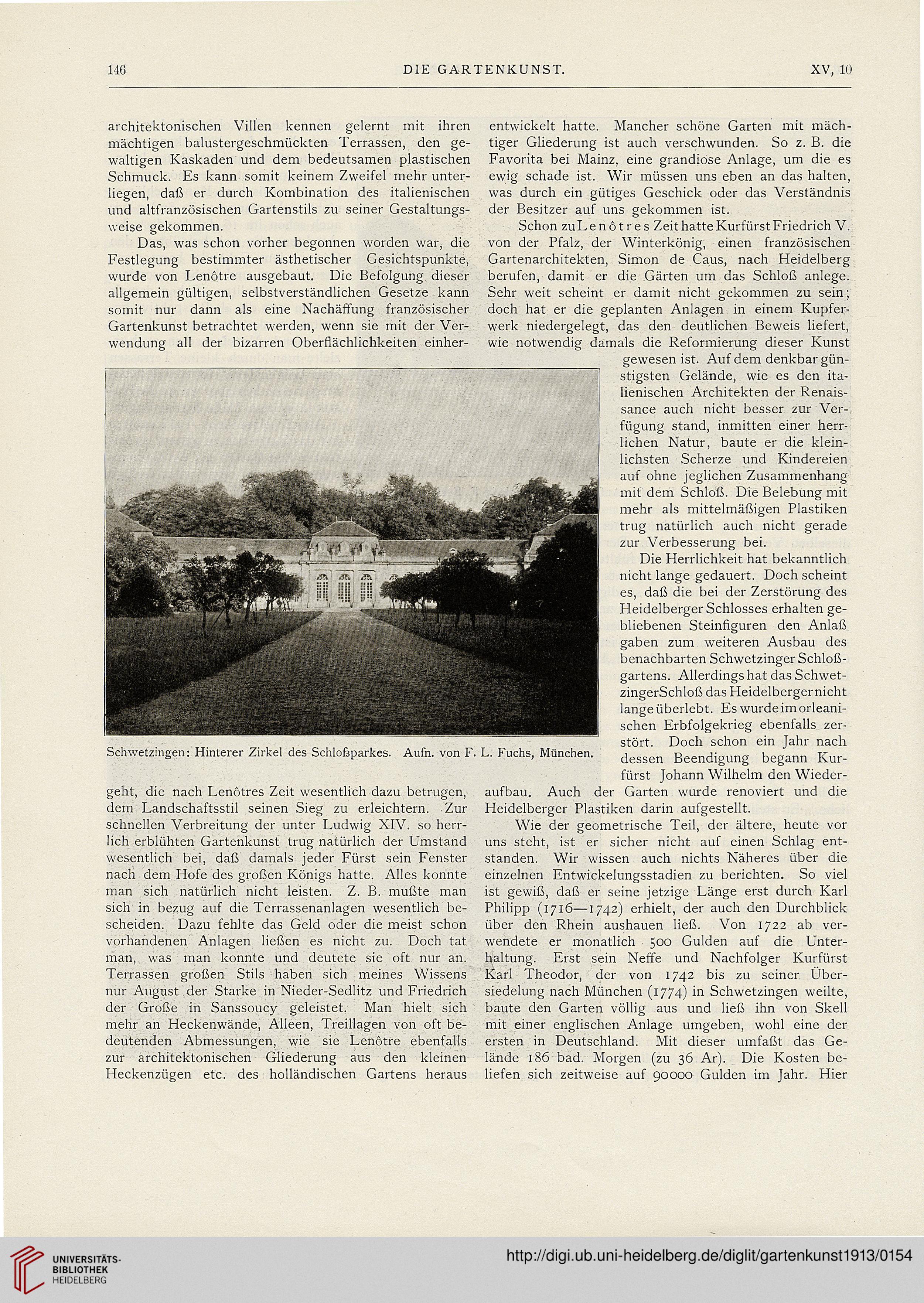146
DIE GARTENKUNST.
XV, 10
architektonischen Villen kennen gelernt mit ihren
mächtigen balustergeschmückten Terrassen, den ge-
waltigen Kaskaden und dem bedeutsamen plastischen
Schmuck. Es kann somit keinem Zweifel mehr unter-
liegen, daß er durch Kombination des italienischen
und altfranzösischen Gartenstils zu seiner Gestaltungs-
weise gekommen.
Das, was schon vorher begonnen worden war, die
Festlegung bestimmter ästhetischer Gesichtspunkte,
wurde von Lenotre ausgebaut. Die Befolgung dieser
allgemein gültigen, selbstverständlichen Gesetze kann
somit nur dann als eine Nachäffung französischer
Gartenkunst betrachtet werden, wenn sie mit der Ver-
wendung all der bizarren Oberflächlichkeiten einher-
geht, die nach Lenötres Zeit wesentlich dazu betrugen,
dem Landschaftsstil seinen Sieg zu erleichtern. Zur
schnellen Verbreitung der unter Ludwig XIV. so herr-
lich erblühten Gartenkunst trug natürlich der Umstand
wesentlich bei, daß damals jeder Fürst sein Fenster
nach dem Hofe des großen Königs hatte. Alles konnte
man sich natürlich nicht leisten. Z. B. mußte man
sich in bezug auf die Terrassenanlagen wesentlich be-
scheiden. Dazu fehlte das Geld oder die meist schon
vorhandenen Anlagen ließen es nicht zu. Doch tat
man, was man konnte und deutete sie oft nur an.
Terrassen großen Stils haben sich meines Wissens
nur August der Starke in Nieder-Sedlitz und Friedrich
der Große in Sanssoucy geleistet. Man hielt sich
mehr an Heckenwände, Alleen, Treillagen von oft be-
deutenden Abmessungen, wie sie Lenotre ebenfalls
zur architektonischen Gliederung aus den kleinen
Heckenzügen etc. des holländischen Gartens heraus
entwickelt hatte. Mancher schöne Garten mit mäch-
tiger Gliederung ist auch verschwunden. So z. B. die
Favorita bei Mainz, eine grandiose Anlage, um die es
ewig schade ist. Wir müssen uns eben an das halten,
was durch ein gütiges Geschick oder das Verständnis
der Besitzer auf uns gekommen ist.
Schon zuLenotres Zeit hatte Kurfürst Friedrich V.
von der Pfalz, der Winterkönig, einen französischen
Gartenarchitekten, Simon de Caus, nach Heidelberg
berufen, damit er die Gärten um das Schloß anlege.
Sehr weit scheint er damit nicht gekommen zu sein;
doch hat er die geplanten Anlagen in einem Kupfer-
werk niedergelegt, das den deutlichen Beweis liefert,
wie notwendig damals die Reformierung dieser Kunst
gewesen ist. Auf dem denkbar gün-
stigsten Gelände, wie es den ita-
lienischen Architekten der Renais-,
sance auch nicht besser zur Ver-
fügung stand, inmitten einer herr-
lichen Natur, baute er die klein-
lichsten Scherze und Kindereien
auf ohne jeglichen Zusammenhang
mit dem Schloß. Die Belebung mit
mehr als mittelmäßigen Plastiken
trug natürlich auch nicht gerade
zur Verbesserung bei.
Die Herrlichkeit hat bekanntlich
nicht lange gedauert. Doch scheint
es, daß die bei der Zerstörung des
Heidelberger Schlosses erhalten ge-
bliebenen Steinfiguren den Anlaß
gaben zum weiteren Ausbau des
benachbarten Schwetzinger Schloß-
gartens. Allerdings hat das Schwet-
zingerSchloß das Heidelbergernicht
lange überlebt. Es wurde im orkani-
schen Erbfolgekrieg ebenfalls zer-
stört. Doch schon ein Jahr nach
dessen Beendigung begann Kur-
fürst Johann Wilhelm den Wieder-
aufbau. Auch der Garten wurde renoviert und die
Heidelberger Plastiken darin aufgestellt.
Wie der geometrische Teil, der ältere, heute vor
uns steht, ist er sicher nicht auf einen Schlag ent-
standen. Wir wissen auch nichts Näheres über die
einzelnen Entwickelungsstadien zu berichten. So viel
ist gewiß, daß er seine jetzige Länge erst durch Karl
Philipp (1716—1742) erhielt, der auch den Durchblick
über den Rhein aushauen ließ. Von 1722 ab ver-
wendete er monatlich 500 Gulden auf die Unter-
haltung. Erst sein Neffe und Nachfolger Kurfürst
Karl Theodor, der von 1742 bis zu seiner Über-
siedelung nach München (1774) in Schwetzingen weilte,
baute den Garten völlig aus und ließ ihn von Skell
mit einer englischen Anlage umgeben, wohl eine der
ersten in Deutschland. Mit dieser umfaßt das Ge-
lände 186 bad. Morgen (zu 36 Ar). Die Kosten be-
liefen sich zeitweise auf 90000 Gulden im Jahr. Hier
Schwetzingen: Hinterer Zirkel des Schloßparkes. Aufn. von F. L. Fuchs, München.
DIE GARTENKUNST.
XV, 10
architektonischen Villen kennen gelernt mit ihren
mächtigen balustergeschmückten Terrassen, den ge-
waltigen Kaskaden und dem bedeutsamen plastischen
Schmuck. Es kann somit keinem Zweifel mehr unter-
liegen, daß er durch Kombination des italienischen
und altfranzösischen Gartenstils zu seiner Gestaltungs-
weise gekommen.
Das, was schon vorher begonnen worden war, die
Festlegung bestimmter ästhetischer Gesichtspunkte,
wurde von Lenotre ausgebaut. Die Befolgung dieser
allgemein gültigen, selbstverständlichen Gesetze kann
somit nur dann als eine Nachäffung französischer
Gartenkunst betrachtet werden, wenn sie mit der Ver-
wendung all der bizarren Oberflächlichkeiten einher-
geht, die nach Lenötres Zeit wesentlich dazu betrugen,
dem Landschaftsstil seinen Sieg zu erleichtern. Zur
schnellen Verbreitung der unter Ludwig XIV. so herr-
lich erblühten Gartenkunst trug natürlich der Umstand
wesentlich bei, daß damals jeder Fürst sein Fenster
nach dem Hofe des großen Königs hatte. Alles konnte
man sich natürlich nicht leisten. Z. B. mußte man
sich in bezug auf die Terrassenanlagen wesentlich be-
scheiden. Dazu fehlte das Geld oder die meist schon
vorhandenen Anlagen ließen es nicht zu. Doch tat
man, was man konnte und deutete sie oft nur an.
Terrassen großen Stils haben sich meines Wissens
nur August der Starke in Nieder-Sedlitz und Friedrich
der Große in Sanssoucy geleistet. Man hielt sich
mehr an Heckenwände, Alleen, Treillagen von oft be-
deutenden Abmessungen, wie sie Lenotre ebenfalls
zur architektonischen Gliederung aus den kleinen
Heckenzügen etc. des holländischen Gartens heraus
entwickelt hatte. Mancher schöne Garten mit mäch-
tiger Gliederung ist auch verschwunden. So z. B. die
Favorita bei Mainz, eine grandiose Anlage, um die es
ewig schade ist. Wir müssen uns eben an das halten,
was durch ein gütiges Geschick oder das Verständnis
der Besitzer auf uns gekommen ist.
Schon zuLenotres Zeit hatte Kurfürst Friedrich V.
von der Pfalz, der Winterkönig, einen französischen
Gartenarchitekten, Simon de Caus, nach Heidelberg
berufen, damit er die Gärten um das Schloß anlege.
Sehr weit scheint er damit nicht gekommen zu sein;
doch hat er die geplanten Anlagen in einem Kupfer-
werk niedergelegt, das den deutlichen Beweis liefert,
wie notwendig damals die Reformierung dieser Kunst
gewesen ist. Auf dem denkbar gün-
stigsten Gelände, wie es den ita-
lienischen Architekten der Renais-,
sance auch nicht besser zur Ver-
fügung stand, inmitten einer herr-
lichen Natur, baute er die klein-
lichsten Scherze und Kindereien
auf ohne jeglichen Zusammenhang
mit dem Schloß. Die Belebung mit
mehr als mittelmäßigen Plastiken
trug natürlich auch nicht gerade
zur Verbesserung bei.
Die Herrlichkeit hat bekanntlich
nicht lange gedauert. Doch scheint
es, daß die bei der Zerstörung des
Heidelberger Schlosses erhalten ge-
bliebenen Steinfiguren den Anlaß
gaben zum weiteren Ausbau des
benachbarten Schwetzinger Schloß-
gartens. Allerdings hat das Schwet-
zingerSchloß das Heidelbergernicht
lange überlebt. Es wurde im orkani-
schen Erbfolgekrieg ebenfalls zer-
stört. Doch schon ein Jahr nach
dessen Beendigung begann Kur-
fürst Johann Wilhelm den Wieder-
aufbau. Auch der Garten wurde renoviert und die
Heidelberger Plastiken darin aufgestellt.
Wie der geometrische Teil, der ältere, heute vor
uns steht, ist er sicher nicht auf einen Schlag ent-
standen. Wir wissen auch nichts Näheres über die
einzelnen Entwickelungsstadien zu berichten. So viel
ist gewiß, daß er seine jetzige Länge erst durch Karl
Philipp (1716—1742) erhielt, der auch den Durchblick
über den Rhein aushauen ließ. Von 1722 ab ver-
wendete er monatlich 500 Gulden auf die Unter-
haltung. Erst sein Neffe und Nachfolger Kurfürst
Karl Theodor, der von 1742 bis zu seiner Über-
siedelung nach München (1774) in Schwetzingen weilte,
baute den Garten völlig aus und ließ ihn von Skell
mit einer englischen Anlage umgeben, wohl eine der
ersten in Deutschland. Mit dieser umfaßt das Ge-
lände 186 bad. Morgen (zu 36 Ar). Die Kosten be-
liefen sich zeitweise auf 90000 Gulden im Jahr. Hier
Schwetzingen: Hinterer Zirkel des Schloßparkes. Aufn. von F. L. Fuchs, München.