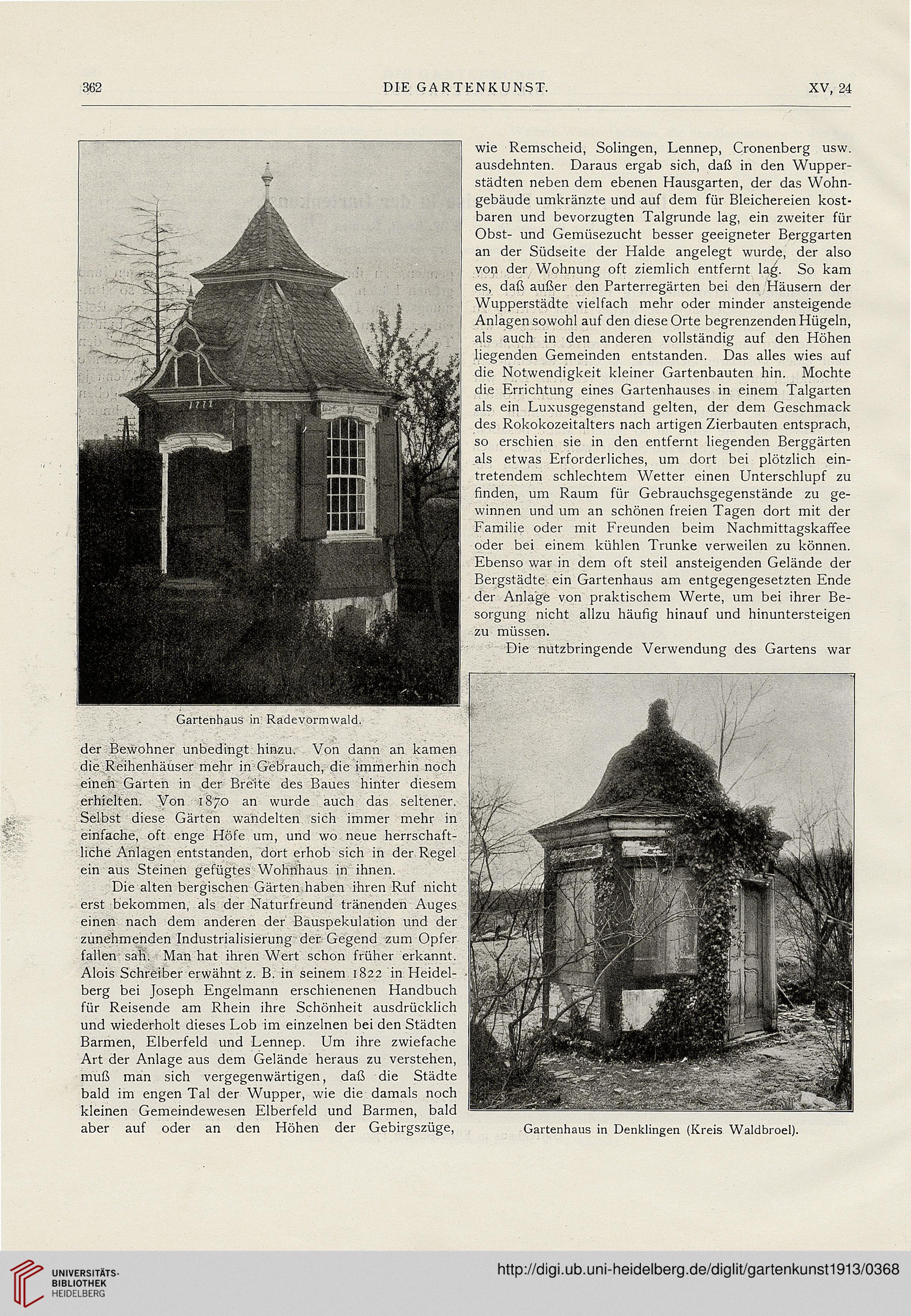Die Gartenkunst — 15.1913
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.28103#0368
DOI Heft:
Nr. 24
DOI Artikel:Bredt, Friedrich W.: Die bergische Bauweise in der Gartenkunst
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.28103#0368
362
DIE GARTENKUNST.
XV, 24
Gartenhaus in Radevormwaid.
der Bewohner unbedingt hinzu. Von dann an kamen
die Reihenhäuser mehr in Gebrauch, die immerhin noch
einen Garten in der Breite des Baues hinter diesem
erhielten. Von 1870 an wurde auch das seltener.
Selbst diese Gärten wandelten sich immer mehr in
einfache, oft enge Hofe um, und wo neue herrschaft-
liche Anlagen entstanden, dort erhob sich in der Regel
ein aus Steinen gefügtes Wohnhaus in ihnen.
Die alten bergischen Gärten haben ihren Ruf nicht
erst bekommen, als der Naturfreund tränenden Auges
einen nach dem anderen der Bauspekulation und der
zunehmenden Industrialisierung der Gegend zum Opfer
fallen sah. Man hat ihren Wert schon früher erkannt.
Alois Schreiber erwähnt z. B. in seinem 1822 in Heidel-
berg bei Joseph Engelmann erschienenen Handbuch
für Reisende am Rhein ihre Schönheit ausdrücklich
und wiederholt dieses Lob im einzelnen bei den Städten
Barmen, Elberfeld und Lennep. Um ihre zwiefache
Art der Anlage aus dem Gelände heraus zu verstehen,
muß man sich vergegenwärtigen, daß die Städte
bald im engen Tal der Wupper, wie die damals noch
kleinen Gemeindewesen Elberfeld und Barmen, bald
aber auf oder an den Höhen der Gebirgszüge,
wie Remscheid, Solingen, Lennep, Cronenberg usw.
ausdehnten. Daraus ergab sich, daß in den Wupper-
städten neben dem ebenen Hausgarten, der das Wohn-
gebäude umkränzte und auf dem für Bleichereien kost-
baren und bevorzugten Talgrunde lag, ein zweiter für
Obst- und Gemüsezucht besser geeigneter Berggarten
an der Südseite der Halde angelegt wurde, der also
von der Wohnung oft ziemlich entfernt lag. So kam
es, daß außer den Parterregärten bei den Häusern der
Wupperstädte vielfach mehr oder minder ansteigende
Anlagen sowohl auf den diese Orte begrenzenden Hügeln,
als auch in den anderen vollständig auf den Höhen
liegenden Gemeinden entstanden. Das alles wies auf
die Notwendigkeit kleiner Gartenbauten hin. Mochte
die Errichtung eines Gartenhauses in einem Talgarten
als ein Luxusgegenstand gelten, der dem Geschmack
des Rokokozeitalters nach artigen Zierbauten entsprach,
so erschien sie in den entfernt liegenden Berggärten
als etwas Erforderliches, um dort bei plötzlich ein-
tretendem schlechtem Wetter einen Unterschlupf zu
finden, um Raum für Gebrauchsgegenstände zu ge-
winnen und um an schönen freien Tagen dort mit der
Familie oder mit Freunden beim Nachmittagskaffee
oder bei einem kühlen Trünke verweilen zu können.
Ebenso war in dem oft steil ansteigenden Gelände der
Bergstädte ein Gartenhaus am entgegengesetzten Ende
der Anlage von praktischem Werte, um bei ihrer Be-
sorgung nicht allzu häufig hinauf und hinuntersteigen
zu müssen.
Die nutzbringende Verwendung des Gartens war
Gartenhaus in Denklingen (Kreis Waldbroel).
DIE GARTENKUNST.
XV, 24
Gartenhaus in Radevormwaid.
der Bewohner unbedingt hinzu. Von dann an kamen
die Reihenhäuser mehr in Gebrauch, die immerhin noch
einen Garten in der Breite des Baues hinter diesem
erhielten. Von 1870 an wurde auch das seltener.
Selbst diese Gärten wandelten sich immer mehr in
einfache, oft enge Hofe um, und wo neue herrschaft-
liche Anlagen entstanden, dort erhob sich in der Regel
ein aus Steinen gefügtes Wohnhaus in ihnen.
Die alten bergischen Gärten haben ihren Ruf nicht
erst bekommen, als der Naturfreund tränenden Auges
einen nach dem anderen der Bauspekulation und der
zunehmenden Industrialisierung der Gegend zum Opfer
fallen sah. Man hat ihren Wert schon früher erkannt.
Alois Schreiber erwähnt z. B. in seinem 1822 in Heidel-
berg bei Joseph Engelmann erschienenen Handbuch
für Reisende am Rhein ihre Schönheit ausdrücklich
und wiederholt dieses Lob im einzelnen bei den Städten
Barmen, Elberfeld und Lennep. Um ihre zwiefache
Art der Anlage aus dem Gelände heraus zu verstehen,
muß man sich vergegenwärtigen, daß die Städte
bald im engen Tal der Wupper, wie die damals noch
kleinen Gemeindewesen Elberfeld und Barmen, bald
aber auf oder an den Höhen der Gebirgszüge,
wie Remscheid, Solingen, Lennep, Cronenberg usw.
ausdehnten. Daraus ergab sich, daß in den Wupper-
städten neben dem ebenen Hausgarten, der das Wohn-
gebäude umkränzte und auf dem für Bleichereien kost-
baren und bevorzugten Talgrunde lag, ein zweiter für
Obst- und Gemüsezucht besser geeigneter Berggarten
an der Südseite der Halde angelegt wurde, der also
von der Wohnung oft ziemlich entfernt lag. So kam
es, daß außer den Parterregärten bei den Häusern der
Wupperstädte vielfach mehr oder minder ansteigende
Anlagen sowohl auf den diese Orte begrenzenden Hügeln,
als auch in den anderen vollständig auf den Höhen
liegenden Gemeinden entstanden. Das alles wies auf
die Notwendigkeit kleiner Gartenbauten hin. Mochte
die Errichtung eines Gartenhauses in einem Talgarten
als ein Luxusgegenstand gelten, der dem Geschmack
des Rokokozeitalters nach artigen Zierbauten entsprach,
so erschien sie in den entfernt liegenden Berggärten
als etwas Erforderliches, um dort bei plötzlich ein-
tretendem schlechtem Wetter einen Unterschlupf zu
finden, um Raum für Gebrauchsgegenstände zu ge-
winnen und um an schönen freien Tagen dort mit der
Familie oder mit Freunden beim Nachmittagskaffee
oder bei einem kühlen Trünke verweilen zu können.
Ebenso war in dem oft steil ansteigenden Gelände der
Bergstädte ein Gartenhaus am entgegengesetzten Ende
der Anlage von praktischem Werte, um bei ihrer Be-
sorgung nicht allzu häufig hinauf und hinuntersteigen
zu müssen.
Die nutzbringende Verwendung des Gartens war
Gartenhaus in Denklingen (Kreis Waldbroel).