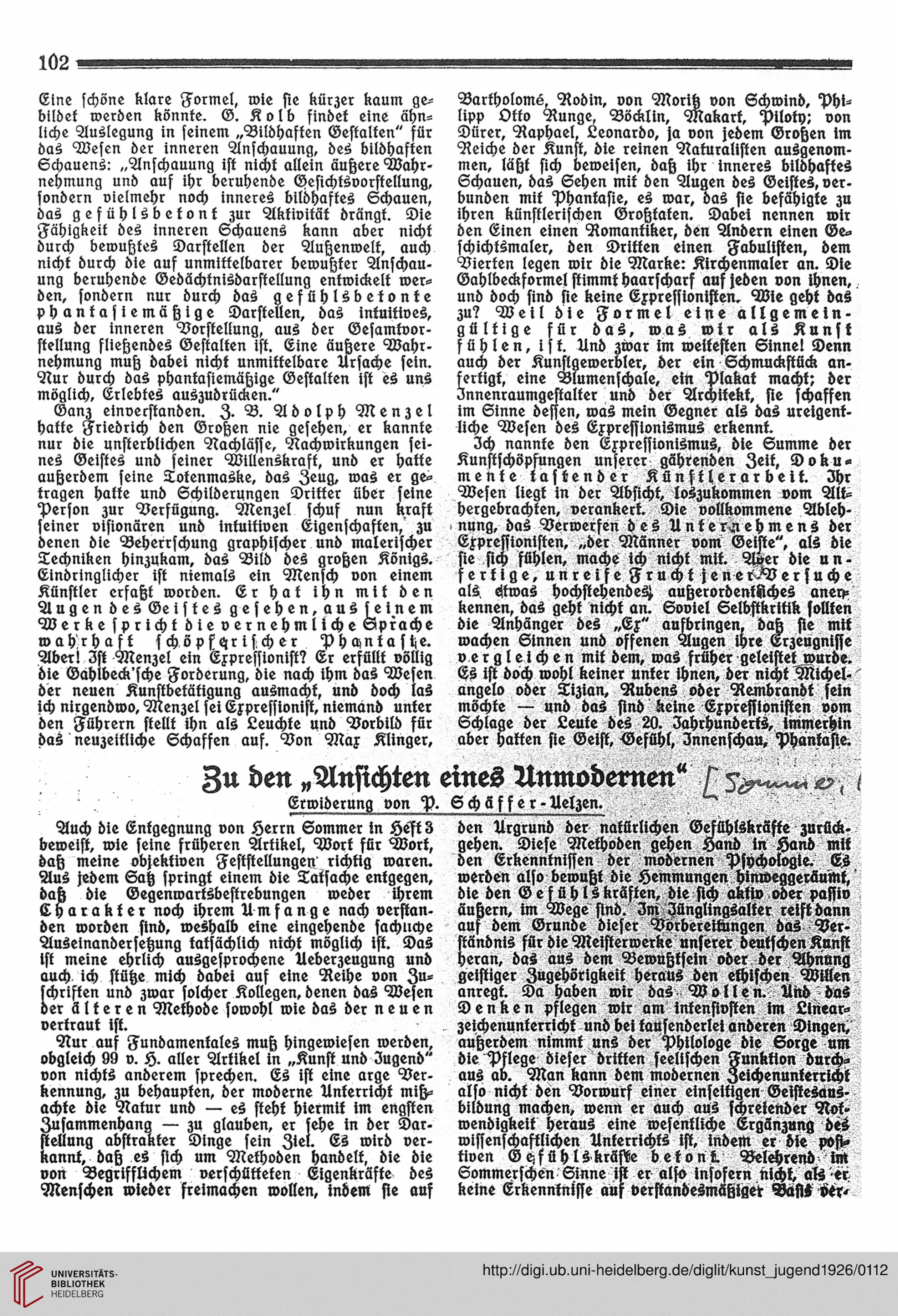102
Elne schöne klare Formel, wie sie kürzer kaum ge-
bildek werden könnte. G. Kolb findek eine ähn-
liche Auslegung in seinem „Bildhafken Gestalten" für
das Wesen der inneren Anschauung, des bildhaften
Echauens: „Anschauung ist nicht allein äußere Mahr-
nehmung und auf ihr beruhende Gesichtsvorstellung,
sondern vielmehr noch inneres bildhaftes Schauen,
öas gefühlsbekont zur Aktivität drängt. Die
Fähigkeit des inneren Schauens kann aber nicht
durch bewußtes Darstellen der Außenwelk, auch
nichk durch die auf unmittelbarer bewußter Anschau-
ung beruhende Gedächtnisdarstellung entwickelt wer-
den, sondern nur durch das gefühlsbetonte
phantasiemäßige Darstellen, das intuitives,
aus der inneren Borstellung, aus der Gesamtvor-
stellung fließendes Gestalten ist. Eine äuhere Wahr-
nehmung mutz dabei nicht unmittelbare Ursache sein.
Nur durch das phantasiemähige Gestalten ist es uns
möglich, Erlebtes auszudrücken."
Ganz einverstanden. Z. B. Adolph Menzel
hatte Friedrich den Großen nie gesehen, er kannke
nur die unsterblichen Nachlässe, Nachwirkungen sei-
nes Geistes und seiner Wtllenskrafk, und er hatte
außerdem seine Totenmaske, das Zeug, was er ge°
tragen hatte und Schilderungen Dritter über seine
Person zur Berfügung. Menzel schuf nun kraft
seiner vistonären und intuitiven Eigenschafien, zu
denen die Beherrschung graphischer und malerischer
Techniken hinzukam, das Bild des großen Königs.
Eindringlicher ist niemals ein Mensch von einem
Künstler erfaßt worden. Er hat ihn mit den
Augen des Geistes gesehen, aus seinem
Werke spricht die vernehmliche Sprache
wahrhaft s ch ö p sqr i sch er Phqntasije.
Aber! 3st Menzel ein Expressiontst? Er erfüllt völlig
die Gählbeck'sche Forderung, die nach ihm das Wesen
der neuen Kunslbetätigung ausmacht, und doch las
ich nirgendwo, Menzel sei Expressionist, niemänd unter
den Führern stellt ihn als Leuchke und Borbilü für
das neuzeitliche Schaffen auf. Bon Max Klinger,
Bartholomä, Rodin, von Moritz von Schwind, Phi-
lipp Otto Runge, Böcklin, Makart, Piloty: von
Dürer, Aaphael, Leonardo, ja von jedem Großen im
Reiche der Kunst, dte reinen Nakuralisten ausgenom-
men, läht sich beweisen, daß ihr inneres bildhaftes
Schauen, das Sehen mit den Augen des Geistes, ver-
bunden mik Phankasie, es war, das sie befähigte zu
ihren künstlerischen Großkaken. Dabei nennen wir
den Einen einen Romantiker, den Andern einen Ge--
schichtsmaler, den Drltten einen Fabulisten, dem
Dierten legen wir die Marke: Kirchenmaler an. Dle
Gahlbeckformel stimmt haarscharf auf jeden von ihnen,
und doch sind sie keine Expressionisten. Wie geht das
zu? Meil die Formel elne allgemein-
gültige für das, was wtr als Kunst
fühlen, isk. Und ztvar im weikesten Sinnel Denn
auch der Künstgewerbler, der ein Schmuckstück an-
fertigt, eine Blumenschale, ein PlaKat macht; der
ännenraumgestalter und der Architekt, sie schaffen
im Sinne dessen» was mein Gegner als das ureigent-
liche Wesen des Expressionismus erkennt.
3ch nannte den Expressionismus, die Summe der
Kunstschöpfungen unserer gährenden Zeit, Doku--
mente tastender Künftlerarbeit. 3hr
Wesen liegt in der Absicht, loszukommen vom Alt-
hergebrachten, verankerk. Die vollkommene Ableh-
nung, das Berwerfen d es Ankerüehmens der
Expressionisten, ,>der Männer vom Geiste", als die
sie sich fühlen, Mache ich nicht mik. Aver die un-
fertige, unreifeFr u ch 1 j e n e i^-V ersuche
als eltwas hochstehendess außerordentftches aney-
kennen, das gehk nicht an. Soviel Selbstkritik sollken
die Anhänger des „Ex" aufbringen, daß sie mit
wachen Sinnen und offenen Äugen ihre Erzeugnifle
vergleichen mit dem, was früher geletstekwurde.
Es ist doch wohl keiner unter ihnen, der nicht Michel-
angelo oder Tizian, Rubens oder Aembrandt sein
möchte — und das flnd keine Expreflionisten vom
Schlage der Leute des 20. 3ahrhunderts, immerhln
aber yatten sie Geisi, Gefühl, 3nnenschau, Phankäste.
Zu den „Ansichten eines Anrnodernen" 5 L- . <
Erwiderung von P. Schäffer-Uelzen.
Auch dle Entgegnung von Herrn Sommer in Heft 3
beweist, wie seine früheren Artikel, Wort für Work,
daß meine objektiven Feststellungen richtig waren.
Aus jedem Satz springt einem die Tatsache entgegen,
daß die Gegenwartsbestrebungen weder chrem
Lharakter noch ihrem 1lmfange nach verstan-
den worden sinü, weshalb eine eingehende sachuche
Auseinandersetzung tatfächlich nicht möglich ist. Das
tst meine ehrlich ausgesprochene Ileberzeugung und
auch ich stütze mich dabei auf eine Reihe von Zu-
schrifien und zwar solcher Kollegen, denen das Mesen
der älteren Mekhode sowohl wie das der neuen
verlraut ist.
Nur auf Fundamentales muß hingewiesen werdeN,
obgleich 99 v. H. aller Artikel in „Kunst und 3ugend"
von ntchts anderem sprechen. Es ist eine arge Ber-
kennung, zu behaupten, der moderne Unkerricht miß-
achte die Nakur und — es steht hiermit im engsten
Zusammenhang — zu glauben, er sehe in der Dar-
stellung abstrakter Dinge sein Ziel. Es wird ver-
kannt, daß es sich um Mekhoden handelk, die die
von Begrifflichem verschükteken Eigenkräfte des
Menschen wieder freimachen wollen, indem ste auf
den Urgrund der natürlichen Gefühlskräfte zurück-
gehen. Diese Methoden gehen Hand 1n Hand mik
den Erkenntniflen der modernen Psychologie. EZ
werden also bewußt -ie Hemmungen hinweggeräuMt,
die den GefLhlskräften, dte sich äkkiv oder pafliv
äußern, im Wege stnd. 3m 3ünglingsalter reiftdann
auf dem Srunde üieser Vorbereiwngen das Ber-
ständnis für die Meisterwerke unferer deutschen Kunst
heran, das aus dem Bewußksein oder der Ahnung
geistiger Zllgehörigkeit heraüs den echischen Millen
anregk. Da haben wkr das Wollen. Und das
Denken pflegen wir am intenflvsten im LtNear--
zeichenunterricht unv bei taüsenderlel anderen Dingen,
außerdem nlmmt uns der Philologe die Sorge um
die Pslege öieser drikken seelischen Fuiiktion durch-
ans ab. Man kann dem modernen Zeichenunkerrlcht
also nicht den Borwurf einer einselkigen GelstesäUs-
bildung machen, wenn er auch aus schrelender Rot-
wendigkeit heräus eine wesentlkche Ergänzung des
wissenschastlichen Unterrichks ist, lndeM er -ie post-
tiven Ge, fühl s kräste bekont. Belehrend iM
Sommerschen Sinne ist er also insofern nichk, als er
keine Erkennkntfle äuf verstandesmäßiger Vasts ver«
Elne schöne klare Formel, wie sie kürzer kaum ge-
bildek werden könnte. G. Kolb findek eine ähn-
liche Auslegung in seinem „Bildhafken Gestalten" für
das Wesen der inneren Anschauung, des bildhaften
Echauens: „Anschauung ist nicht allein äußere Mahr-
nehmung und auf ihr beruhende Gesichtsvorstellung,
sondern vielmehr noch inneres bildhaftes Schauen,
öas gefühlsbekont zur Aktivität drängt. Die
Fähigkeit des inneren Schauens kann aber nicht
durch bewußtes Darstellen der Außenwelk, auch
nichk durch die auf unmittelbarer bewußter Anschau-
ung beruhende Gedächtnisdarstellung entwickelt wer-
den, sondern nur durch das gefühlsbetonte
phantasiemäßige Darstellen, das intuitives,
aus der inneren Borstellung, aus der Gesamtvor-
stellung fließendes Gestalten ist. Eine äuhere Wahr-
nehmung mutz dabei nicht unmittelbare Ursache sein.
Nur durch das phantasiemähige Gestalten ist es uns
möglich, Erlebtes auszudrücken."
Ganz einverstanden. Z. B. Adolph Menzel
hatte Friedrich den Großen nie gesehen, er kannke
nur die unsterblichen Nachlässe, Nachwirkungen sei-
nes Geistes und seiner Wtllenskrafk, und er hatte
außerdem seine Totenmaske, das Zeug, was er ge°
tragen hatte und Schilderungen Dritter über seine
Person zur Berfügung. Menzel schuf nun kraft
seiner vistonären und intuitiven Eigenschafien, zu
denen die Beherrschung graphischer und malerischer
Techniken hinzukam, das Bild des großen Königs.
Eindringlicher ist niemals ein Mensch von einem
Künstler erfaßt worden. Er hat ihn mit den
Augen des Geistes gesehen, aus seinem
Werke spricht die vernehmliche Sprache
wahrhaft s ch ö p sqr i sch er Phqntasije.
Aber! 3st Menzel ein Expressiontst? Er erfüllt völlig
die Gählbeck'sche Forderung, die nach ihm das Wesen
der neuen Kunslbetätigung ausmacht, und doch las
ich nirgendwo, Menzel sei Expressionist, niemänd unter
den Führern stellt ihn als Leuchke und Borbilü für
das neuzeitliche Schaffen auf. Bon Max Klinger,
Bartholomä, Rodin, von Moritz von Schwind, Phi-
lipp Otto Runge, Böcklin, Makart, Piloty: von
Dürer, Aaphael, Leonardo, ja von jedem Großen im
Reiche der Kunst, dte reinen Nakuralisten ausgenom-
men, läht sich beweisen, daß ihr inneres bildhaftes
Schauen, das Sehen mit den Augen des Geistes, ver-
bunden mik Phankasie, es war, das sie befähigte zu
ihren künstlerischen Großkaken. Dabei nennen wir
den Einen einen Romantiker, den Andern einen Ge--
schichtsmaler, den Drltten einen Fabulisten, dem
Dierten legen wir die Marke: Kirchenmaler an. Dle
Gahlbeckformel stimmt haarscharf auf jeden von ihnen,
und doch sind sie keine Expressionisten. Wie geht das
zu? Meil die Formel elne allgemein-
gültige für das, was wtr als Kunst
fühlen, isk. Und ztvar im weikesten Sinnel Denn
auch der Künstgewerbler, der ein Schmuckstück an-
fertigt, eine Blumenschale, ein PlaKat macht; der
ännenraumgestalter und der Architekt, sie schaffen
im Sinne dessen» was mein Gegner als das ureigent-
liche Wesen des Expressionismus erkennt.
3ch nannte den Expressionismus, die Summe der
Kunstschöpfungen unserer gährenden Zeit, Doku--
mente tastender Künftlerarbeit. 3hr
Wesen liegt in der Absicht, loszukommen vom Alt-
hergebrachten, verankerk. Die vollkommene Ableh-
nung, das Berwerfen d es Ankerüehmens der
Expressionisten, ,>der Männer vom Geiste", als die
sie sich fühlen, Mache ich nicht mik. Aver die un-
fertige, unreifeFr u ch 1 j e n e i^-V ersuche
als eltwas hochstehendess außerordentftches aney-
kennen, das gehk nicht an. Soviel Selbstkritik sollken
die Anhänger des „Ex" aufbringen, daß sie mit
wachen Sinnen und offenen Äugen ihre Erzeugnifle
vergleichen mit dem, was früher geletstekwurde.
Es ist doch wohl keiner unter ihnen, der nicht Michel-
angelo oder Tizian, Rubens oder Aembrandt sein
möchte — und das flnd keine Expreflionisten vom
Schlage der Leute des 20. 3ahrhunderts, immerhln
aber yatten sie Geisi, Gefühl, 3nnenschau, Phankäste.
Zu den „Ansichten eines Anrnodernen" 5 L- . <
Erwiderung von P. Schäffer-Uelzen.
Auch dle Entgegnung von Herrn Sommer in Heft 3
beweist, wie seine früheren Artikel, Wort für Work,
daß meine objektiven Feststellungen richtig waren.
Aus jedem Satz springt einem die Tatsache entgegen,
daß die Gegenwartsbestrebungen weder chrem
Lharakter noch ihrem 1lmfange nach verstan-
den worden sinü, weshalb eine eingehende sachuche
Auseinandersetzung tatfächlich nicht möglich ist. Das
tst meine ehrlich ausgesprochene Ileberzeugung und
auch ich stütze mich dabei auf eine Reihe von Zu-
schrifien und zwar solcher Kollegen, denen das Mesen
der älteren Mekhode sowohl wie das der neuen
verlraut ist.
Nur auf Fundamentales muß hingewiesen werdeN,
obgleich 99 v. H. aller Artikel in „Kunst und 3ugend"
von ntchts anderem sprechen. Es ist eine arge Ber-
kennung, zu behaupten, der moderne Unkerricht miß-
achte die Nakur und — es steht hiermit im engsten
Zusammenhang — zu glauben, er sehe in der Dar-
stellung abstrakter Dinge sein Ziel. Es wird ver-
kannt, daß es sich um Mekhoden handelk, die die
von Begrifflichem verschükteken Eigenkräfte des
Menschen wieder freimachen wollen, indem ste auf
den Urgrund der natürlichen Gefühlskräfte zurück-
gehen. Diese Methoden gehen Hand 1n Hand mik
den Erkenntniflen der modernen Psychologie. EZ
werden also bewußt -ie Hemmungen hinweggeräuMt,
die den GefLhlskräften, dte sich äkkiv oder pafliv
äußern, im Wege stnd. 3m 3ünglingsalter reiftdann
auf dem Srunde üieser Vorbereiwngen das Ber-
ständnis für die Meisterwerke unferer deutschen Kunst
heran, das aus dem Bewußksein oder der Ahnung
geistiger Zllgehörigkeit heraüs den echischen Millen
anregk. Da haben wkr das Wollen. Und das
Denken pflegen wir am intenflvsten im LtNear--
zeichenunterricht unv bei taüsenderlel anderen Dingen,
außerdem nlmmt uns der Philologe die Sorge um
die Pslege öieser drikken seelischen Fuiiktion durch-
ans ab. Man kann dem modernen Zeichenunkerrlcht
also nicht den Borwurf einer einselkigen GelstesäUs-
bildung machen, wenn er auch aus schrelender Rot-
wendigkeit heräus eine wesentlkche Ergänzung des
wissenschastlichen Unterrichks ist, lndeM er -ie post-
tiven Ge, fühl s kräste bekont. Belehrend iM
Sommerschen Sinne ist er also insofern nichk, als er
keine Erkennkntfle äuf verstandesmäßiger Vasts ver«