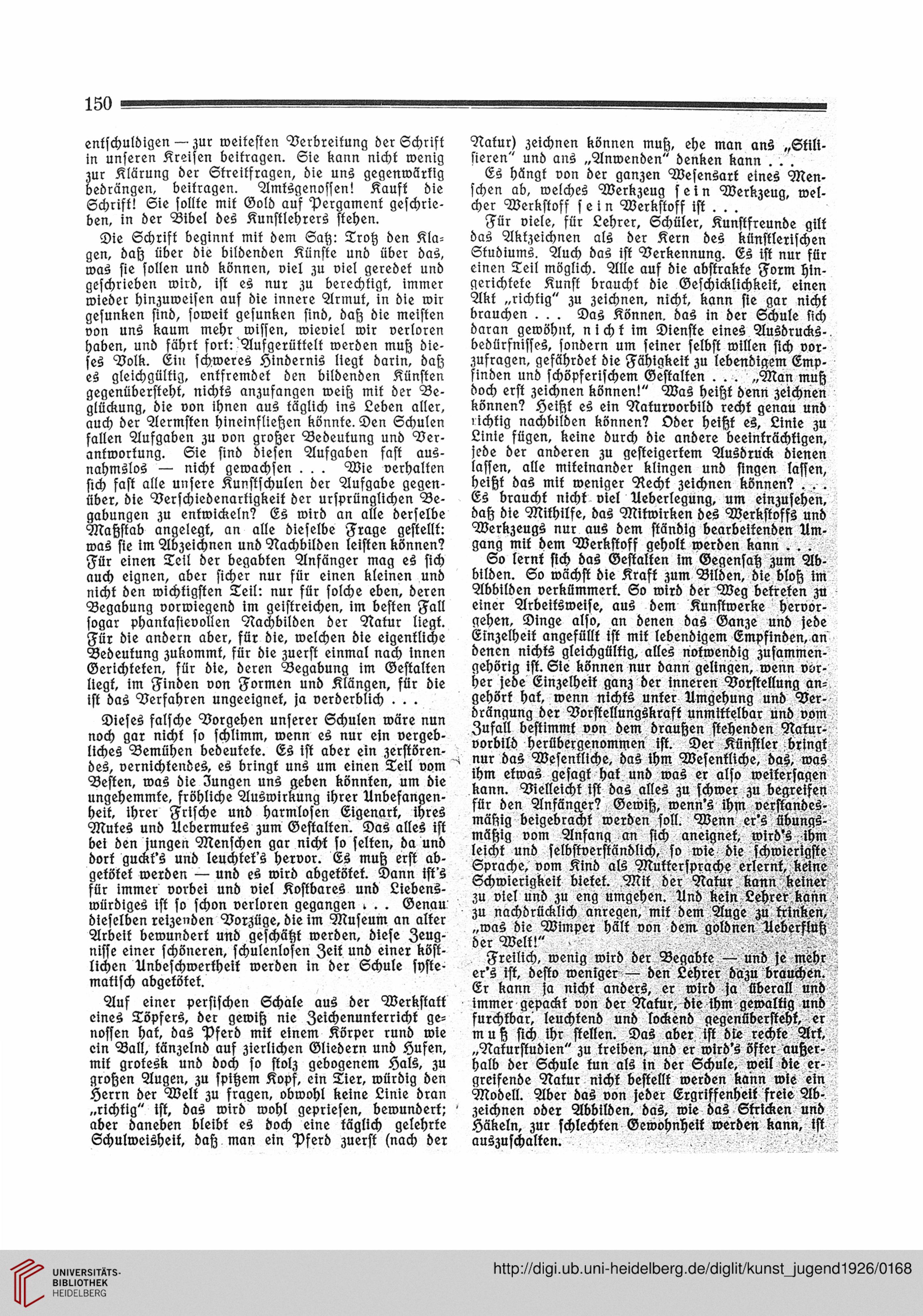190
entschuldigen — zur rveikesten Verbreitung der Schrift
in unseren Kreisen beikragen. Sie kann nicht wenig
zur Klärung der Streitfragen, die uns gegenwärkig
bedrängen, beitragen. Amtsgenossen! Kauft die
Schrift! Sie sollke mit Gold auf Pergament geschrie-
ben, in der Bibel des Kunstlehrers stehen.
Die Schrifk beginnt mit dem Sah: Trotz den Kla-
gen, daß über die bildenden Künste und über das,
was sie sollen und können, viel zu viel geredek und
geschrieben wird, ist es nur zu berechtigt, immer
wieder hinzuweisen auf die innere Armut, in die wir
gesunken sind, soweit gesunken sind, daß die meisten
von uns kaum mehr wissen, wieviel wir verloren
haben, und fährt fort: 'Aufgerütkelt werden muß die-
ses Bolk. Ein schweres Hindernis liegt darin, datz
es gleichgültig, entfremdet den bildenden Künsten
gegenübersteht, nichts anzufangen weih mit der Be-
glückung, die von ihnen aus täglich ins Leben aller,
auch der Aermsten hineinfliehen könnte. Den Schulen
fallen Aufgaben zu von großer Bedeutung und Ber-
antwortung. Sie sind diesen Aufgaben fast aus-
nahmslos — nicht gewachsen . . . Wie verhalten
sich fast alle unsere Kunstschulen der Aufgabe gegen-
über, die Verschiedenartigkeit der ursprünglichen Be-
gabungen zu entwickeln? Es wird an alle derselbe
Maßstab angelegk, an alle dieselbe Frage gestellk:
was sie im Abzeichnen und Nachbilden leisten können?
Für einen Teil der begabken Anfänger mag es sich
auch eignen, aber sicher nur für einen kleinen und
nicht den wichtigsten Teil: nur für solche eben, deren
Begabung vorwiegend im geistreichen, im besten Fall
sogar phankasievollen Nachbilden der Natur liegt.
Für die andern aber, für die, welchen die eigenkliche
Bedeukung zukommt, für die zuerst einmal nach innen
Gerichketen, für die, deren Begabung im Gestalten
liegk, im Finden von Formen und Klängen, für die
ist das Verfahren ungeeignek, ja verderblich . . .
Dieses falsche Vorgehen unserer Schulen wäre nun
noch gar nichk so schlimm, wenn es nur ein vergeb-
liches Bemühen bedeutete. Es ist aber ein zerstören-
des, vernichkendes, es bringk uns um einen Teil vom
Besten, was die llungen uns geben könnken, um die
ungehemmke, fröhliche Auswirkung ihrer Ilnbefangen-
heit, ihrer Frische und harmlosen Eigenark, ihres
Mutes und Uebermutes zum Gestalten. Das alles ist
bei den jungen Menschen gar nicht so selten, da und
dort guckt's und leuchtek's hervor. Es muß erst ab-
geköket werden — und es wird abgeköket. Dann ist's
fllr immer vorbei und viel Kostbares und Liebens-
würdiges ist so schon verloren gegangen l . . Genau
dteselben reizevden Vorzüge, die im Museum an alker
Arbeik bewundert und geschähk werden, diese Zeug-
nisse einer schöneren, schulenlosen Zeit und einer kösk-
lichen Ilnbeschwerkheik werden in der Schule syste-
matisch abgetötet.
Auf einer persischen Schale aus der Werkstatk
eines Töpfers, der gewiß nie Zeichenunterrichk ge-
nossen hak, das Pferd mit einem Körper rund wie
ein Ball, tänzelnd auf zierlichen Gliedern und Hufen,
mik grokesk und doch so skolz gebogenem Hals, zu
großen Augen, zu spitzem Kopf, ein Tier, würdig den
Herrn der Welk zu fragen, obwohl keine Linie dran
„richtig" ist, das wird wohl gepriesen, bewundert:
aber daneben bleibk es doch eine täglich gelehrke
Schulweisheit, daß man ein Pferd zuerst (nach der
Natur) zeichnen können muß, ehe man ans „Stili-
sieren" und ans „Anwenden" denken kann . . .
Es hängk von der ganzen Wesensark eines Men-
schen ab, welches Werkzeug sein Werkzeug, wel-
cher Werkstoff sein Werkstoff ist . . .
Für viele, für Lehrer, Schüler, Kunskfreunde gilt
das Akkzeichnen als der Kern des künstlerischen
Skudiums. Auch das ist Verkennung. Es ist nur für
einen Teil möglich. Alle auf die abstrakte Form htn-
gerichteke Kunsk brauchk die Geschicklichkeit, einen
Akk „richtig" zu zeichnen, nicht, kann sie gar nicht
brauchen . . . Das Können. das in der Schule lich
daran gewöhnk, nichk im Dienste eines Ausdrucks-.
bedürfnisses, sondern um seiner selbst willen sich vor-
zufragen, gefährdet die Fähigkeik zu lebendigem Emp-
sinden und schöpferischem Geskalten ... „Man muß
doch erst zeichnen können!" Was heißt denn zeichnen
können? Heißt es ein Naturvorbild rechk genau und
richkig nachbilden können? Oder heißk es, Linie zu
Linie fügen, keine durch die andere beeinträchkigen,
jede der anderen zu gesteigertem Ausdrück dienen
lassen, alle mikeinander klingen und stngen lassen,
heißk das mik weniger Recht zeichnen können? ., .
Es brauchk nicht viel Aeberlegung, um einzusehen,
daß die Mithilfe, das Mikwirken des Merkstoffs und
Werkzeugs nur aus dem ständig bearbeitenden Üm-
gang mik dem Werkstoff geholt werden kann ...
So lernk sich das Gestalken im Gegensah zum Ab-
bilden. So wächst die Krafk zum Bilden, die bloß im
Abbilden verkümmerk. So wird der Weg bekreten zu
einer Arbeitsweise, aus dem Kunstwerke hervör-
gehen, Dinge also, an denen das Ganze und jede
Eknzelheik angefüllk ist mik lebendigem Empfinden, an
denen nichks gleichgültig, alles nokwendig zusammen-
gehörig ist. Sie können nur dann gelingen, wenn vör-
her jede Einzelheik ganz der inneren Vorstellung an-
gehörk hak, wenn nichks unker Umgehung und Ver-
drängung der Vorstellungskrafk unmiktelbar ünd vom
Zufall bestimmt von dem draußen stehenden Nakur-
vorbild herübergenommen ist. Der Künstler bringk
nur das Wesenkliche, das ihm Wesentliche, das, wys
ihm ekwas gesagk hat und was er also weikersagen
kann. Vielleichk ist das alles zu schwer zu begreisen
für den Anfänger? Gewiß, wenn's ihm verstandes-
mäßig beigebrachk werden soll. Wenn er's übungs-
mäßig vom Anfang an sich aneignek, wird's ihm
leichk und selbskverskändlich, so wie die schwierigste
Sprache, vom Kind als Mukkersprache erlernk, keine
Schwierigkeik bieket. Mik der Nakur kann keiner
zu viel und zu eng umgehen. Und kein Lehrer kann
zu nachdrücklich anregen, mik dem Auge zu trinken,
„was die Wimper HSlt von dem goldnen Aeberflüß
der Welk!"
Freilich, wenig wird der Begabte — Und je mehr
er's ist, desto weniger — den Lehrer dazu brauchen.
Er kann ja nicht anders, er wird ja überall und
immer gepackk von der Natur, die ihm gewalkig und
furchkbar, leuchkend und lockend gegenüberstehk, er
muß sich ihr stellen. Das aber ist die rechke Art,
„Naturstudien" zu kreiben, und er wird's öfker außer-
halb der Schule kun als in der Schule, weil die er-
greifende Nakur nichk bestellt werden kann wie ein
Modell. Aber das von jeder Ergriffenheik freie Ab-
zeichnen oder Abbilden. das, wie das Stricken und
Häkeln, zur schlechten Gewohnheit werden kann, ist
auszuschalten. -
entschuldigen — zur rveikesten Verbreitung der Schrift
in unseren Kreisen beikragen. Sie kann nicht wenig
zur Klärung der Streitfragen, die uns gegenwärkig
bedrängen, beitragen. Amtsgenossen! Kauft die
Schrift! Sie sollke mit Gold auf Pergament geschrie-
ben, in der Bibel des Kunstlehrers stehen.
Die Schrifk beginnt mit dem Sah: Trotz den Kla-
gen, daß über die bildenden Künste und über das,
was sie sollen und können, viel zu viel geredek und
geschrieben wird, ist es nur zu berechtigt, immer
wieder hinzuweisen auf die innere Armut, in die wir
gesunken sind, soweit gesunken sind, daß die meisten
von uns kaum mehr wissen, wieviel wir verloren
haben, und fährt fort: 'Aufgerütkelt werden muß die-
ses Bolk. Ein schweres Hindernis liegt darin, datz
es gleichgültig, entfremdet den bildenden Künsten
gegenübersteht, nichts anzufangen weih mit der Be-
glückung, die von ihnen aus täglich ins Leben aller,
auch der Aermsten hineinfliehen könnte. Den Schulen
fallen Aufgaben zu von großer Bedeutung und Ber-
antwortung. Sie sind diesen Aufgaben fast aus-
nahmslos — nicht gewachsen . . . Wie verhalten
sich fast alle unsere Kunstschulen der Aufgabe gegen-
über, die Verschiedenartigkeit der ursprünglichen Be-
gabungen zu entwickeln? Es wird an alle derselbe
Maßstab angelegk, an alle dieselbe Frage gestellk:
was sie im Abzeichnen und Nachbilden leisten können?
Für einen Teil der begabken Anfänger mag es sich
auch eignen, aber sicher nur für einen kleinen und
nicht den wichtigsten Teil: nur für solche eben, deren
Begabung vorwiegend im geistreichen, im besten Fall
sogar phankasievollen Nachbilden der Natur liegt.
Für die andern aber, für die, welchen die eigenkliche
Bedeukung zukommt, für die zuerst einmal nach innen
Gerichketen, für die, deren Begabung im Gestalten
liegk, im Finden von Formen und Klängen, für die
ist das Verfahren ungeeignek, ja verderblich . . .
Dieses falsche Vorgehen unserer Schulen wäre nun
noch gar nichk so schlimm, wenn es nur ein vergeb-
liches Bemühen bedeutete. Es ist aber ein zerstören-
des, vernichkendes, es bringk uns um einen Teil vom
Besten, was die llungen uns geben könnken, um die
ungehemmke, fröhliche Auswirkung ihrer Ilnbefangen-
heit, ihrer Frische und harmlosen Eigenark, ihres
Mutes und Uebermutes zum Gestalten. Das alles ist
bei den jungen Menschen gar nicht so selten, da und
dort guckt's und leuchtek's hervor. Es muß erst ab-
geköket werden — und es wird abgeköket. Dann ist's
fllr immer vorbei und viel Kostbares und Liebens-
würdiges ist so schon verloren gegangen l . . Genau
dteselben reizevden Vorzüge, die im Museum an alker
Arbeik bewundert und geschähk werden, diese Zeug-
nisse einer schöneren, schulenlosen Zeit und einer kösk-
lichen Ilnbeschwerkheik werden in der Schule syste-
matisch abgetötet.
Auf einer persischen Schale aus der Werkstatk
eines Töpfers, der gewiß nie Zeichenunterrichk ge-
nossen hak, das Pferd mit einem Körper rund wie
ein Ball, tänzelnd auf zierlichen Gliedern und Hufen,
mik grokesk und doch so skolz gebogenem Hals, zu
großen Augen, zu spitzem Kopf, ein Tier, würdig den
Herrn der Welk zu fragen, obwohl keine Linie dran
„richtig" ist, das wird wohl gepriesen, bewundert:
aber daneben bleibk es doch eine täglich gelehrke
Schulweisheit, daß man ein Pferd zuerst (nach der
Natur) zeichnen können muß, ehe man ans „Stili-
sieren" und ans „Anwenden" denken kann . . .
Es hängk von der ganzen Wesensark eines Men-
schen ab, welches Werkzeug sein Werkzeug, wel-
cher Werkstoff sein Werkstoff ist . . .
Für viele, für Lehrer, Schüler, Kunskfreunde gilt
das Akkzeichnen als der Kern des künstlerischen
Skudiums. Auch das ist Verkennung. Es ist nur für
einen Teil möglich. Alle auf die abstrakte Form htn-
gerichteke Kunsk brauchk die Geschicklichkeit, einen
Akk „richtig" zu zeichnen, nicht, kann sie gar nicht
brauchen . . . Das Können. das in der Schule lich
daran gewöhnk, nichk im Dienste eines Ausdrucks-.
bedürfnisses, sondern um seiner selbst willen sich vor-
zufragen, gefährdet die Fähigkeik zu lebendigem Emp-
sinden und schöpferischem Geskalten ... „Man muß
doch erst zeichnen können!" Was heißt denn zeichnen
können? Heißt es ein Naturvorbild rechk genau und
richkig nachbilden können? Oder heißk es, Linie zu
Linie fügen, keine durch die andere beeinträchkigen,
jede der anderen zu gesteigertem Ausdrück dienen
lassen, alle mikeinander klingen und stngen lassen,
heißk das mik weniger Recht zeichnen können? ., .
Es brauchk nicht viel Aeberlegung, um einzusehen,
daß die Mithilfe, das Mikwirken des Merkstoffs und
Werkzeugs nur aus dem ständig bearbeitenden Üm-
gang mik dem Werkstoff geholt werden kann ...
So lernk sich das Gestalken im Gegensah zum Ab-
bilden. So wächst die Krafk zum Bilden, die bloß im
Abbilden verkümmerk. So wird der Weg bekreten zu
einer Arbeitsweise, aus dem Kunstwerke hervör-
gehen, Dinge also, an denen das Ganze und jede
Eknzelheik angefüllk ist mik lebendigem Empfinden, an
denen nichks gleichgültig, alles nokwendig zusammen-
gehörig ist. Sie können nur dann gelingen, wenn vör-
her jede Einzelheik ganz der inneren Vorstellung an-
gehörk hak, wenn nichks unker Umgehung und Ver-
drängung der Vorstellungskrafk unmiktelbar ünd vom
Zufall bestimmt von dem draußen stehenden Nakur-
vorbild herübergenommen ist. Der Künstler bringk
nur das Wesenkliche, das ihm Wesentliche, das, wys
ihm ekwas gesagk hat und was er also weikersagen
kann. Vielleichk ist das alles zu schwer zu begreisen
für den Anfänger? Gewiß, wenn's ihm verstandes-
mäßig beigebrachk werden soll. Wenn er's übungs-
mäßig vom Anfang an sich aneignek, wird's ihm
leichk und selbskverskändlich, so wie die schwierigste
Sprache, vom Kind als Mukkersprache erlernk, keine
Schwierigkeik bieket. Mik der Nakur kann keiner
zu viel und zu eng umgehen. Und kein Lehrer kann
zu nachdrücklich anregen, mik dem Auge zu trinken,
„was die Wimper HSlt von dem goldnen Aeberflüß
der Welk!"
Freilich, wenig wird der Begabte — Und je mehr
er's ist, desto weniger — den Lehrer dazu brauchen.
Er kann ja nicht anders, er wird ja überall und
immer gepackk von der Natur, die ihm gewalkig und
furchkbar, leuchkend und lockend gegenüberstehk, er
muß sich ihr stellen. Das aber ist die rechke Art,
„Naturstudien" zu kreiben, und er wird's öfker außer-
halb der Schule kun als in der Schule, weil die er-
greifende Nakur nichk bestellt werden kann wie ein
Modell. Aber das von jeder Ergriffenheik freie Ab-
zeichnen oder Abbilden. das, wie das Stricken und
Häkeln, zur schlechten Gewohnheit werden kann, ist
auszuschalten. -