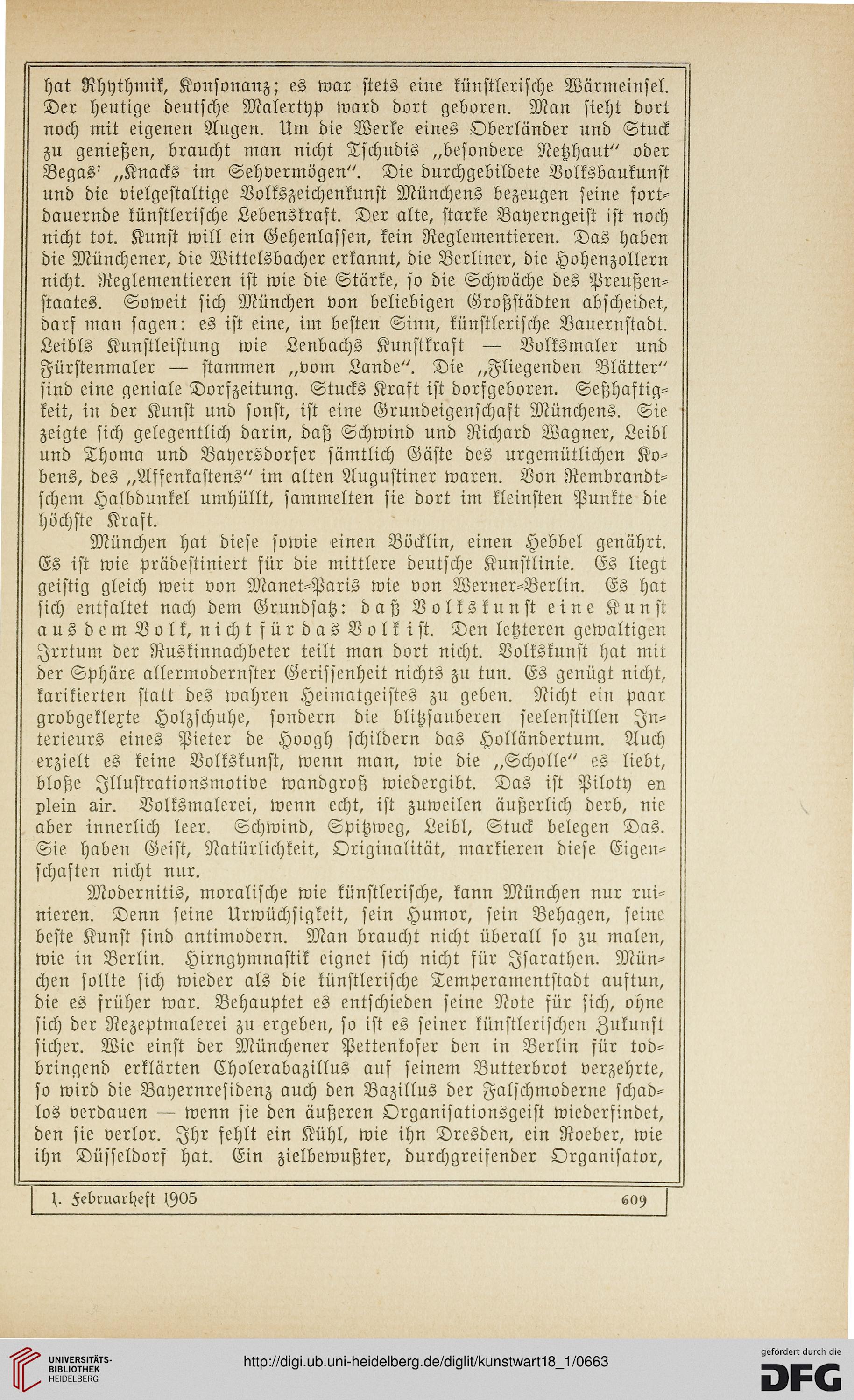hat Rhythmik, Konsonanz; es war stets eine künstlerische Wärmeinsel.
Der heutige dentsche Malertyp ward dort geboren. Man sieht dort
noch mit eigenen Augen. Um die Werke eines Oberländer und Stuck
zu genießen, braucht man nicht Tschudis „besondere Netzhaut" oder
Begas' „Knacks im Sehvermögen". Die durchgebildete Volksbaukunst
und die vielgestaltige Volkszeichenkunst Münchens bezeugen seine sort-
dauernde künstlerische Lebenskrast. Der alte, starke Bayerngeist ist noch
nicht tot. Kunst will ein Gehenlassen, kein Reglementieren. Das haben
die Münchener, die Wittelsbacher erkannt, die Berliner, die Hohenzollern
nicht. Reglementieren ist wie die Stärke, so die Schwäche des Preußen-
staates. Soweit sich München von beliebigen Großstädten abscheidet,
darf man sagen: es ist eine, im besten Sinn, künstlerische Bauernstadt.
Leibls Kunstleistung wie Lenbachs Kunstkraft — Volksmaler und
Fürstenmaler — stammen „vom Lande". Die „Fliegenden Blätter"
sind eine geniale Dorfzeitung. Stucks Kraft ist dorfgeboren. Seßhaftig-
keit, in der Kunst und sonst, ist eine Grundeigenschaft Münchens. Sie
zeigte sich gelegentlich darin, daß Schwind und Richard Wagner, Leibl
und Thoma und Bayersdorfer sämtlich Gäste des urgemütlichen Ko-
bens, des „Affenkastens" im alten Augustiner waren. Von Rembrandt-
schem Halbdunkel umhüllt, sammelten sie dort im kleinsten Punkte die
höchste Kraft.
München hat diese sowie einen Böcklin, einen Hebbel genährt.
Es ist wie prädestiniert für die mittlere deutsche Kunstlinie. Es liegt
geistig gleich weit von Manet-Paris wie von Werner-Berlin. Es hat
sich entfaltet nach dem Grundsatz: daß Volkskunst eine Kunst
ausdemVolk, nichtfürdasVolkist. Den letzteren gewaltigen
Jrrtum der Ruskinnachbeter teilt man dort nicht. Volkskunst hat mit
der Sphäre allermodernster Gerissenheit nichts zu tun. Es genügt nicht,
karikierten statt des wahren Heimatgeistes zu geben. Nicht ein paar
grobgeklexte Holzschuhe, sonderu die blitzsauberen seelenstillen Jn-
terieurs eines Pieter de Hoogh schildern das Hollündertum. Auch
erzielt es keine Volkskunst, wenn man, wie die „Scholle" es liebt,
bloße Jllustrationsmotive wandgroß wiedergibt. Das ist Piloty sn
plsin nir. Volksmalerei, wenn echt, ist zuweilen äußerlich derb, nie
aber innerlich leer. Schwind, Spitzweg, Leibl, Stuck belegen Das.
Sie haben Geist, Natürlichkeit, Originalität, markieren diese Eigen-
schaften nicht nur.
Modernitis, moralische wie künstlerische, kann München nur rui-
nieren. Denn seine Urwüchsigkeit, sein Humor, sein Behagen, seine
beste Kunst sind antimodern. Man braucht nicht überall so zu malen,
wie in Berlin. Hirngymnastik eignet sich nicht für Jsarathen. Mün-
chen sollte sich wieder als die künstlerische Temperamentstadt auftun,
die es früher war. Behauptet es entschieden seine Note für sich, ohne
sich der Rezeptmalerei zu ergeben, so ist es seiner künstlerischen Zukunft
sicher. Wic einst der Münchener Pettenkofer den in Berlin für tod-
bringend erklärten Cholerabazillus auf seinem Butterbrot verzehrte,
so wird die Bayernresidenz auch den Bazillus der Falschmoderne schad-
los verdauen — wenn sie den äußeren Organisationsgeist wiederfindet,
den sie verlor. Jhr fehlt ein Kühl, wie ihn Dresden, ein Roeber, wie
ihn Düsseldorf hat. Ein zielbewußter, durchgreifender Organisator,
l. Februarhest l905
60^
Der heutige dentsche Malertyp ward dort geboren. Man sieht dort
noch mit eigenen Augen. Um die Werke eines Oberländer und Stuck
zu genießen, braucht man nicht Tschudis „besondere Netzhaut" oder
Begas' „Knacks im Sehvermögen". Die durchgebildete Volksbaukunst
und die vielgestaltige Volkszeichenkunst Münchens bezeugen seine sort-
dauernde künstlerische Lebenskrast. Der alte, starke Bayerngeist ist noch
nicht tot. Kunst will ein Gehenlassen, kein Reglementieren. Das haben
die Münchener, die Wittelsbacher erkannt, die Berliner, die Hohenzollern
nicht. Reglementieren ist wie die Stärke, so die Schwäche des Preußen-
staates. Soweit sich München von beliebigen Großstädten abscheidet,
darf man sagen: es ist eine, im besten Sinn, künstlerische Bauernstadt.
Leibls Kunstleistung wie Lenbachs Kunstkraft — Volksmaler und
Fürstenmaler — stammen „vom Lande". Die „Fliegenden Blätter"
sind eine geniale Dorfzeitung. Stucks Kraft ist dorfgeboren. Seßhaftig-
keit, in der Kunst und sonst, ist eine Grundeigenschaft Münchens. Sie
zeigte sich gelegentlich darin, daß Schwind und Richard Wagner, Leibl
und Thoma und Bayersdorfer sämtlich Gäste des urgemütlichen Ko-
bens, des „Affenkastens" im alten Augustiner waren. Von Rembrandt-
schem Halbdunkel umhüllt, sammelten sie dort im kleinsten Punkte die
höchste Kraft.
München hat diese sowie einen Böcklin, einen Hebbel genährt.
Es ist wie prädestiniert für die mittlere deutsche Kunstlinie. Es liegt
geistig gleich weit von Manet-Paris wie von Werner-Berlin. Es hat
sich entfaltet nach dem Grundsatz: daß Volkskunst eine Kunst
ausdemVolk, nichtfürdasVolkist. Den letzteren gewaltigen
Jrrtum der Ruskinnachbeter teilt man dort nicht. Volkskunst hat mit
der Sphäre allermodernster Gerissenheit nichts zu tun. Es genügt nicht,
karikierten statt des wahren Heimatgeistes zu geben. Nicht ein paar
grobgeklexte Holzschuhe, sonderu die blitzsauberen seelenstillen Jn-
terieurs eines Pieter de Hoogh schildern das Hollündertum. Auch
erzielt es keine Volkskunst, wenn man, wie die „Scholle" es liebt,
bloße Jllustrationsmotive wandgroß wiedergibt. Das ist Piloty sn
plsin nir. Volksmalerei, wenn echt, ist zuweilen äußerlich derb, nie
aber innerlich leer. Schwind, Spitzweg, Leibl, Stuck belegen Das.
Sie haben Geist, Natürlichkeit, Originalität, markieren diese Eigen-
schaften nicht nur.
Modernitis, moralische wie künstlerische, kann München nur rui-
nieren. Denn seine Urwüchsigkeit, sein Humor, sein Behagen, seine
beste Kunst sind antimodern. Man braucht nicht überall so zu malen,
wie in Berlin. Hirngymnastik eignet sich nicht für Jsarathen. Mün-
chen sollte sich wieder als die künstlerische Temperamentstadt auftun,
die es früher war. Behauptet es entschieden seine Note für sich, ohne
sich der Rezeptmalerei zu ergeben, so ist es seiner künstlerischen Zukunft
sicher. Wic einst der Münchener Pettenkofer den in Berlin für tod-
bringend erklärten Cholerabazillus auf seinem Butterbrot verzehrte,
so wird die Bayernresidenz auch den Bazillus der Falschmoderne schad-
los verdauen — wenn sie den äußeren Organisationsgeist wiederfindet,
den sie verlor. Jhr fehlt ein Kühl, wie ihn Dresden, ein Roeber, wie
ihn Düsseldorf hat. Ein zielbewußter, durchgreifender Organisator,
l. Februarhest l905
60^