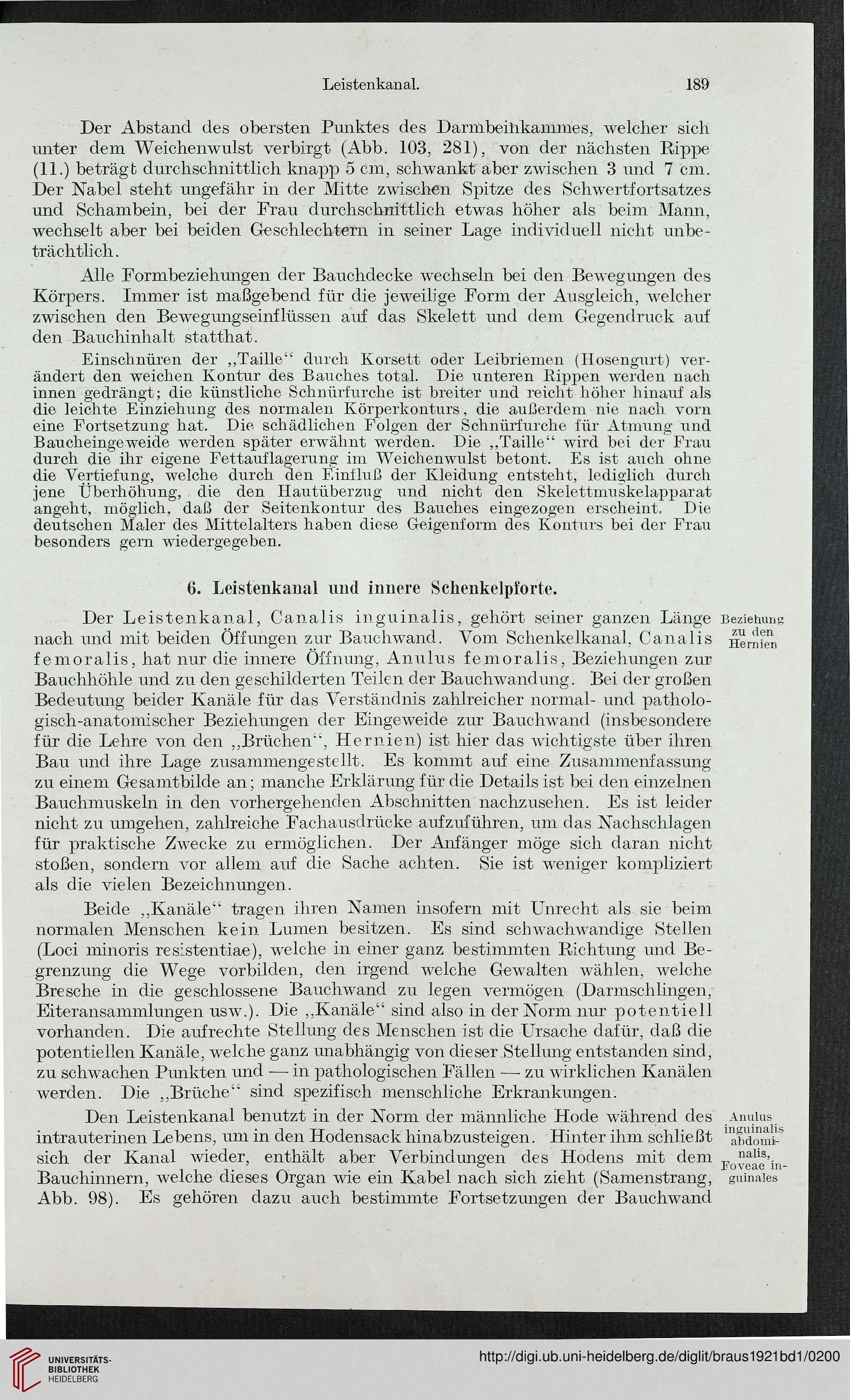Leistenkanal.
189
Der Abstand des obersten Punktes des Darmbeihkammes, welcher sich
unter dem Weichenwulst verbirgt (Abb. 103, 281), von der nächsten Rippe
(11.) beträgt durchschnittlich knapp 5 cm, schwankt aber zwischen 3 und 7 cm.
Der Nabel steht ungefähr in der Mitte zwischen Spitze des Schwertfortsatzes
und Schambein, bei der Frau durchschnittlich etwas höher als beim Mann,
wechselt aber bei beiden Geschlechtern in seiner Lage individuell nicht unbe-
trächtlich.
Alle Formbeziehungen der Bauchdecke wechseln bei den Bewegungen des
Körpers. Immer ist maßgebend für die jeweilige Form der Ausgleich, welcher
zwischen den Bewegungseinflüssen auf das Skelett und dem Gegendruck auf
den Bauchinhalt statthat.
Einschnüren der „Taille" durch Korsett oder Leibriemen (Hosengurt) ver-
ändert den weichen Kontur des Bauches total. Die unteren Rippen werden nach
innen gedrängt; die künstliche Schnürfurche ist breiter und reicht höher hinauf als
die leichte Einziehung des normalen Körperkonturs, die außerdem nie nach vorn
eine Fortsetzung hat. Die schädlichen Folgen der Schnürfurche für Atmung und
Baucheingeweide werden später erwähnt werden. Die ,,Taille" wird bei der Frau
durch die ihr eigene Fettauflagerung im Weichenwulst betont. Es ist auch ohne
die Vertiefung, welche durch den Einfluß der Kleidung entsteht, lediglich durch
jene Überhöhung, die den Hautüberzug und nicht den Skelettmuskelapparat
angeht, möglich, daß der Seitenkontur des Bauches eingezogen erscheint. Die
deutschen Maler des Mittelalters haben diese G-eigenform des Konturs bei der Frau
besonders gern wiedergegeben.
6. Leistenkanal und innere Schenkelpforte.
Der Leistenkanal, Canalis inguinalis, gehört seiner ganzen Länge Beziehung
nach und mit beiden Öffrangen zur Bauchwand. Vom Schenkelkanal, Canalis Hernien
femoralis, hat nur die innere Öffnung, Anulus femoralis, Beziehungen zur
Bauchhöhle und zu den geschilderten Teilen der Bauchwandung. Bei der großen
Bedeutung beider Kanäle für das Verständnis zahlreicher normal- und patholo-
gisch-anatomischer Beziehungen der Eingeweide zur Bauchwand (insbesondere
für die Lehre von den „Brüchen", Hernien) ist hier das Avichtigste über ihren
Bau und ihre Lage zusammengestellt. Es kommt auf eine Zusammenfassung
zu einem Gesamtbilde an; manche Erklärung für die Details ist bei den einzelnen
Bauchmuskeln in den vorhergehenden Abschnitten nachzusehen. Es ist leider
nicht zu umgehen, zahlreiche Fachausdrücke aufzuführen, um das Nachschlagen
für praktische Zwecke zu ermöglichen. Der Anfänger möge sich daran nicht
stoßen, sondern vor allem auf die Sache achten. Sie ist weniger kompliziert
als die vielen Bezeichnungen.
Beide „Kanäle" tragen ihren Namen insofern mit Unrecht als sie beim
normalen Menschen kein Lumen besitzen. Es sind schwachwandige Stellen
(Loci minoris resistentiae), welche in einer ganz bestimmten Richtung und Be-
grenzung die Wege vorbilden, den irgend welche Gewalten wählen, welche
Bresche in die geschlossene Bauchwand zu legen vermögen (Darmschlingen,
Eiteransammlungen usw.). Die „Kanäle" sind also in der Norm nur potentiell
vorhanden. Die aufrechte Stellung des Menschen ist die Ursache dafür, daß die
potentiellen Kanäle, welche ganz unabhängig von dieser Stellung entstanden sind,
zu schwachen Punkten und — in pathologischen Fällen — zu wirklichen Kanälen
werden. Die „Brüche" sind spezifisch menschliche Erkrankungen.
Den Leistenkanal benutzt in der Norm der männliche Hode während des Anuius
intrauterinen Lebens, um in den Hodensack hinabzusteigen. Hinter ihm schließt "moiiuV
sich der Kanal wieder, enthält aber Verbindungen des Hodens mit dem _, nalls>.
_ . *— j} OVG3.G 111-
Bauchinnern, welche dieses Organ wie ein Kabel nach sich zieht (Samenstrang, guinaies
Abb. 98). Es gehören dazu auch bestimmte Fortsetzungen der Bauchwand
189
Der Abstand des obersten Punktes des Darmbeihkammes, welcher sich
unter dem Weichenwulst verbirgt (Abb. 103, 281), von der nächsten Rippe
(11.) beträgt durchschnittlich knapp 5 cm, schwankt aber zwischen 3 und 7 cm.
Der Nabel steht ungefähr in der Mitte zwischen Spitze des Schwertfortsatzes
und Schambein, bei der Frau durchschnittlich etwas höher als beim Mann,
wechselt aber bei beiden Geschlechtern in seiner Lage individuell nicht unbe-
trächtlich.
Alle Formbeziehungen der Bauchdecke wechseln bei den Bewegungen des
Körpers. Immer ist maßgebend für die jeweilige Form der Ausgleich, welcher
zwischen den Bewegungseinflüssen auf das Skelett und dem Gegendruck auf
den Bauchinhalt statthat.
Einschnüren der „Taille" durch Korsett oder Leibriemen (Hosengurt) ver-
ändert den weichen Kontur des Bauches total. Die unteren Rippen werden nach
innen gedrängt; die künstliche Schnürfurche ist breiter und reicht höher hinauf als
die leichte Einziehung des normalen Körperkonturs, die außerdem nie nach vorn
eine Fortsetzung hat. Die schädlichen Folgen der Schnürfurche für Atmung und
Baucheingeweide werden später erwähnt werden. Die ,,Taille" wird bei der Frau
durch die ihr eigene Fettauflagerung im Weichenwulst betont. Es ist auch ohne
die Vertiefung, welche durch den Einfluß der Kleidung entsteht, lediglich durch
jene Überhöhung, die den Hautüberzug und nicht den Skelettmuskelapparat
angeht, möglich, daß der Seitenkontur des Bauches eingezogen erscheint. Die
deutschen Maler des Mittelalters haben diese G-eigenform des Konturs bei der Frau
besonders gern wiedergegeben.
6. Leistenkanal und innere Schenkelpforte.
Der Leistenkanal, Canalis inguinalis, gehört seiner ganzen Länge Beziehung
nach und mit beiden Öffrangen zur Bauchwand. Vom Schenkelkanal, Canalis Hernien
femoralis, hat nur die innere Öffnung, Anulus femoralis, Beziehungen zur
Bauchhöhle und zu den geschilderten Teilen der Bauchwandung. Bei der großen
Bedeutung beider Kanäle für das Verständnis zahlreicher normal- und patholo-
gisch-anatomischer Beziehungen der Eingeweide zur Bauchwand (insbesondere
für die Lehre von den „Brüchen", Hernien) ist hier das Avichtigste über ihren
Bau und ihre Lage zusammengestellt. Es kommt auf eine Zusammenfassung
zu einem Gesamtbilde an; manche Erklärung für die Details ist bei den einzelnen
Bauchmuskeln in den vorhergehenden Abschnitten nachzusehen. Es ist leider
nicht zu umgehen, zahlreiche Fachausdrücke aufzuführen, um das Nachschlagen
für praktische Zwecke zu ermöglichen. Der Anfänger möge sich daran nicht
stoßen, sondern vor allem auf die Sache achten. Sie ist weniger kompliziert
als die vielen Bezeichnungen.
Beide „Kanäle" tragen ihren Namen insofern mit Unrecht als sie beim
normalen Menschen kein Lumen besitzen. Es sind schwachwandige Stellen
(Loci minoris resistentiae), welche in einer ganz bestimmten Richtung und Be-
grenzung die Wege vorbilden, den irgend welche Gewalten wählen, welche
Bresche in die geschlossene Bauchwand zu legen vermögen (Darmschlingen,
Eiteransammlungen usw.). Die „Kanäle" sind also in der Norm nur potentiell
vorhanden. Die aufrechte Stellung des Menschen ist die Ursache dafür, daß die
potentiellen Kanäle, welche ganz unabhängig von dieser Stellung entstanden sind,
zu schwachen Punkten und — in pathologischen Fällen — zu wirklichen Kanälen
werden. Die „Brüche" sind spezifisch menschliche Erkrankungen.
Den Leistenkanal benutzt in der Norm der männliche Hode während des Anuius
intrauterinen Lebens, um in den Hodensack hinabzusteigen. Hinter ihm schließt "moiiuV
sich der Kanal wieder, enthält aber Verbindungen des Hodens mit dem _, nalls>.
_ . *— j} OVG3.G 111-
Bauchinnern, welche dieses Organ wie ein Kabel nach sich zieht (Samenstrang, guinaies
Abb. 98). Es gehören dazu auch bestimmte Fortsetzungen der Bauchwand