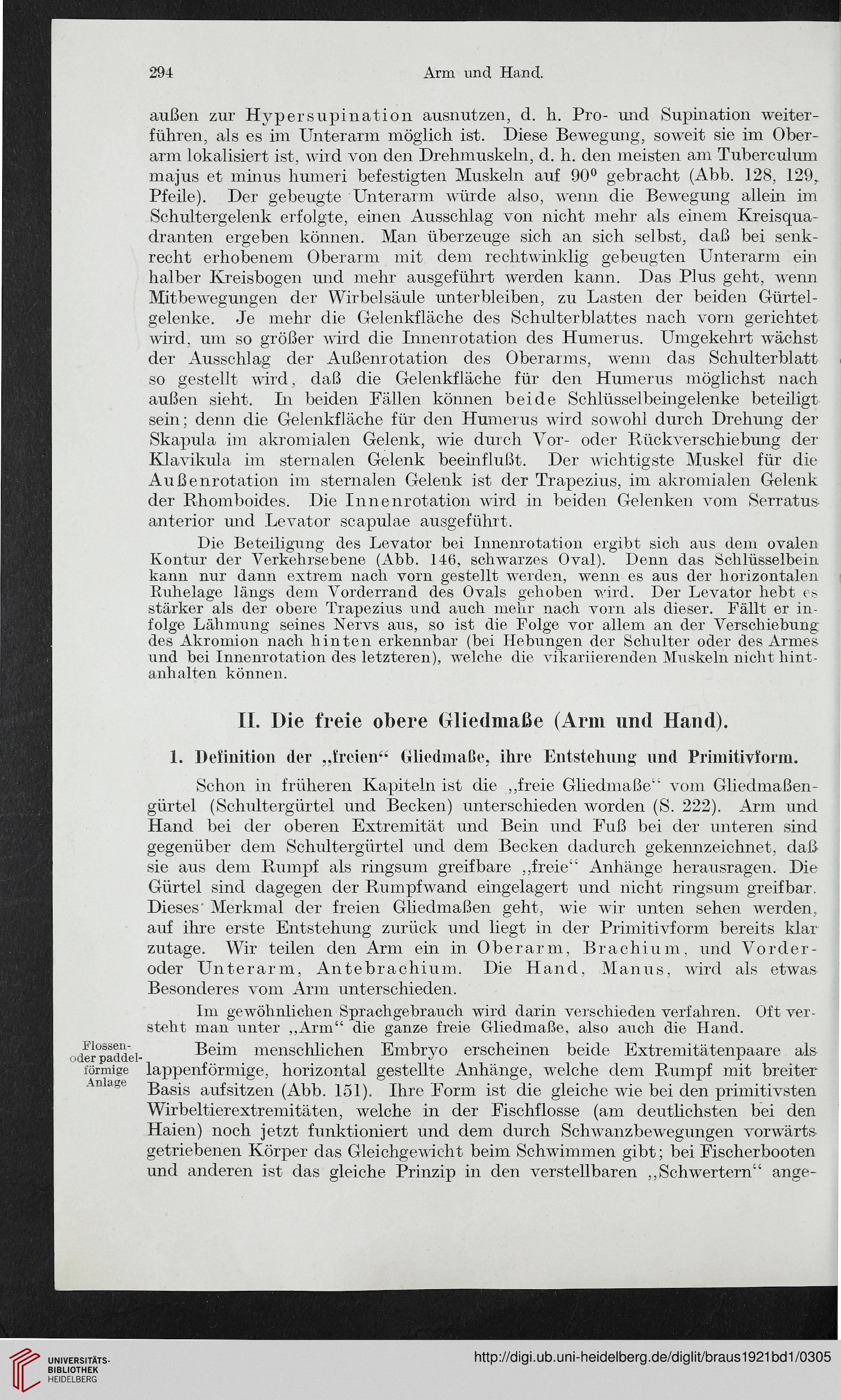294
Arm und Hand.
außen zur Hypersupination ausnutzen, d. h. Pro- und Supination weiter-
führen, als es im Unterarm möglich ist. Diese Bewegung, soweit sie im Ober-
arm lokalisiert ist. wird von den Drehmuskeln, d. h. den meisten am Tuberculum
majus et minus humeri befestigten Muskeln auf 90° gebracht (Abb. 128, 129?
Pfeile). Der gebeugte Unterarm würde also, wenn die Bewegung allein im
Schultergelenk erfolgte, einen Ausschlag von nicht mehr als einem Kreisqua-
dranten ergeben können. Man überzeuge sich an sich selbst, daß bei senk-
recht erhobenem Oberarm mit dem rechtwinklig gebeugten Unterarm ein
halber Kreisbogen und mehr ausgeführt werden kann. Das Plus geht, wenn
Mitbewegungen der Wirbelsäule unterbleiben, zu Lasten der beiden Gürtel-
gelenke. Je mehr die Gelenkfläche des Schulterblattes nach vorn gerichtet
wird, um so größer wird die Innenrotation des Humerus. Umgekehrt wächst
der Ausschlag der Außenrotation des Oberarms, wenn das Schulterblatt
so gestellt wird, daß die Gelenkfläche für den Humerus möglichst nach
außen sieht. In beiden Fällen können beide Schlüsselbeingelenke beteiligt
sein; denn die Gelenkfläche für den Humerus wird sowohl durch Drehung der
Skapula im akromialen Gelenk, wie durch Vor- oder Rück Verschiebung der
Klavikula im sternalen Gelenk beeinflußt. Der wichtigste Muskel für die
Außenrotation im sternalen Gelenk ist der Trapezius, im akromialen Gelenk
der Rhomboides. Die Innenrotation wird in beiden Gelenken vom Serratus
anterior und Levator scapulae ausgeführt.
Die Beteiligung des Levator bei Innenrotation ergibt sich aus dem ovalen
Kontur der Verkehrsebene (Abb. 146, schwarzes Oval). Denn das Schlüsselbein
kann nur dann extrem nach vorn gestellt werden, wenn es aus der horizontalen
Ruhelage längs dem Vorderrand des Ovals gehoben wird. Der Levator hebt es
stärker als der obere Trapezius und auch mehr nacb vorn als dieser. Fällt er in-
folge Lähmung seines Nervs aus, so ist die Folge vor allem an der Verschiebung
des Akromion nach hinten erkennbar (bei Hebungen der Schulter oder des Armes
und bei Innenrotation des letzteren), welche die vikariierenden Muskeln nicht hint-
anhalten können.
II. Die freie obere Gliedmaße (Arm und Hand).
1. Definition der „freien" Gliedmaße, ihre Entstehung und Primitiviorm.
Schon in früheren Kapiteln ist die „freie Gliedmaße'* vom Gliedmaßen-
gürtel (Schultergürtel und Becken) unterschieden worden (S. 222). Arm und
Hand bei der oberen Extremität und Bein und Fuß bei der unteren sind
gegenüber dem Schultergürtel und dem Becken dadurch gekennzeichnet, daß
sie aus dem Rumpf als ringsum greifbare „freie'" Anhänge herausragen. Die
Gürtel sind dagegen der Rmnpfwand eingelagert und nicht ringsum greifbar.
Dieses' Merkmal der freien Gliedmaßen geht, wie wir unten sehen werden,
auf ihre erste Entstehung zurück und liegt in der Primitivform bereits klar
zutage. Wir teilen den Arm ein in Oberarm, Brachium. und Vorder-
oder Unterarm, Antebrachium. Die Hand, Manus, wird als etwas
Besonderes vom Arm unterschieden.
Im gewöhnlichen Sprachgebrauch wird darin verschieden verfahren. Oft ver-
steht man unter „Arm" die ganze freie Gliedmaße, also auch die Hand.
odermddei- Beim menschlichen Embryo erscheinen beide Extremitätenpaare als
förmige lappenförmige, horizontal gestellte Anhänge, welche dem Rumpf mit breiter
' nage Basis aufsitzen (Abb. 151). Ihre Form ist die gleiche wie bei den primitivsten
Wirbeltierextremitäten, welche in der Fischflosse (am deutlichsten bei den
Haien) noch jetzt funktioniert und dem durch Schwanzbewegungen vorwärts
getriebenen Körper das Gleichgewicht beim Schwimmen gibt; bei Fischerbooten
und anderen ist das gleiche Prinzip in den verstellbaren „Schwertern" ange-
Arm und Hand.
außen zur Hypersupination ausnutzen, d. h. Pro- und Supination weiter-
führen, als es im Unterarm möglich ist. Diese Bewegung, soweit sie im Ober-
arm lokalisiert ist. wird von den Drehmuskeln, d. h. den meisten am Tuberculum
majus et minus humeri befestigten Muskeln auf 90° gebracht (Abb. 128, 129?
Pfeile). Der gebeugte Unterarm würde also, wenn die Bewegung allein im
Schultergelenk erfolgte, einen Ausschlag von nicht mehr als einem Kreisqua-
dranten ergeben können. Man überzeuge sich an sich selbst, daß bei senk-
recht erhobenem Oberarm mit dem rechtwinklig gebeugten Unterarm ein
halber Kreisbogen und mehr ausgeführt werden kann. Das Plus geht, wenn
Mitbewegungen der Wirbelsäule unterbleiben, zu Lasten der beiden Gürtel-
gelenke. Je mehr die Gelenkfläche des Schulterblattes nach vorn gerichtet
wird, um so größer wird die Innenrotation des Humerus. Umgekehrt wächst
der Ausschlag der Außenrotation des Oberarms, wenn das Schulterblatt
so gestellt wird, daß die Gelenkfläche für den Humerus möglichst nach
außen sieht. In beiden Fällen können beide Schlüsselbeingelenke beteiligt
sein; denn die Gelenkfläche für den Humerus wird sowohl durch Drehung der
Skapula im akromialen Gelenk, wie durch Vor- oder Rück Verschiebung der
Klavikula im sternalen Gelenk beeinflußt. Der wichtigste Muskel für die
Außenrotation im sternalen Gelenk ist der Trapezius, im akromialen Gelenk
der Rhomboides. Die Innenrotation wird in beiden Gelenken vom Serratus
anterior und Levator scapulae ausgeführt.
Die Beteiligung des Levator bei Innenrotation ergibt sich aus dem ovalen
Kontur der Verkehrsebene (Abb. 146, schwarzes Oval). Denn das Schlüsselbein
kann nur dann extrem nach vorn gestellt werden, wenn es aus der horizontalen
Ruhelage längs dem Vorderrand des Ovals gehoben wird. Der Levator hebt es
stärker als der obere Trapezius und auch mehr nacb vorn als dieser. Fällt er in-
folge Lähmung seines Nervs aus, so ist die Folge vor allem an der Verschiebung
des Akromion nach hinten erkennbar (bei Hebungen der Schulter oder des Armes
und bei Innenrotation des letzteren), welche die vikariierenden Muskeln nicht hint-
anhalten können.
II. Die freie obere Gliedmaße (Arm und Hand).
1. Definition der „freien" Gliedmaße, ihre Entstehung und Primitiviorm.
Schon in früheren Kapiteln ist die „freie Gliedmaße'* vom Gliedmaßen-
gürtel (Schultergürtel und Becken) unterschieden worden (S. 222). Arm und
Hand bei der oberen Extremität und Bein und Fuß bei der unteren sind
gegenüber dem Schultergürtel und dem Becken dadurch gekennzeichnet, daß
sie aus dem Rumpf als ringsum greifbare „freie'" Anhänge herausragen. Die
Gürtel sind dagegen der Rmnpfwand eingelagert und nicht ringsum greifbar.
Dieses' Merkmal der freien Gliedmaßen geht, wie wir unten sehen werden,
auf ihre erste Entstehung zurück und liegt in der Primitivform bereits klar
zutage. Wir teilen den Arm ein in Oberarm, Brachium. und Vorder-
oder Unterarm, Antebrachium. Die Hand, Manus, wird als etwas
Besonderes vom Arm unterschieden.
Im gewöhnlichen Sprachgebrauch wird darin verschieden verfahren. Oft ver-
steht man unter „Arm" die ganze freie Gliedmaße, also auch die Hand.
odermddei- Beim menschlichen Embryo erscheinen beide Extremitätenpaare als
förmige lappenförmige, horizontal gestellte Anhänge, welche dem Rumpf mit breiter
' nage Basis aufsitzen (Abb. 151). Ihre Form ist die gleiche wie bei den primitivsten
Wirbeltierextremitäten, welche in der Fischflosse (am deutlichsten bei den
Haien) noch jetzt funktioniert und dem durch Schwanzbewegungen vorwärts
getriebenen Körper das Gleichgewicht beim Schwimmen gibt; bei Fischerbooten
und anderen ist das gleiche Prinzip in den verstellbaren „Schwertern" ange-